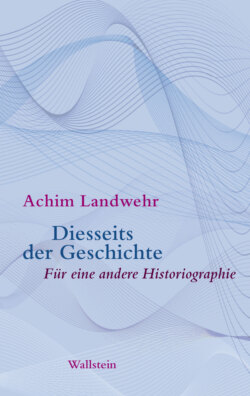Читать книгу Diesseits der Geschichte - Achim Landwehr - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zeitpraktiken und Zeitwissen
ОглавлениеWenn die Zeit nicht etwas Gegebenes, sondern etwas Gemachtes ist, wird die Aufmerksamkeit nahezu von selbst auf die alltäglichen Zeitpraktiken gelenkt. Trivial ist dieser Zugang nicht, denn die Idee von der Zeit als einer vorgegebenen und dem Menschen äußerlichen Realität war in und für die Moderne sehr wirkmächtig und hat ihre Auswirkungen bis heute. Die astronomische Zeit wurde mit Anbruch des naturwissenschaftlichen Paradigmas in mathematischen und physikalischen Begriffen definiert. Dadurch wurde die Zeit ihres historischen und soziokulturellen Charakters entkleidet und zu einer Naturtatsache stilisiert. Dieses Denken ging (und geht) grundsätzlich davon aus, dass die Zeit der Praxis vorgängig sei, dass sich die Praxis in die Rahmung der Zeit einzufügen habe. Doch schon seit Längerem lässt sich feststellen, wie wichtig der Standpunkt handelnder Akteure auch und gerade im Umgang mit der Zeit ist. Zeit ist ein soziokulturelles Produkt. Die soziale und kulturelle Praxis ist also nicht in der Zeit, sondern macht die Zeit.[54] »›Zeit‹ gibt es nicht einfach, Zeit ist kein Faktum, das immer schon in der Wirklichkeit vorliegt und als solches nur vom Menschen aufgedeckt werden muß. Zeit ist eine Ordnungs- und Sinnkategorie, eine von Menschen entworfene Dimension, über die sie ihre natürliche und soziale Umwelt zu erfassen und zu ordnen suchen.«[55]
Diesen Kosmos an Zeitpraktiken an dieser Stelle erfassen zu wollen, verbietet sich von selbst. Mit einigen Stichworten sollen seine Umrisse jedoch zumindest angedeutet werden, um die Potentiale näherungsweise vor Augen zu führen, die dieses Themenfeld (auch) für die geschichtswissenschaftliche Forschung besitzt. Man kann einsetzen mit den unterschiedlichen Formen der Zeitwahrnehmungen und Zeiterfahrungen, wenn Zeit als flüchtig, entleert, knapp oder kostbar eingeordnet wird,[56] wenn Empfindungen von Zeitdruck, Zeitlosigkeit sowie besseren, schlechteren oder unbeständigen Zeiten gemacht werden. Die Thematisierung unterschiedlicher Zeitrhythmen schließt sich unmittelbar daran an: Beschleunigung,[57] Verlangsamung oder Stillstand wären hier exemplarisch zu nennen. Auch die historisch variierende Konzeptualisierung von Lebenszeiten gerät ins Blickfeld, wie zum Beispiel die diversen Altersstufen zwischen Kindheit und Alter,[58] Aspekte von Geburt[59] und Tod,[60] Werden und Vergehen, Diesseits und Jenseits.[61] Bewegungen, die man im Zusammenhang mit der Zeit wahrnimmt, also Fortschritte[62] und Niedergänge,[63] lineare oder zyklische Verläufe, sind hier ebenso wenig zu vergessen wie das Verständnis der bereits genannten Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder auch Ewigkeit. Dies kann selbstverständlich keine abschließende Auflistung, muss vielmehr eine Andeutung und Anregung zur Fortsetzung sein.
Solche Zeitpraktiken stehen in einem engen Wechselverhältnis mit diskursiv konstituierten Formen des Zeitwissens, soll heißen mit der regulierten, zu einem gewissen Grad institutionalisierten und medial verfügbaren Organisation soziokultureller (Selbst-)Verständnisse der Zeit. Das Stichwort des Zeitwissens soll dabei deutlich machen, dass sich der geschichtswissenschaftliche Blick auf die Zusammenhänge konzentrieren muss, in denen Zeit dingfest gemacht werden kann.
An die Stelle der definitorischen und abstrakten Frage nach der Zeit (an und für sich) tritt also die historische Frage nach den Zeiten, ihren Ausformungen als einer soziokulturellen Praxis und ihrer diskursiven Verdichtung.