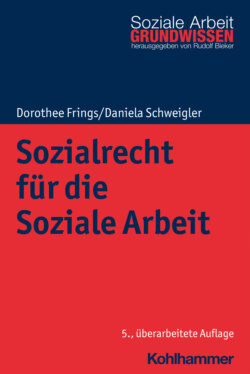Читать книгу Sozialrecht für die Soziale Arbeit - Dorothee Frings - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6.4 Trägerautonomie
ОглавлениеSchon die oben beschriebene Gestaltung der Beziehungen zwischen den öffentlichen und den freien Trägern zeigt, dass zwischen beiden ein Verhältnis besteht, welches nicht als eine »Leistung im Auftrag« beschrieben werden kann.
Wichtige Grundlage für die Gestaltung sozialer Dienstleistungen in Deutschland ist das Recht auf Selbstbestimmung der freien Träger als Leistungserbringer, auch dann, wenn ihre Tätigkeit durch den öffentlichen Leistungsträger finanziert wird. Die Trägerautonomie wird von der Verfassung geschützt. Art. 19 Abs. 3 GG garantiert die Grundrechte nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch Vereinigungen und allen Formen von Zusammenschlüssen von Personen. Das wichtigste Grundrecht für die freien Träger ist das Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG, eigenständig über ihre Handlungen zu entscheiden. Weitere konkrete Grundrechte sind die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), Religionsfreiheit (Art. 4 GG), Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und der Schutz des Eigentums (Art. 14 GG). Für die kirchlichen Wohlfahrtsverbände ist das Recht auf Selbstbestimmung zusätzlich durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 und 5 Weimarer Reichsverfassung geschützt.
Das Verhältnis von Staat und Religion ist in Deutschland durch eine historisch gewachsene Ausformung geprägt, die einen Zwischenweg zwischen dem Staatskirchenmodell und dem Laizismus (rigorose Trennung zwischen Kirche und Staat) wählt. Den Religionsgemeinschaften wird eine verfassungsrechtlich garantierte Sonderstellung eingeräumt, die ihnen innerhalb der Schranken der geltenden Gesetze das Recht gewährt, ihre Angelegenheiten ohne staatliche Einmischung selbständig zu regeln. Das Grundgesetz hat das erstmals in der preußischen Verfassung von 1848 (Art. 12) festgelegte und durch alle weiteren Verfassungen übernommene Kirchenprivileg unmittelbar aus der Weimarer Verfassung übernommen (Art. 140 i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV). Das Selbstbestimmungsrecht erfasst nicht nur die Religionsgesellschaften selbst, sondern auch alle ihnen zugeordneten Einrichtungen unabhängig von der Rechtsform, wenn sie sich nach ihrem religiösen Selbstverständnis dazu berufen fühlen, ein Stück des Auftrags der Kirche in dieser Welt zu übernehmen, sowie alle Vereinigungen, die sich die gemeinsame Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen. Damit werden auch die christlichen Wohlfahrtsverbände vom Kirchenprivileg erfasst (siehe BVerfG v. 22.10.2014 – 2 BvR 661/12).
Auch wenn freie Träger durch ihre Arbeit öffentlich-rechtliche Leistungsansprüche, z. B. im Bereich der Wohnungslosenhilfe (§ 67 SGB XII), erfüllen, werden sie dadurch nicht zum Teil der Sozialverwaltung oder deren Erfüllungsgehilfen.
»Die staatliche Zuwendung ist nämlich kein Akt der Beleihung. … Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege bleiben gerade hierbei Erfüller staatsunabhängiger, von ihnen selbst definierter Aufgaben.« (BVerfG v. 17.10.2007 – 2 BvR 1095/05)
Als allgemeine Regelung für alle Sozialleistungen legt § 17 Abs. 3 Satz 2 SGB I fest, dass die freien Träger einen Anspruch auf die selbstbestimmte Durchführung ihrer Aufgaben haben und damit nicht den Weisungen der öffentlichen Träger unterliegen (für die Jugendhilfe: § 4 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII; für die Sozialhilfe § 5 Abs. 2 Satz 2 SGB XII). Das Recht des öffentlichen Trägers auf Kontrolle einer Institution, die mit öffentlichen Aufgaben beauftragt wurde (§ 97 SGB X), findet auf freie Träger ausdrücklich keine Anwendung (§ 17 Abs. 3 Satz 4 SGB I).
Um die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten, für die der öffentliche Träger die Gesamtverantwortung trägt, dürfen vertraglich bestimmte Anforderungen festgelegt werden. Verlangt werden können Dokumentationen zum Leistungsumfang und Nachweise über die Verwendung von finanziellen Zuwendungen. Bei kirchlichen Trägern gehört dazu eventuell auch die Gewährleistung des Zugangs zu der Leistung für alle Leistungsberechtigten unabhängig von Konfession und Glaubensrichtung.
Eine besonders strittiges Problem ist die Weitergabe von Klientendaten vom freien an den öffentlichen Träger. Sie ist nur zulässig, wenn dies in einer Rechtsvorschrift präzise und zweckbezogen bestimmt wird (BVerfG v. 23.2.2007 – 1 BvR 2368/06). Vorschriften zu Meldepflichten freier Träger gegenüber den öffentlichen Trägern finden sich z. B. in § 61 SGB II oder § 8a SGB VIII. Der öffentliche Träger darf die Trägerautonomie jedoch nicht durch ein vertraglich vereinbartes Recht auf Akteneinsicht, auf Zutritt zu den Räumen der Einrichtung oder durch Weisungen im Einzelfall beeinträchtigen (siehe auch DIJuF-Rechtsgutachten 12.4.2017, JAmt 2017, S. 376–379).
In der Praxis verlangen Leistungsträger wie z. B. das Jobcenter immer wieder umfangreiche Dokumentationen und Berichte unter Preisgabe personenbezogener Daten der Leistungsberechtigten. Die Leistungserbringer und ihre Verbände sollten ihr Recht und das ihrer Klientinnen auf Datenschutz und Selbstbestimmung gegen diese Erwartungen verteidigen und sich keine vertraglichen Vereinbarungen aufdrängen lassen, die diese Rechte verletzen (näher: Schweigler, in: Kenji-Kipker/Voskamp, 2021, Kap. 8 Rn. 131 ff.).