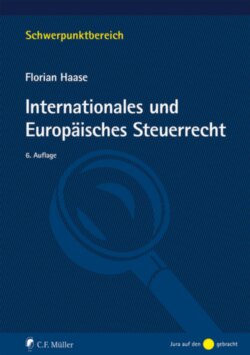Читать книгу Internationales und Europäisches Steuerrecht - Florian Haase - Страница 62
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Gesellschaftsrechtliche Vorfragen
Оглавление173
Die Verlegung des Satzungssitzes vom Inland in das Ausland et vice versa führt unter Beteiligung deutschen Rechts zwingend zur Auflösung der Gesellschaft. Dies darf auch als internationales Prinzip gelten. Jedenfalls in der Europäischen Union gestatten die Gesellschaftsrechte der Mitgliedsstaaten eine identitätswahrende Verlegung des Satzungssitzes nicht. Es ist eine Neugründung im Zuzugsstaat und nach den dort geltenden Rechtsvorschriften erforderlich. Nach dem EuGH-Urteil in der Rechtssache SEVIC[113] jedoch ließ sich jedoch durchaus zweifeln, ob eine solch rigorose Folge mit der Niederlassungsfreiheit des Art. 49 AEUV vereinbar ist[114].
174
Die meisten anderen vom EuGH und den nationalen Gerichten entschiedenen Fälle waren bislang Fälle der grenzüberschreitenden Verlegung allein des zivilrechtlichen Verwaltungssitzes, die gleichwohl kurz mit dem Stichwort „Sitzverlegung“ bezeichnet wurden[115]. Die Fülle an Literatur zu diesem Thema ist unübersehbar geworden. In der Sache hatte der EuGH in den Rechtssachen Daily Mail, Überseering, Centros und Inspire Art[116] entschieden, dass es dem Zuzugsstaat aufgrund des Art. 49 AEUV nicht gestattet ist, der zuziehenden ausländischen Gesellschaft die zivilrechtliche Anerkennung abzusprechen. Die sog. Sitztheorie galt damit als unanwendbar.
175
Jahrzehntelang standen sich im Internationalen Gesellschaftsrecht in der Hauptsache zwei Theorien gegenüber: die vor allem in Kontinentaleuropa und auch in Deutschland vorherrschende sog. Sitztheorie und die vor allem im anglo-amerikanischen Rechtskreis (aber auch zB in der Schweiz) vertretene Gründungsrechtstheorie. Nach der Sitztheorie bestimmte sich die Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft nach dem Recht des Staates, in dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat. Die Gesellschaft war dadurch nur so lange als rechtsfähig anzusehen, wie sich der Verwaltungssitz im Staat des Satzungssitzes befand. Wurde der Verwaltungssitz verlegt, waren die Gründungserfordernisse des Zuzugsstaates regelmäßig nicht erfüllt, so dass der Gesellschaft die Rechtsfähigkeit aberkannt wurde. Demgegenüber stellte die Gründungsrechtstheorie allein auf das Recht des Gründungsstaates einer Gesellschaft ab, so dass die Rechtsfähigkeit unabhängig vom Ort des Verwaltungssitzes fortbestand.
176
Einen Wegzugsfall hatte der EuGH für Körperschaftsteuersubjekte lange Zeit nicht entschieden, jedoch schien die Fortentwicklung der Rechtsprechung durch eine Parallele zu der Entscheidung Lasteyrie du Saillant[117] für natürliche Personen vorgezeichnet. Das Gericht hatte dort zur französischen Wegzugsbesteuerung einen Verstoß gegen Art. 43 EG [jetzt Art. 49 AEUV] konstatiert[118], und es war kaum zu erwarten, dass es für Körperschaftsteuersubjekte anders entscheiden würde[119]. Grenzüberschreitende Sitzverlegungen hätten damit de lege ferenda innerhalb der EU identitätswahrend möglich sein müssen und nicht mehr zu einer zivilrechtlichen Auflösung bzw Liquidation des jeweiligen Rechtsgebildes führen dürfen[120]. Es wäre somit insbesondere auch durch Sitzverlegung möglich, dass Gesellschaften in einem Staat ihren Satzungssitz und in einem anderen Staat ihren Ort der Geschäftsleitung haben. Dann handelt es sich um sog. doppelansässige Gesellschaften[121].
Nunmehr jedoch hat der EuGH in seinem Urteil vom 16.12.2008 (C-210/06)[122] in der Rechtssache Cartesio entschieden, dass ein EU-Mitgliedstaat die Verlegung des Sitzes einer nach seinem Recht gegründeten Gesellschaft in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verhindern könne. Dagegen ermögliche es die Niederlassungsfreiheit einer Gesellschaft ausdrücklich, ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen, indem sie sich in eine Gesellschaftsform des Rechts dieses Staates umwandelt, ohne dass sie im Zuge der Umwandlung aufgelöst und abgewickelt werden muss. Voraussetzung sei allerdings, dass das Recht des Aufnahmemitgliedstaats dies gestatte. Danach müssen mE fortan Hinausformwechsel und Hereinformwechsel aus der Sicht des deutschen Gesellschaftsrechts zulässig sein.[123]
Der EuGH scheint damit die Fortgeltung der Sitztheorie endgültig beschlossen zu haben.[124] Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.[125] Einstweilen besteht lediglich für die europäischen Gesellschaftsformen die Möglichkeit einer identitätswahrenden grenzüberschreitenden Sitzverlegung.[126]
Darüber hinaus ist in Bezug auf Sitzverlegungen, aber auch allgemein die deutschen Entstrickungsregeln das EuGH-Urteil vom 29.11.2011, C-371/10, in der Rs. National Grid Indus BV zu beachten.[127] Demnach ist die Wegzugsbesteuerung im Fall der Sitzverlegung von Gesellschaften mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar, wobei jedoch ein Steueraufschub bis zur tatsächlichen Realisierung zu gewähren ist. Danach haben die Mitgliedstaaten das Recht, im Zeitpunkt des Wegzuges eine Steuer auf stille Reserven festzusetzen. Diese darf jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Realisierung erhoben werden. Aufgrund des unter Umständen hohen Verwaltungsaufwandes bei der wegziehenden Gesellschaft im Zusammenhang mit der Nachverfolgung des betroffenen Vermögens soll insoweit die wegziehende Gesellschaft ein Wahlrecht zwischen Soforteinziehung und Steueraufschub haben. Mit diesem Urteil wendet der EuGH das Konzept der Wegzugsbesteuerung mit Steueraufschub, welches er in den Rechtssachen Lasteyrie du Saillant und N für Privatvermögen entwickelt hatte, erstmals auch auf betriebliche Sachverhalte an. Im Unterschied zur Situation bei Privatpersonen soll jedoch die Festsetzung im Zeitpunkt des Wegzugs endgültig sein, dh spätere Wertminderungen des betroffenen Vermögens wären durch den Wegzugsstaat nicht zu berücksichtigen. Des Weiteren kann der Wegzugsstaat eine Bankgarantie zur Besicherung der Steuerforderung verlangen (nicht zulässig im Falle eines Wegzugs von natürlichen Personen mit Privatvermögen).