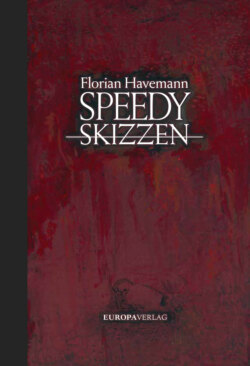Читать книгу Speedy – Skizzen - Florian Havemann - Страница 55
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 51: Der 27. Februarius
ОглавлениеFebruarius, so nannten die Lateiner, die ollen Römer ihren Reinigungsund Sühnemonat, ihren Brandopfermonat – wie passend, wie passend.
Also, Speedy, Speedy war in der Stadt, in Berlin, und wo anders konnte sie gewesen sein als bei Masseck, ihrem wieder aktuell aufgewärmten Liebhaber – jedenfalls hatte ich an diesem Tag keinen Grund anzunehmen, daß es da noch einen anderen, einen neuen geben könnte, und alles, was ich dann im nachhinein erfahren habe, von dem, was Speedy an diesem Tage erlebt hat, bestätigte diese Annahme. Wobei ich natürlich nicht alles erfahren habe: nicht, wie lange und wie oft sie mit Masseck im Bett war an diesem 27. Februar. Wie viele Höhepunkte sie an diesem Tag erlebt hat. Weiß ich nicht. Geht mich nichts an. In diese Details wurde ich nicht eingeweiht, die mich natürlich brennend interessiert hätten – brennend. Und außerdem hätte mich natürlich auch für diesen Tag brennend interessiert, wie sie’s mit Masseck trieb, in welchen Stellungen. Die Eifersucht ist eine lodernde Sucht, und Speedy war ja nicht an diesem 27. erst in die Stadt gefahren, sie war dies schon einen Tag davor, sie hatte also an diesem 27. schon mit Masseck einiges hinter sich, mit Masseck, den sie mir gegenüber mal sehr potent genannt hatte – in ihrer netten, offenherzigen Art. Speedy war also an diesem Tag satt und zufrieden durchaus in Grünheide Alt-Buchhorst, in ihrem Heim, zurückzuerwarten. Daß sie mal länger fortblieb als eine Nacht, das kam vor, war aber doch die seltene Ausnahme. Besonders in dieser Zeit, wo sie mich wohl ein bißchen unter Kontrolle haben wollte, damit ich nicht durchdrehe, damit die Angst mich nicht packt. Die Angst vor dem Nazi. Ich hatte den Busfahrplan natürlich im Kopf, denn so viele Busse fahren ja von Erkner nicht, insbesondere nicht im Winter. Von der Busstation an der Chaussee nach Kagel zu unserm Haus in der Petzseestraße, das ist ein Fußweg von knapp sieben Minuten, und also erhöhte sich für mich die Spannung, ob meine Speedy denn zurückkäme, mit der Regelmäßigkeit eines Zweistundentaktes seit dem frühen Vormittag in diesen fraglichen sieben Minuten immer wieder, obwohl mir mein Gefühl doch sagte: sie kommt nicht. Ich hatte die Uhr neben mich ins Atelier gestellt, ich malte, ich versuchte zu malen. Sehr konzentriert war ich nicht. Dies die Vorahnungen eines Künstlers zu nennen hieße zu übertreiben. Ich kam einfach mit meinem Bild nicht weiter. Hatte das fatale Gefühl, ich würde da Flächen auspinseln. Ich war immer noch mit meiner leerstehenden Fabrik beschäftigt. Und wartete auf Erlösung, wartete mit wachsender Nervosität auf meine Frau. Ich wartete aber auch darauf, daß diese letzten sieben Minuten dieses Tages, in denen ich mit ihrem Kommen rechnen mußte, rechnen konnte, vorübergehen, ohne daß sie kommt. Ich wäre auch darüber nicht ganz so unfroh gewesen, daß sie nicht kommt, denn dies hätte doch bedeutet, einen unbeschwerten Abend allein in weiblich schöner Unterwäsche verbringen zu können – unabhängig davon, ob meine Frau Lust darauf hat, mich als Frau zu sehen, und Spaß daran, meine Verweiblichung voranzutreiben.
Genau um 18 Uhr und 34 Minuten kommt der letzte Bus laut Fahrplan, Winterfahrplan – wenn er kommt, nicht ausfällt und auch nicht unpünktlich ist. Mit gewissen Verzögerungen ist immer zu rechnen, besonders im Winter, besonders bei Schnee und Eis, und an all dem hat auch die nationalsozialistische Revolution nichts ändern können, die doch den Saustall Deutschland ausmisten, mal wieder für Ordnung sorgen wollte. Und, weil es diese Verzögerungen, Verspätungen doch gibt und damals im Februar 33 das sowieso noch nicht absehbar war, ob es der nationalsozialistischen Revolution, die ja erst einmal dabei war, allerhand durcheinanderzubringen in Deutschland, je würde gelingen können, wenigstens Fahrpläne in Ordnung zu bringen, waren diese letzten sieben Minuten dieses Februartages gesondert zu behandeln – all die anderen davor, sie erhöhten lediglich meine Spannung und Anspannung, ob meine Frau denn nun käme, diese letzten des Tages, sie erhöhten die Spannung und Anspannung, ob sie denn nun nicht käme, und diese Spannung und Anspannung, sie konnte dann nicht nach den sieben Minuten vorbei sein. Erlöst und frei war ich noch nicht, wenn sie vorüber waren, denn immerhin konnte der Bus, auf dieser unwichtigen Strecke natürlich ein alter Klapperkasten, mehr nicht, ja verspätet, verzögert kommen und sogar irgendwo liegengeblieben sein. Motorschaden, vereiste Bremsen, von der glatten Straße abgekommen, in eine Schneewehe hineingefahren, und das bedeutete, noch warten zu müssen, eine unbestimmte Zeit warten zu müssen. Das bedeutete, nicht zu wissen, wie lange zu warten ist – maximal eine Stunde, für den Fall, den unwahrscheinlichen Fall, daß sich Speedy zu einem Fußmarsch entschließt. Im Winter? Durch den Schnee, in der Dunkelheit? Davon war nicht auszugehen, aber ganz und gar auszuschließen war das selbst bei Speedy nicht, die sich, im Unterschied zu mir, so überhaupt nichts aus Wanderungen macht.
Eine zwar nicht allzu oft, aber oft genug schon erlebte, durchlebte Situation, und an besagtem 27. Februar 33 fiel ich wieder in das Loch, das ich schon kannte, in das ich jedesmal falle, wenn ich so auf Speedy warten muß. Ich blieb im Atelier sitzen, vor meinem Bild sitzen, ich drehte die Uhr um, um nicht sehen zu müssen, wie die Zeit vergeht. Und ich begann erst dann richtig zu malen, kam endlich doch über das feige Auspinseln von Flächen hinaus und malte mich im Hintergrund meines Bildes frei, bei dem dunklen Wald, den es dort geben sollte – diese leerstehende kleine Fabrik, sie sollte nicht in einer städtischen Umgebung leer stehen, sondern irgendwo in der Provinz und also in diesem Umstand wirklich der Fabrik gleichen, die ich am Rande von Erkner so leer und vor sich hin stehen und verrotten gesehen hatte. Das geht ja schneller, als man sich das denkt, wie eine solche unbenutzte Werkstatt verfällt. Nach ein paar wenigen Jahren reißt man eine solche Fabrik besser ab und baut sich eine neue, falls die Konjunktur wieder anspringt, es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht. Also malte ich endlich, also wurde ich an diesem bisher so öden, auch künstlerisch öden 27. Februar mehr als ein bloßer Malermeister, der sich seiner Meisterschaft so überhaupt nicht sicher ist, zu einem Künstler, und das war dann doch schon mal die Rettung, die Rettung aus diesem dunklen Loch des unbestimmten Wartens, und im Hinterkopf die gute Gewißheit, danach dann noch ein paar Stunden vor mir zu haben, die mir guttun würden, ein paar weibliche Stunden. Plötzlich aber klingelte das Telephon, dessen Klingeln ich auch vom Atelier aus im Gartenhaus hören kann, und das Klingeln ließ mich erschreckt aufschrecken. Ich drehte die Uhr um, es war halb zehn, genau 21 Uhr und 36 Minuten, und heute weiß ich, daß der Brand des Reichstages gegen neun entdeckt worden war. Heute weiß ich, daß der Lokalreporter Masseck bereits um 21 Uhr 10 einen Anruf von seiner Redaktion erhalten hat mit der Aufforderung, sich umgehend zum brennenden Reichstag zu begeben, man brauche seine Vor-Ort-Reportage bis Mitternacht, man würde die Frontseite der BZ am Mittag für seinen Bericht solange freihalten. Ich weiß nicht, in welchem Zustande der Zeitungsschreiber Masseck von diesem Anruf seiner Zeitung überrascht wurde, und wenn ich hier Zustand sage, dann meine ich die Frage danach, ob es ihm in diesem Augenblick der Weltgeschichte, der zumindest deutschen Geschichte, grad stand, ob er gerade mit einer veritablen Erektion gesegnet und mit Speedy zugange war. Darüber fehlen mir die Informationen, jedenfalls aber war Speedy bei ihm, jedenfalls aber gehörte Speedy aufgrund dieses Anrufes mit zu den ersten, mit zu dem kleinen Personenkreis in Deutschland, in der Welt, der zu diesem frühen Zeitpunkt schon darüber informiert war, daß der Reichstag brannte. Massecks große Stunde als Lokalreporter, in dessen Ressort ja wohl auch sonst die Brandstiftungen in Berlin gehörten, war gekommen, Masseck eilte davon, mit einer gewissen Verzögerung vielleicht, weil er sich erst noch anziehen, unterbrochen im Liebes- beziehungsweise Geschlechtsakt erst noch ankleiden und seine Erektion in der Hose unterbringen mußte – Zeit genug, um Speedy jedenfalls über das Vorgefallene zu informieren. Und danach dann war sie allein, blieb sie allein in Massecks Wohnung zurück. Und vielleicht zwanzig Minuten später griff sie zum Telephon, um mich, um ihren Mann, anzurufen.
Und ich, ich ließ es klingeln, ich bewegte mich nicht, ich saß wie erstarrt in meinem Atelier vor meinem Bild, den Pinsel in der erstarrten Hand, und ließ es klingeln. Ich glaubte nicht, daß dieser Anruf für mich sein könne, denn wer, wer sollte mich zu dieser späten Stunde noch anrufen wollen, und überhaupt: das Telephon, es gehört doch mehr Speedy denn mir, es ist das ihre Domäne, ihr Mittel der Kommunikation, das, womit sie sich mit ihren Liebhabern zu verabreden pflegt – die Frage für mich war an diesem Abend des 27. Februar nur, ob es da nun vielleicht einen anderen, einen neuen Kandidaten gab, einen Nachfolger schon für Masseck. Bei dem sie doch war, bei dem ich sie doch glaubte. Bei dem ich sie glaubte und bei dem sie auch war, von dem aus sie mich anrief – darauf, daß Speedy das sein könnte, daß Speedy mich anrufen könnte, darauf kam ich natürlich nicht, darauf konnte ich auch nicht kommen, denn das hatte sie doch noch nie getan. Also ließ ich das Telephon klingeln. Und es klingelte und klingelte und hörte nicht auf zu klingeln. Und also meinte ich dann doch irgendwann, mich aus dem Atelier ins Haus bequemen zu müssen, um den Telephonhörer abzunehmen, dem Geklingel ein Ende zu machen, und dies in der sicheren Gewißheit, daß dieses verdammte Klingeln genau in dem Moment aufhören würde, wenn ich nach dem Hörer greife, mich mit meinem Namen melde, meine männliche Stimme hören lasse. Aber dem war nicht so, und als ich mir den Hörer ans Ohr drückte, hörte ich Speedys Stimme am andern Ende der Leitung, Speedy, die sich gar nicht erst meldete, die mir sofort Vorwürfe zu machen begann, daß ich sie so lange hätte warten lassen. Sie habe sich schon Sorgen gemacht – ob irgend etwas los sei. »Nein, nichts«, sagte ich verdattert, »was sollte sein? Ich male.« Das beruhigte Speedy erst mal, denn dadurch war klar, daß ich jedenfalls wieder mal noch nicht Bescheid wußte, noch nichts vom Brand des Reichstages im Radio gehört hatte, wo es ja schon zu dieser Zeit die ersten Berichte darüber gab. Auch das Radio gehört mehr Speedy denn mir, die dort in diesem Kasten immer ihre Konzertübertragungen zu hören pflegt, denn wenn es etwas gibt, was sie bei uns in Grünheide Alt-Buchhorst vermißt, dann ist es die Möglichkeit, mal eben ins Konzert zu gehen, in die Philharmonie – ich mache mir nichts aus klassischer Musik, auf diesem Ohr bin ich taub, und das sonstige Radiogedudel, das seichte Zeug, die Unterhaltungsmusik, das geht mir nur auf die Nerven, und wenn man da dann den ganzen Tag lang eine dieser dummdreisten Melodien nicht mehr los wird irgendeines Schlagers, so ist mir das ein Greuel. Und was die Nachrichten betrifft, bin ich doch Zeitungsleser, und ich bin es immer noch, wo man nun gar nicht soviel kotzen kann, wie man in der gleichgeschalteten Presse zu lesen bekommt – nur jetzt lese ich keine Zeitung, hier im Gefängnis nicht, hier bekomme ich keine und würde doch gern mal was zum Kotzen bekommen, denn das hat man doch immerhin in den letzten Jahren gelernt: zwischen den Zeilen zu lesen. Speedy weiß das alles natürlich, wußte es an diesem Abend schon des 27. Februar 33, daß ich ihr blödes Radio nur erdulde, erleide und diesen Kasten wohl niemals von selber anschalten würde, aber sie wollte auf Nummer Sicher gehen, an diesem Abend wollte sie es, wollte sie auch das Unwahrscheinliche sicher ausschließen können. Und sie wollte mich für den Rest des Abends von ihrem Radio fernhalten, wollte mich anderweitig beschäftigen.
Eine Mischung war das wahrscheinlich bei Speedy: daß sie wirklich Angst um mich hatte, davor, daß die SA kommt und mich in einen ihrer Keller holt, von denen es ja in dieser kurzen Zeit nach der Machtergreifung schon so Gerüchte gab, Geschichten, die Speedy von Masseck gehört hatte, von Masseck, der sie von der Polizei hatte, von der noch preußischen, noch nicht vollkommen vom System aufgesogenen, und aber auch die Angst, ich könnte es bei meinem leichten Nervenkostüm nun richtig mit der Angst zu tun bekommen, nach dem Reichstagsbrand und wegen dem Reichstagsbrand und wie der dann, unabhängig davon, ob sie den nun selber angezündet hatten oder nicht, von den Nazis ausgenutzt werden würde. Ob ich bei ihnen auf einer Liste stand oder nicht – wer mochte das wissen? Auch Speedy wußte es natürlich nicht, konnte es nicht wissen – auch wenn sie es eher für unwahrscheinlich hielt und damit ja dann auch recht behalten sollte. Aber eine Sicherheit gab es da nicht, konnte es nicht geben, und daß ich dies alles sehr viel dramatischer sehen, mich sehr viel stärker gefährdet wähnen mußte, als Speedy das tat, die mehr Distanz besaß, die mehr auch auf ihr Gefühl, ihren Instinkt vertrauen konnte als ich, der ich doch schon mal so falsch mit meiner Einschätzung gelegen hatte, der zu Herrn H, dies sei nur ein weiterer Kanzlerwechsel und nicht etwa der Beginn einer nationalsozialistischen Revolution, unter der ich mir doch als darin marxistisch geschulter nicht so recht etwas vorstellen konnte, jedenfalls keine echte Revolution, eine Revolution nach dem Schema der Kommunisten. Um so stärker hätte ich es doch nun mit der Angst zu tun kriegen müssen. Panik, wo es mit dem Reichstagsbrand ernst zu werden drohte und ja auch sehr viel ernster wurde. Die Rollkommandos der SA rollten ja wirklich in dieser Nacht, und ihre Keller füllten sich, und auch Brecht hätten sie beinahe erwischt. Er soll sich im letzten Moment in einer Mülltonne versteckt haben – hat mir Franz Jung später mal so erzählt, und natürlich haben wir beiden Zyniker darüber zu lachen versucht und uns den Witz gemacht, daß er ja da wohl genau hingehört habe: in eine Mülltonne. Aber das war Jahre später, und angesichts des brennenden Reichstages war mir jedenfalls nicht nach Witzen zumute. Und Speedy wußte das, Speedy kennt mich doch genau, genau genug, um zu wissen, daß mich der brennende Reichstag in Panik versetzen mußte, und genau daß das passiert, das wollte sie verhindern, und ich habe ihr dankbar zu sein, daß sie dies wollte – auch, wenn es ihr nicht ganz gelang. Nicht ganz gelingen sollte.
Speedy erklärte mir nach ihren Vorwürfen am Anfang, daß sie vorgehabt habe, noch mit dem letzten Bus nach Hause zu mir zurückzukommen, daß sie jedoch die S-Bahn am Alex verpaßt habe – ich vernahm es mit Erstaunen. Nicht, daß sie die S-Bahn verpaßt hatte, denn das kann ja mal vorkommen, erstaunte mich, mich erstaunte, daß sie mir dies unbedingt mitteilen wollte, daß sie mich extra deswegen anrief. So etwas hatte es doch vorher noch nie gegeben.
Und dann sagte sie diesen Satz, mit einem leicht süffisanten Unterton – soweit dies aus dem Telephon herauszuhören war: »Du hast also noch einen Abend frei, mein Schatz.« Was sie damit meine, fragte ich sie, für mich bedeute dies doch, noch eine weitere Nacht ohne sie verbringen zu müssen – während ich dies sagte, hatte ich das fatale Gefühl, Speedy müsse durchs Telephon spüren, daß ich lüge, ihr etwas vorzumachen versuche.
Sie: »Ich weiß doch, was du so treibst, wenn ich nicht da bin.«
Ich: »Was treibe ich denn da?«
Sie: »Du brauchst doch deiner Frau nichts vorzumachen, und heute bekommst du die ausdrückliche Erlaubnis von mir, dich in deinen Dessous weiblich schön zu machen.«
Sie wußte also, daß ich dies in ihrer Abwesenheit tat – eigentlich nicht verwunderlich, aber ein Schock war es trotzdem für mich, ein Schock, der mich sprachlos machte. Und noch einmal mehr sprachlos machte es mich, als Speedy mir sagte, sie habe doch nichts dagegen, verstünde mich sogar, und an diesem Abend solle ich dies unbedingt tun, mich weiblich hübsch und schön und zurechtmachen.
»Zieh deine Unterwäsche an«, sagte sie, »und dann darfst du auch in meinem Nachthemd schlafen.«
Darauf ich: »Wenn es mir denn paßt.«
Darauf sie: »Es paßt dir, und wenn es etwas eng ist, dann tust du es trotzdem – verstanden?«
Verstanden? Gute Frage – natürlich hatte ich sie verstanden. Was ich aber nicht verstand, das war, warum sie mich dazu aufforderte, ja, geradezu dazu zu verdonnern schien, mir dies zur Aufgabe machte, und besonders dies: die Nacht in ihrem Nachthemd zu verbringen. Aber sie war noch nicht ganz fertig, sie verlangte mehr von mir, verlangte, daß ich am nächsten Morgen bis zu ihrer Rückkehr als Frau im Haus herumlaufe – warum auch das noch? Sie mußte meine Frage spüren, sie sagte, sie wolle das einmal sehen, wie ich ihr als Frau entgegenkomme, fix und fertig verweiblicht. Wie ich mich Schritt für Schritt vor ihr in eine Frau verwandele, das hätte sie jetzt schon ein paarmal erlebt, jetzt wolle sie mit dem Ergebnis konfrontiert werden – es klang zumindest logisch und nachvollziehbar. Ihr eigentlicher Grund aber dafür war ein anderer, nicht dieser logisch für mich nachvollziehbare Grund, nicht der Grund, den sie mir nannte, ihr eigentlicher Grund war der, mich auf diese vielleicht im Ernstfalle nicht sehr wirkungsvolle Weise vor den SA-Horden, die schon in der Stadt, in Berlin wüteten, zu schützen – falls sie mich denn auf einer ihrer schwarzen Liste zu stehen hatten und mich in dieser Nacht noch suchen würden. Nicht den Mann Schlechter sollten sie dann im Hause Petzseestraße 77 finden, sondern eine Frau. Das war nicht viel, aber ein bißchen an Schutz hätte es wohl bedeutet, und mehr wohl konnte Speedy von der Ferne und über den Fernsprecher für mich gar nicht tun. Außer mich in die totale Panik zu versetzen, mich kopflos zu machen – auf daß ich mich dann im Keller verstecke, was natürlich völlig sinnlos gewesen wäre, denn im Keller hätten sie garantiert nachgesehen, diese Kellerasseln mit ihren eigenen Kellern, Folterkellern. Was hätte ich sonst noch tun können? In den nächtlich dunklen Wald abhauen, um mir dort dann den Arsch abzufrieren und nicht nur den Arsch allein. Der 27. Februar. Winter. Schnee. Kalt.
Natürlich war das alles riskant, für Speedy im höchsten Maße riskant, mich diesem Risiko auszusetzen, dort in unserm Haus zu bleiben, in eine Frau verwandelt – besonders, wo ich doch als Frau keinerlei Perfektion erreicht hatte und möglicherweise von jedem einigermaßen cleveren SA-Mann sofort als Mann erkannt werden konnte, und also hieß es für sie, hieß es für Speedy, daß ich den Grad meiner Verweiblichung schlagartig und ohne ihr Zutun, ihre Hilfe dabei zu erhöhen hatte, und all das, was sie nun von mir noch verlangte, mir zur Aufgabe machte, es zielte genau in diese Richtung: ich solle mich an diesem Abend noch zu schminken versuchen, solle dies dann gleich morgen früh noch einmal tun – wieder war ihre Begründung dafür, die Begründung, die sie mir gab, die, daß sie mir als Frau begegnen wolle, daß sie sehen wolle, mit einem unbefangenen Blick sehen wolle, wie sehr ich schon als Frau gelten könne. »Gib dir alle Mühe«, sagte sie, »ich will sehen, wieviel du dir bei mir abgeschaut hast.« Und dann sagte sie: »Paß aber auf, daß du geschminkt nicht ordinär wirkst«, und dies nun war Teil des Beschäftigungsprogramms, das sie mir auferlegen wollte, mir sehr erfolgreich auferlegte, denn das, mich zu schminken, das war ja nun wirklich eine Herausforderung für mich, und dabei dann alles Ordinäre zu vermeiden, noch einmal mehr. Aber Speedy hatte sich in ihrer unermeßlichen Klugheit noch mehr für mich ausgedacht, hatte noch eine weitere Aufgabe für mich parat, eine Aufgabe, die nun wiederum logisch erscheinen mußte und folgerichtig, wenn es ihr darum ging, mich in eine Frau verwandelt im Hause anzutreffen: ich solle am Morgen in ihrem Kleiderschrank ein Kleid für mich heraussuchen – irgendeines würde mir schon passen, sagte sie, aber ich solle ein Kleid wählen, das in die Jahreszeit passe, oder einen Rock mit Bluse, etwas, das mich Dame sein ließe. Ihre eigentliche, von mir nicht im geringsten erahnte Logik dabei war natürlich wiederum eine andere: falls sie denn in der Provinz nicht gleich noch in dieser Nacht zuschlagen, dann sollten sie da am nächsten Vormittag bei uns im Hause nicht eine leicht in weiblicher Unterwäsche nur gekleidete Frau antreffen, sondern eine Dame, eine voll und ganz und, wie es sich gehört, angezogene Frau und Dame, und sie hatte an alles gedacht, meine Speedy, und das in den zwanzig Minuten, die sie Zeit hatte, den nächtlich überraschenden Anruf bei mir vorzubereiten – oder sie improvisierte dies, während sie mit mir am Telephon sprach und mich willig fand, die mir von ihr gestellten Aufgaben alle zu erfüllen, jedenfalls von mir keinen Widerspruch zu hören bekam. »Zieh meine Pantuschen an«, sagte sie, »die Knöpfschuhe sind dir doch zu klein.« Was stimmte, aber natürlich schade war. Und das sagte ich ihr auch, daß mir ihre Knöpfschuhe lieber wären, und in dem Moment wußte sie wahrscheinlich, daß sie mich hatte, daß ich folgsam und brav ihrem mir auferlegten Beschäftigungsprogramm folgen würde.
Aber auch damit waren wir noch nicht fertig, war sie mit mir noch nicht fertig. Sie hatte sich noch etwas anderes zu meinem Schutze ausgedacht: sie sagte, ich solle mir einen weiblichen Namen wählen, und das verstand ich nun gar nicht und konnte es auch nicht verstehen, und Speedy wußte natürlich, daß ich mir darauf nun überhaupt keinen Reim mehr würde machen können, und also begründete sie ihr Verlangen: sie wolle mich mit einem weiblichen Namen anreden können, wenn sie nach Hause komme und mir in weiblicher Gestalt begegne – was hatte sie vor? Ich war so irritiert, daß mir natürlich gar kein weiblicher Vorname einfallen wollte, ein Vorname, der ja irgendwie zu mir passen mußte. Und wahrscheinlich hatte sie auch das schon vorbedacht: sie sagte, wenn mir kein Name einfallen würde, dann würde sie mir einen Namen geben, ich solle Victoria de Fries heißen und mich, falls mich denn irgendwer in meinen Frauensachen behellige, als eine Freundin von ihr ausgeben. Victoria de Fries – merkwürdig: warum nicht nur Victoria, warum de Fries, wozu gleich auch noch einen Familiennamen? Und wer sollte mich denn behelligen? Ich verstand nun gar nichts mehr, und Speedy wußte natürlich, daß ich nun gar nichts mehr würde verstehen können, und sie schob schnell einen erklärenden Satz hinterher, so schnell, daß ich meine beiden erstaunten Fragen gar nicht selber stellen konnte, weder die nach dem Familiennamen noch die, wer mich denn wohl behelligen könne. Der Postbote etwa? »Nur zu deiner Sicherheit«, sagte Speedy, und dieser Satz, er war ja sehr nah an der Wahrheit dran, an der von mir natürlich noch nicht mal erahnten, und ich konnte ihn nur auf einen etwaigen Postboten gemünzt verstehen, aber natürlich nicht ganz verstehen, denn schließlich müßte ich die Tür gar nicht aufmachen, wenn der Postbote klingelt, und es war doch gar nicht anzunehmen, daß ich mich das als Frau trauen würde, da jemandem die Tür zu öffnen – merkwürdig, merkwürdig, und natürlich staunte ich Schlechter nicht schlecht, als ich mich nun von meiner Frau mit diesem Namen versehen sah: Victoria de Fries. Wie kam sie nur auf diesen Namen? Ich war so irritiert und durcheinander, daß ich nur diese Frage stellen konnte: »Und warum grad Victoria?« »Victoria de Fries – merk dir das!«, korrigierte sie mich, fast ärgerlich im Ton, und dann sagte sie, recht unvermittelt und so, als würde ihr dies erst in diesem Moment einfallen: »Victoria heißt Sieg.« Gut, wenn Victoria Sieg heißt, dann … – ja, was dann? Dann heißt Victoria Sieg, dann heiße ich also Victoria, aber: »Und de Fries? Was heißt de Fries?« »Irgendwas«, antwortete Speedy, und sie bellte es fast durchs Telephon, und ich dachte wieder mal bloß: der Anschiß lauert überall. Und: verstehe einer diese Frau.
Und das war’s dann, damit hängte sie auf, und das erste, was ich mich fragte, nachdem Speedy unser Telephongespräch beendet hatte, das war die dumme Frage danach, wer hier denn wohl einen Sieg davongetragen haben könnte – Speedy natürlich und nicht ich, sie sollte Victoria heißen und von mir aus auch Victoria de Fries, und wenn das frühere Fräulein Elisabeth Koehler nicht schon diesen wunderbaren Spitznamen Speedy von mir bekommen hätte, ich hätte sie wohl dann Victoria genannt und damit Sieg, die Siegerin de Fries oder von irgendwas. So aber, mit Speedy als Speedy, war das nun mein Name, mein Frauenname: Victoria de Fries, und ich murmelte es immer wieder vor mich hin, dieses Victoria de Fries, wohl um mich an diesen Namen zu gewöhnen, der so wenig zu mir passen wollte, und ich tat es, während ich tat, was mir geheißen, was mir von Speedy für diesen Abend aufgetragen war, und ich tat es dann noch einmal, als ich dann schon verschönt in der Unterwäsche des schönen Geschlechts vor dem Spiegel, vor Speedys Spiegel, in unserm Schlafzimmer saß und mich zu schminken begann, mich mit dem Schminken abplagte. Ich bin zwar Maler, aber das war nun wirklich erst mal meine Sache nicht: einen Lippenstift zu führen. Nur Übung macht den Meister, die Meisterin, und also übte ich. Üben, üben, üben, das war Speedys Motto gewesen für mich, als es um die Strapse ging und meine Schwierigkeiten mit ihnen, es galt jetzt noch einmal mehr, und das mit dem Schminken, das war doch, im Unterschied zu den Strapsen, wirklich etwas vollkommen Neues für mich, etwas, das ich noch nie zuvor in meinem Leben getan und versucht hatte. Und auch das mit dem Nachthemd war neu für mich, vollkommen neu und dann wunderbar: in unserm Ehebett zu liegen, mit Speedys Nachthemd in unserm Bett zu liegen, das mir erstaunlich gut, sehr viel besser jedenfalls als von mir vermutet, paßte, wenn es auch oben wegen meinem männlich breiten Brustkorb etwas eng und beengend war, endlich als Frau auch im Bett, und ich verschränkte die Arme über dem Kopf, und ich genoß es. Ich war selig. Frau. Frau zu sein. Mich als Frau zu fühlen. Wunderbar. So wunderbar, so erregend auch, daß mich die Angst überkam, Speedys Nachthemd zu beflecken – ein bißchen Angst hatte ich also doch, ein bißchen mit der Angst hatte ich es also doch zu tun in jener Nacht des 27. Februar. Aber was für eine schöne, erregende Angst war dies im Vergleich zu der Angst, die ich eigentlich hätte haben müssen, der Angst um mich und mein Leben. Währenddessen brannte in Berlin der Reichstag, währenddessen jagte der Nazi seine Feinde, wütete die SA, und ich, ich ahnte nichts davon. Ich war mit etwas anderem beschäftigt, voll und ganz beschäftigt, und auch ich begann da etwas zu ahnen, etwas, das mit der großen Welt da draußen aber auch nichts, gar nichts zu tun hatte, ich ahnte oder wollte es mir doch zumindest einreden, daß Speedy nichts gegen eine Befleckung ihres Nachthemdes einzuwenden haben würde, haben könnte, ja, daß sie mich vielleicht genau deshalb dazu aufgefordert habe, es zu tragen, auf daß ich es zum Beweise meiner Erregung beflecke, daß ich mich auf diese Weise ihr als das offenbare, was ich war und bin und hier nun im Gefängnis noch einmal mehr bin und sein muß, ein kleiner Wichser, ein Wichserchen, und das hieß und wollte mir bedeuten, daß meine Angst also unbegründet war, die Angst vor der Befleckung, die Angst vor dem Samenerguss – sollte sie mir doch eine Szene machen deswegen, wegen einem Fleck, einem Spermafleck. Dieser peinliche Moment, er versprach wunderbar zu werden. Und ich befleckte es, befleckte das Nachthemd von Speedy und tat nichts dagegen, genau dies zu verhindern.
Plötzlich aber fühlte ich mich nicht Frau genug, plötzlich wurde ich mir in meiner Glückseligkeit des gravierenden Mangels bewußt, der mich von einer Frau unterscheidet, und ich spreche hier von dem Mangel, nicht dem Zuviel, dem kleinen Schnörkel, der diese Frau immer noch Mann bleiben ließ und der sich nun, nach der Befleckung, ganz schnell wieder auf einen bloßen Schnörkel reduziert hatte, auf ein zu vernachlässigendes Schniepelchen, ich spreche von den mir fehlenden Schwellungen, den Schwellungen im weiblichen Brustbereich, spreche von Titten – um das einmal so ordinär Titten zu nennen, was mir zum Weibe fehlte und fehlt. Und immer fehlen wird. Solange es der medizinischen Wissenschaft nicht einfällt, wie diese Mangelerscheinung nicht doch irgendwie operativ zu beheben ist oder durch ein paar Pillen, die zu schlucken sind – aber glauben wir doch wenigstens an diesen Fortschritt. Vielleicht haben es ja nachkommende Generationen von Männern besser, und ich sage das einfach so hin: Männer und differenziere da gar nicht und spezifiziere es nicht auf die wenigen Männer, die, wie ich, Sehnsucht nach richtigen Brüsten haben könnten, ich behaupte das einfach so, daß wir Männer alle da lieber mehr als nur diese rudimentären Brustwarzen hätten – von wegen Penisneid, der Frauen Penisneid. Tittenneid, Säugetierneid. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Oder als Männer eben für immer runter. Ins Nichts des Säugungsunfähigen. Aber auch ohne das Nuckeln dran, ohne den Säugling, das Baby, die Gebärfähig- und Gebärfreudigkeit gibt es nichts Schöneres auf der Welt als die schönen Brüste des schönen Geschlechts, und von mir aus müssen das gar keine großen Euter sein, ich liebe ja die kleinen Busen, Speedys Busen, ihre flachen, festen Brüste. Ihre Brüste, die so flach und fest sind, daß sie keinen Büstenhalter nötig haben. Aber natürlich hat Speedy welche, besitzt Speedy da ein paar schöne BHs, und sei es als bloße Dekoration, und weil es doch einen ungeheuer erotischen Effekt macht, wenn sie sich dieser Verhüllung ihrer reizvollen Brüste entledigt, und also wußte ich, was ich zu tun hatte: in Speedys Kleiderschrank nachschauen, ob mir nicht da doch einer ihrer Büstenhalter passen könnte und dann dessen kleine Körbchen der Größe A irgendwie auszustopfen wären, und ich sprang aus dem Bett und wagte diesen Schritt meiner Verweiblichung, wagte ihn ganz auf meine Kappe, ohne von Speedy dazu aufgefordert zu sein – sie wollte mich doch als Frau, und sie würde doch dann wohl gegen diese Überraschung gar nichts haben können, mich auch oben herum und brust- und BH-mäßig als Frau perfektioniert zu sehen. Ich kam mir geradezu wie ein eifriger Musterschüler beziehungsweise eine eifrige Musterschülerin vor.
Und dann lag ich wieder da, nun mit einem BH, mit einem ausgestopften Büstenhalter in unserm Ehebett – ausgestopft mit einem Paar schon von Speedy benutzter Seidenstrümpfe, und dieser BH, er paßte zwar, aber doch nur knapp und gerade so, und ganz schön eng war das gute Stück schon, beengt und in meinem Atem jedenfalls eingeschränkt fühlte ich mich, was aber natürlich nichts an meinem Glück änderte, an meinem weiblichen, verweiblichten Glück, und dann muß ich wohl weggedöst sein, eingeschlummert. Als ich nach Stunden plötzlich aufschreckte und aufwachte, mir war so, als hätte ich da ein Geräusch gehört, brannte noch die Nachttischlampe, und es war, der Wecker zeigte es, kurz nach fünf in der Früh. War es dieser Schreck, dieses schreckhafte Erwachen, was mich so wach machte, daß ich dann nicht wieder einschlafen konnte? Daß ich mich quälte und von der einen Seite zur anderen wälzte und doch keinen Schlaf finden konnte? Und daß es mit einemmal in der Dunkelheit, ich hatte die Nachttischlampe ausgeschaltet, bei mir hier oben im Dachstübchen zu rumoren anfing, daß diese fatale, fiebrige, höhere Denktätigkeit einsetzte, die mich von Minute zu Minute in immer größere Aufregung, nicht Erregung, versetzte? So war es wohl. Ein Schreck saß mir in den Gliedern, wollte nicht weichen, und da konnte ich mir dreimal sagen, daß da wahrscheinlich nur des Nachbarn Katze ums Haus geschlichen sein wird und mein Grünheide Alt-Buchhorst in gewohnter provinzieller Ruhe dalag und von dieser Welt da draußen für mich nichts zu befürchten war. Der Schreck macht wach, die Furcht läßt denken – auch die unbegründete.
Und so, furchtsam und wach und erschreckt, begann ich also zu suchen, nach Gründen zu suchen, nach dem Grund, was Speedy wohl zu diesem Schritt veranlaßt haben könnte, mich noch anzurufen, mir diese merkwürdigen Aufträge zu geben, die, so schön sie doch waren, mich doch auch verunsicherten, und insbesondere dieser Moment, der mir noch bei ihrer Rückkehr bevorstand, er beunruhigte mich doch, daß ich ihr da nun als Frau entgegentreten sollte – was, wenn sie da dann lauthals in Gelächter ausbricht und der schöne Traum vom schönen Geschlecht damit für mich beendet ist? Was ich zuerst vermutete, das war, daß mir Speedy durch diese ganzen Aufträge und Aufgaben für mich wegen der paar Mißhelligkeiten in der vergangenen Zeit, die ich doch aber nicht für so gravierend gehalten, gar nicht als so schlimm erlebt hatte, in meinen Wünschen, den von ihr richtig vermuteten Wünschen entgegenkommen wollte. Wegen Masseck. Das schien einleuchtend. Und daß mir das mit Masseck nicht behagte, das war klar, das mußte auch Speedy klar sein. Weil ich’s ja nicht verstand. Dieses Wiederaufwärmen. Aber der Gedanke beruhigte mich nicht, der mit Speedys Entgegenkommen. Und er konnte mich auch nicht beruhigen, weil ich ja diesen Moment noch vor mir hatte, von dem ich doch wußte, was für eine Herausforderung dies für mich bedeuten würde, mich zum ersten Mal meiner Frau und in ihr zum ersten Mal einem anderen Menschen überhaupt als Frau zurechtgemacht zu zeigen, vollkommen als Frau zurechtgemacht zeigen zu müssen. Mit Rock und Bluse oder vielleicht einem ihrer Kleider, geschminkt und nun auch mit einem BH, einem weiblich ausgestopften. Und als Victoria de Fries, und das war doch der größte Irrsinn. Ein Irrsinn, der einen ganzen Reigen von Gefühlen, sich heftigst widerstreitender Gefühle in mir auslöste: von stärkster Scham bis zu Glückseligkeit.
Gut, wenn das alles gewesen wäre, ein Auf und Ab der Gefühle, aber das Denken hört ja nicht so leicht wieder auf, wenn es bei mir erst mal in Gang gekommen ist, und dieses Denken, es wurde dann doch stutzig und begann ganz anderweitig zu assoziieren, und besonders, warum das Ganze nicht bis zum nächsten Tag von Speedys angekündigter Rückkehr hatte warten können, gab mir zu denken, denn schließlich hätte ich ja diese Aufgabe einer Verweiblichung bis in die oberste Kleidungsschicht hinein von ihr auch dann erst bekommen können, separat und auf mich allein gestellt in unserm Schlafzimmer zu vollziehen, während sie im Salon auf mich wartet, meinen Auftritt als Frau, als dann sehr viel perfektere Frau erwartet – warum mußte für Speedy dies alles schon am Abend zuvor beginnen, während ihrer Abwesenheit? Und dann das Nachthemd, die Nacht in ihrem Nachthemd. Warum? Keine Antwort erst und dann aber doch der Zipfel einer Antwort, etwas, in das ich mich verbiß. Erst nur eine Assoziation, eine Gedankenverbindung, wenig substantiiert. Ein flüchtiger Gedanke, aber ich hielt ihn fest, klammerte ihn fest, und dann machte es Klack, Klack, und ich hatte das Gefühl, als fiele bei mir der Groschen: da war doch etwas ganz, ganz ähnlich an Speedys Verhalten, daß sie mich anderweitig beschäftigte, mit meiner Verweiblichung beschäftigte, denn genau das hatte sie doch schon einmal getan, am 30. Januar, dem Tag, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, dem Tag der Machtergreifung – die Ähnlichkeit war doch frappant, die Analogie in Speedys Verhalten mir gegenüber. Ihrem Mann gegenüber, den sie für einen Angsthasen hielt und für einen Angsthasen zu halten doch auch gewichtige Gründe hatte und immer noch hat. Plötzliche Panik, ob da vielleicht wieder irgend etwas in Berlin passiert sein könnte, das mich eigentlich und im höchsten Maße beunruhigen müßte, etwas aber, über das ich mich aber nicht, wenn es allein nach Speedy ginge, beunruhigen sollte, von dem sie mich fernhalten wollte, ablenken wollte. Genau das könnte es doch sein. Genau so.
Wilde Spekulationen darüber, was in Berlin passiert sein könnte: ich phantasierte von einem Bürgerkrieg, von einem Aufstand der organisierten Arbeiterschaft, einem Zusammengehen von SPD und KPD, von der Überwindung des bis dahin unüberwindlich scheinenden Bruderzwistes. Sosehr ich den Nazi hasse, sosehr ich auch die beiden Arbeiterparteien dafür verachtet hatte, daß sie sich nicht gegen die Machtergreifung durch die Nazis gewehrt, sondern kleinlaut klein beigegeben hatten, einen Sieg der Linken konnte ich mir doch nicht wünschen. Ich nicht. Als ehemaliger Linker und KPD-Sympathisant doch nicht, und nicht nur, weil ich diese Leute doch kannte und wußte, daß es sich bei ihnen um ähnlich rohe Gesellen handelt wie die Nazis. Das waren doch Brüder, die Nazis und die Kommunisten. Pack, bei dem es keinen Pardon gibt. Das müßte ich doch befürchten, als Abtrünniger verfolgt zu werden. Das Proletariat ist nachtragend, und auch meine einstigen Genossen werden ihre Listen geführt haben, wo ganz besonders und dick unterstrichen die Verräter verzeichnet sind. Und den Verräter, den hassen sie doch mehr als ihren wirklichen Feind. Ich kenn das doch, ich habe das doch mitgemacht. Habe doch selber Leute, vollkommen harmlose Hanseln, Künstler, aus dem Bund proletarischer Künstler ausgeschlossen, als ich dessen Sekretär und Schriftführer war, Leute, die auf dem Absprung waren, verständlicherweise die Schnauze voll hatten von dem Parteigebrabbel – von selber gehen, sich von uns wie zivilisierte Menschen verabschieden, nein, das durften sie nicht, das ließ die Parteiraison nicht zu, die heilige proletarische Sache. Sie mußten sich erst von uns Zurückgebliebenen, Zurückbleibenden als Ketzer beschimpfen, als Lakaien der Bourgeoisie brandmarken lassen. Schönes Spiel, Scheißspiel. Und genauso war es mir dann doch auch ergangen, als ich mich auf den Weg nach rechts machte, meine Schriftführertätigkeit einstellen wollte, meine Mitarbeit an der Sache der proletarischen Revolution – was, wenn sie nun siegen würde? Nur das nicht. Ich sah mich befragt, von einem strengen Revolutionstribunal verhört, ich sah den kurzen Prozeß vor mir, den sie mit einem Verräter wie mir veranstalten würden, sah mich standrechtlich erschossen, und für einen kurzen Moment doch wünschte ich mir nichts sehnlicher als den Sieg von Adolf Hitler im Bürgerkrieg.