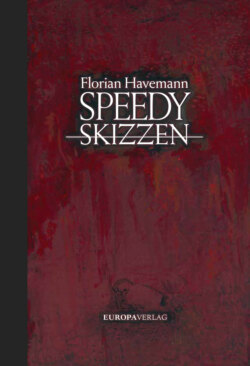Читать книгу Speedy – Skizzen - Florian Havemann - Страница 57
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 53: Weiter im Text
ОглавлениеIch hatte den Wecker ja neben mir auf dem Nachttisch stehen, deshalb erinnere ich mich so gut an die Uhrzeit: es war 10 vor 7 in der Früh, als mir erst einfiel, und das, nachdem ich mich fast zwei Stunden mit der Schreckensvision eines Sieges der Linken über Hitler und damit auch über mich abgegeben hatte, daß ich ja mittels des Radios eine Verbindung zur Außenwelt besaß – das Radio, es gehört so sehr Speedy, es wird von Speedy allein an- und auch wieder ausgeschaltet, daß das wirklich so lange dauerte, bis ich darauf kam. Aber wenn es nicht grad diese Schreckensvision gewesen wäre eines Sieges meiner ehemaligen Genossen, auf die ich in meiner politischen Einfalt verfiel, wenn ich dem Nazi, der mir doch mit der Kanzlerschaft ihres Herrn Hitler saturiert erscheinen wollte und vorerst in seinen Ambitionen befriedigt, da noch einen Coup zugetraut hätte, seine Macht zu zementieren oder total zu machen, ich, auch ich wäre wohl früher schon auf das Radio gekommen, denn immerhin, und das wäre ja zu assoziieren gewesen, hatte doch Speedy, und mein Ausgangspunkt war ja Speedy und welche eigentlichen Gründe sie denn haben mochte für ihre Aufträge an mich, über das Radio, ihr Radio, auch von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler erfahren – diese Verbindung, Gedankenverbindung wäre doch leicht zu ziehen gewesen, aber ich bin ja wohl dumm und manchmal wirklich schwer von Kapee. Doch diese Verzögerung, diese Langsamkeit meines Denkapparats, sie hatte insofern etwas Gutes, als ich ja bei meinem Erwachen zwei Stunden vorher wohl vergeblich den Radioapparat eingeschaltet hätte – aber was weiß einer wie ich, der nicht arbeiten und also nicht in der Früh aufstehen muß, wann in Deutschland am Morgen das Radioprogramm beginnt. Ich weiß es nicht, und womöglich hätte ich mir die fast zwei Stunden wüster Spekulationen, geplagt von dieser Schreckensvision, ersparen können – von dieser jedenfalls. Der eines dann doch linken Triumphes.
Ich hatte noch zehn Minuten bis zu den 7-Uhr-Nachrichten, aber ich stand sofort auf und warf mir Speedys Morgenmantel über, ging hinunter in die Küche, wo sie das Radio stehen hat, und schaltete den Apparat ein, schaltete mich direkt in eine dort grad laufende Direktübertragung ein, in eine Reportage vom brennenden Reichstag – im ersten Moment verstand ich natürlich nicht, worum es ging, aber das wurde dann doch sehr schnell klar, daß der Reichstag brannte, immer noch brannte, lichterloh brannte und am Vorabend angezündet worden war. Von wem? Daran gab es dem Reporter zufolge keinen Zweifel: von den Kommunisten, und die Rede war auch davon schon zu diesem Zeitpunkt, daß ein holländischer Kommunist Namens Marius van der Lubbe verhaftet worden und der Brandstiftung bereits überführt sei – ein Holländer? Das war merkwürdig. Ein Kommunist, das war weniger merkwürdig. Jedenfalls daß die Nazis dies behaupteten, es wäre ein Kommunist gewesen. Ein Holländer, so dachte ich, so vermutete ich sofort dann, vielleicht deswegen, damit die Internationale schuld ist, wegen der Komintern, und weil das jedem anständigen Deutschen ja geläufig war, die Rede von den vaterlandslosen Gesellen. Gleich Kommunisten. Gleich Sozialdemokraten erst, gleich Kommunisten nun. Ein Holländer hatte den Reichstag angezündet, ein Kommunist, ein Einzeltäter, ein einzelner, wahrscheinlich durchgeknallter Kommunist, und im ersten Moment, ich gebe es zu, war ich beruhigt: kein Aufstand der Arbeiterparteien, die Revolution war doch nicht ausgebrochen. Im nächsten Moment aber hielt ich’s für möglich, daß genau dies, den Reichstag anzuzünden, als Fanal gedacht sein könnte, als das Zeichen an alle Unterorganisationen der Kommunistischen Partei und vielleicht sogar beider Arbeiterparteien, mit dem Aufstand zu beginnen. Und das bedeutete dann immer noch oder wieder, daß es einen Bürgerkrieg geben würde. Und also kam die Panik zurück, die Schreckensvision, und ich blieb ein Anhänger des Führers, blieb es, bis ich die Nachrichten hörte, und die Nachrichten vermeldeten dann nichts, was auf einen solchen Aufstand hingewiesen hätte. Meine Schlußfolgerung, die sicher die Schlußfolgerung vieler in Deutschland war: die Nazis werden den Reichstag selber angesteckt haben, werden ihn angesteckt haben, um dadurch einen Vorwand zu bekommen, ihrerseits gegen die Linke losschlagen zu können. Und, wenn nicht, wenn sie nicht selber die Brandstifter waren, sondern wirklich dieser eine durchgedrehte Holländer-Kommunist, dann würden sie dies auszunutzen wissen, um genau das zu tun: gegen die Linke losschlagen, den Vernichtungsschlag gegen alles, was irgendwie links ist, führen – gegen alles, und damit war sie wieder da, die Angst vom 30. Januar, die Angst, auch ich könne bei ihnen auf einer Liste stehen – neuerliche Panikattacke. Diesmal aber eine andere. Panische Angst vor den Nazis. Herzrasen. Angstschweiß. Mir zitterten die Hände, zitterten die Knie.
Und dann sofort auch der Gedanke daran, daß auch Speedy dies wohl für möglich gehalten haben muß, daß ich auf einer solchen Liste stehe, einer Todesliste der Nazis. Das war die Erklärung für ihren abendlichen Anruf, und es paßte zeitlich genau zusammen, das war die Bestätigung meiner Ahnung: es hatte für Speedy andere Gründe gegeben, die sie dazu veranlaßt hatten, mich, genauso wie am 30. Januar, mit meiner Verweiblichung zu beschäftigen, und klar war nun auch, warum dies nicht bis zum nächsten Tag warten konnte: sie wollte mich vom Radio fernhalten. Mich in Sicherheit wiegen. Und auch das ging nun auf, das mit dem Namen und nicht allein nur dem weiblichen Vornamen, und warum sie da von behelligen gesprochen hatte: daß Speedy also meinte, meine Verkleidung als Frau würde mich schützen, wenn der Nazi nach diesem Schlechter sucht, und in dem Moment, wo mir dies alles klar wurde, erschien es mir genial, und ich dankte meinem Schutzengel Speedy. Deshalb auch, daß sie mir eingeschärft hatte, ich solle mich als Freundin von Frau Schlechter ausgeben. Im nächsten Moment fand ich’s dann sehr viel weniger genial und die Vorstellung geradezu absurd, daß mich die Verkleidung in eine Frau vor einem in unser Haus eindringenden Rollkommando der SA hätte schützen können – lächerlich bei einer Bande, einer Terrorgruppe, die doch sicher auf Krawall aus wäre und schon andere Ausflüchte gehört haben dürfte. Und was hätte ich auf die Frage antworten sollen, wo sich denn das Ehepaar Schlechter befinde und was ich hier allein in ihrem Haus wolle? Und wenn sie nach meinem Ausweis fragen würden? Und natürlich würden sie das. Sind ja Deutsche. Und Männer. Männer in Aktion, Männer, die sich nicht bremsen lassen wollen. Die sicher wütend reagieren würden, fänden sie den gesuchten Schlechter nicht, wäre er ihnen durch die Lappen gegangen. Männer, die eine arme Victoria de Fries dann bedrängen würden, die mir nahe, vielleicht zu nahe kommen würden, die mir garantiert zu nahe kommen würden und, trotz Puder und Schminke, den Mann in mir sehen müßten. Und dann noch einmal mehr wütend reagieren würden – eine neuerliche Schreckensvision: wie ein solches Rollkommando der SA hier bei mir eindringt und sich nicht von meiner weiblichen Gestalt täuschen läßt, wie ich bloßgestellt werde, wie ich dann von diesen rohen Gesellen erst einmal vergewaltigt werde. Dieses Gerücht gab es doch schon damals, das wurde doch nicht erst mit dem Röhm-Putsch anderthalb Jahre später spruchreif: die SA, das wäre eine Bande von Schwulen.
Was tun? Um mal mit dem einstmals bewunderten Lenin zu fragen. Was also tun? In den Wald? Mich in den Wald flüchten, im Wald verstecken? Ja. Aber als Frau. Als Frau im Wald auf Speedys Rückkehr warten. Im Gebüsch, im Unterholz, in der Nähe der Bushaltestelle. Aus dem Haus flüchten, dem Haus fernbleiben, wo sie mich sonst finden würden. Leicht finden würden. Der Keller, das wäre kein Versteck. Kein Versteck, in dem sie mich nicht leichtestens finden würden. Auf die Gefahr hin, daß sie alles kurz und klein schlagen, sollten sie kommen und mich nicht, das Haus leer finden. Mich im Atelier dann auch nicht finden. Aus Wut, rasender Wut. Auf die Gefahr hin, meine Bilder zu verlieren, mein Werk dann nur noch zerstört, zertrampelt und zerrissen wiederzufinden, wenn ihre Wut verraucht ist. Oder angezündet. Brandstifter. Leute, die einen Reichstag anzünden, stecken auch ein Maleratelier in Brand. Möglich aber, daß nichts passiert. Daß ich verschont bleibe. Daß ich gar nicht in Gefahr schwebe. Die Unmöglichkeit, diese Gefahr in ihrer Gefährlichkeit abschätzen zu können. Das bedeutet Gefahr. Mit der Gefahr umgehen, mit der Gefahr leben lernen. Nicht mehr blind sein, wach sein. Sehenden Auges. Der Ausnahmemoment. Der Ausnahmezustand, und die Macht hat, wer den Ausnahmezustand erklären kann. Und noch mehr Macht hat, wer den Ausnahmezustand herbeiführen kann, ohne ihn erst erklären zu müssen. Das verdanken wir Adolf Hitler, daß er uns aufgeweckt hat, wach gemacht hat, den Ausnahmemoment gelehrt hat des trägen Lebens. Deutschland, erwache – jetzt verstehen wir erst, was damit gemeint war. Kampf gegen die Gewohnheit. Kampf der Gewöhnung, und nicht umsonst geht es dabei um die Wohnung. Die Privatsphäre. Die eigenen vier Wände. Die Unverletzlichkeit des Wohnraums, und wenn die nicht mehr garantiert ist, dann endet die bürgerliche Gesellschaft. Wenn sie einfach so in deine Wohnung eindringen können, in dein Haus, dein Leben also, ohne Haft- oder Durchsuchungsbefehl, dann gehört ihnen die Macht. Es gibt keinen Schutz mehr. Freiheit nur im Vergleich mit der Unfreiheit der Gefängniszelle. Leben nur noch in Beziehung zum immer möglichen Todesurteil. Das Todesurteil nur noch im Unterschied dazu, daß sie kommen und dich einfach umbringen. Auf der Flucht erschossen, wenn sie dir befehlen, vor ihnen herzugehen. Totgeschlagen, wenn du bei ihnen die Kellertreppe runterstolperst. Dann hast du sie anfallen wollen und hättest es besser getan. Es kommt nur darauf an, daß du den Moment erwischst, wo du dich ihnen entgegenwirfst, um nicht wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden zu sein.
Nachdem die Entscheidung gefallen war: fieberhafte Aktivität, mich als Frau einzukleiden, als Frau zurechtzumachen – ganz anders als erhofft. Ohne es genießen zu können, es erregend finden zu können. Unter höchstem Zeitdruck, immer mit der Furcht im Hinterkopf, gleich könne es an der Haustür klingeln, jeden Moment könnten sie mit ihren Schaftstiefeln gegen die Tür treten, sie eintreten, hier bei mir eindringen. Keine Zeit, mir etwas hübsch Frauliches zusammenzustellen, das zu mir paßt, meinem Typ als Frau entsprechend, dem Typ, der ich als Frau wäre. Die Unterwäsche, wie schon gewohnt hautfarben, Rock und Bluse aber dunkel. Ein Kleid, in das ich hineingepaßt hätte, ließ sich nicht finden. Dafür aber wenigstens eine taillierte Jacke, die mir den Pullover ersetzen sollte, den ich im Winter doch immer trage, die ihn mir dann auch halbwegs ersetzte. Zum Glück schien der Mantel, den sich Speedy drei Jahre zuvor gekauft hatte und der ihr nun nicht mehr modisch genug war, richtig warm zu sein, und er war es dann auch, ohne ihn wäre ich garantiert im Wald zu einem Eiszapfen erstarrt. Gut war auch der Schal, der alte Kaschmirschal von Speedy, der, den sie in dem Winter getragen hatte, in dem wir uns kennenlernten. 1927. Ein paar Mottenlöcher, die mich aber nicht stören durften. Und auch nicht störten. Und dann galt es, einen Hut zu finden, und die Auswahl war groß, Speedy liebt Hüte. Einen Hut, den ich mir tief genug ins Gesicht ziehen konnte, einen Hut gegen den kalten Wind. Der, den ich kurz entschlossen wählte, gab mir etwas Damenhaftes. Und dann Puder, viel Puder, Schminke ins Gesicht, die Lippen rot, den Schimmer meines Bartes zu verdecken, mich als Mann unkenntlich zu machen. Ich saß schon mit Mantel und Hut vor dem Spiegel, während ich mich schminkte und dabei zur Ruhe zwingen mußte. Die Füße in Speedys Pantoffeln. Nach Schuhen, die mir passen könnten, war gar nicht erst zu suchen. Keine Chance. Keine Zeit zu verlieren. Ich zog mir die meiner Schuhe an, die nicht ganz so klobig und damit männlich wirkten und die für einen winterlichen Ausflug und Spaziergang im Wald auch bei einer Frau akzeptabel wirken konnten – nahe kommen durfte mir sowieso kein Mensch. Einen Moment stand ich unentschlossen mitten im Raum, ich wußte, daß mir etwas fehlt, fehlen würde, wußte aber nicht, was. Dann fiel es mir ein, daß ich unbedingt eine Uhr brauchen würde, wenn ich Speedy an der Bushaltestelle abpassen wollte. Als Künstler aber, der keine Termine hat, der nirgendwo pünktlich bei einer Arbeit antanzen muß, besitze ich doch so etwas nicht wie eine Armbanduhr. Also steckte ich mir kurz entschlossen den großen Wecker in die Manteltasche. Dann ein letzter Blick ins Schlafzimmer: es sah aus, als wäre es in größter Eile verlassen worden, fluchtartig. Mir war es egal. Und es war vielleicht sogar besser so, wenn es nach Flucht aussah. Sie wüßten dann, daß sie zu spät gekommen sind. Vergeblich.
In der Küche fand sich ein Stück Brot, es wanderte in die andere Manteltasche. Es war kurz vor acht, und das erste war also geschafft. Der Nazi schlief noch, oder er interessierte sich nicht für mich. Aber er konnte jeden Moment bei mir aufkreuzen. Die Petzseestraße ist lang, lang genug, daß ich ihn von ferne hätte kommen sehen können, um ihm dann noch im letzten Moment vielleicht zu entwischen. Die Schwierigkeit war nun die, das Haus zu verlassen, ohne dabei von einem der Nachbarn beobachtet zu werden – ein gefährlicher Moment, der gefährlichste überhaupt. Aber ich hatte Glück, zumindest die Straße war menschenleer, und es war auch noch nicht ganz Tag um diese Zeit, im Winter nicht. Doch es war auf alle Fälle besser, mich nicht nach den Nachbarhäusern umzusehen. Ich wählte den kürzesten Weg zum Wald, niemand begegnete mir. Auch das war geschafft. Ich war im Wald, in Sicherheit, aber natürlich gab es überhaupt keinen Grund, der diese Frau, diese Dame, als die ich einem Beobachter erscheinen mußte, zu dieser Jahreszeit veranlassen könnte, in den Wald zu gehen, bei Kälte und Schnee. Und so früh am Morgen. Es gab aber wohl andererseits auch nichts, was man als verdächtigen Grund dafür hätte finden können, was diese Dame wohl in Schnee und Kälte und so früh am Morgen in den winterlichen Wald trieb. Das beruhigte mich. Etwas. Aber diese Ruhe, sie hielt nicht lange vor. Denn Speedy kam nicht mit dem Bus 8 Uhr 34, er hielt noch nicht einmal an, fuhr einfach weiter. Und Speedy stieg auch nicht aus dem Bus eine Stunde später aus, der zwar anhielt, was mir natürlich Hoffnungen machte, Hoffnungen, die dann enttäuscht wurden. Frau Krüger vom Haus am Ende unserer Straße stieg aus, ich sah sie von meinem Beobachtungsposten im Gebüsch auf der andern Seite der Chaussee aus durch den Schnee stapfen, heimwärts ins Warme. In die gute Stube an den Ofen, und mir, mir kroch die Kälte die Beine hoch, die Seidenstrümpfe entlang und immer höher bis zu dem Streifen nackter Haut, der von den Strapsen allein nur überbrückt wird. Die nicht wärmen. Was Frauen so aushalten müssen, Frauen aushalten – erstaunlich. Ich hätte mir wenigstens einen von Speedys Unterröcken anziehen sollen, nicht nur dieses Hemdchen, das so wenig wärmte, und die Kälte dann, sie ließ mein Schwänzchen zusammenschrumpfen, zu einem veritablen Nichts zusammenschrumpeln, die Kälte beraubte mich des bißchens an Männlichkeit, das ich noch besaß, und unter anderen Umständen hätte mir das vielleicht sogar gefallen. So aber, so kalt aber und der Kälte geschuldet, nicht. Und dann kroch sie noch höher, die verdammte Kälte. Richtige Hosen, Männerhosen sind wahrlich besser im Winter, an einem 28. Februar. So häßlich Männerhosen sind. Als wehte mir da fortwährend eine Zugluft um den Hintern, so kam es mir vor, als suchte sich der eiseskalte Wind den Weg direkt bis zu meinem Po – diese Frau da im Gebüsch, sie war frigide, haha, ihr Hintern, auf den es bei ihr so entscheidend ankam, frigide und gefühlskalt. Zu diesem öden Witz war ich noch fähig, wenigstens das. Mit andern Worten und mehr berlinerisch ausgedrückt: ich fror mir fast den Arsch ab, und ich stapfte durch den Schnee wie ein Soldat beim Wacheschieben – nein, erotisch war das nicht, das Frauendasein in diesen kalten Stunden, wirklich nicht.
Und dann der Ärger, der natürlich kommen mußte, der unvermeidlich war, daß Speedy nicht gleich den ersten Bus genommen hatte und auch den zweiten nicht, und dann plötzlich der Gedanke, ich könne ihr damit unrecht tun, der furchtbare Gedanke, Speedy könnte als meine Frau in Berlin hopsgenommen worden sein. Oder bei einer Razzia erwischt, wo sie dann in ihrer Fahndungsliste nachsehen und dort den Namen Schlechter stehen haben, der auch Speedys Name ist – unwahrscheinlich natürlich, und dann hatte Speedy ja auch noch ihren Schweizer Paß mit ihrem Mädchennamen Elisabeth Koehler, und kaltblütig, wie sie doch ist in den Momenten höchster Anspannung, hätte sie den rausgeholt und so getan, als hätte sie ihre Aufenthaltserlaubnis vergessen, auf der der Name Schlechter steht. Unwahrscheinlich also, aber eben nicht ganz auszuschließen, daß Speedy irgend etwas passiert sein könnte, ein Mißgeschick, etwas, das sie hindert, zu mir zu kommen, und das bedeutete für mich, vollkommen aufgeschmissen zu sein.
Das hätte es bedeutet. Wie sehr ich mich auf sie fixiert hatte, als meine Retterin fixiert hatte, wie unfähig ich war, mir selber zu helfen in der Not, mir wurde es erst dann wirklich klar. Ich hätte nicht gewußt, wohin. Oder noch unwahrscheinlicher: Masseck, der feige Opportunist, hat bei den Polypen Bescheid gesagt, oder gleich bei der SA, daß die Frau von diesem Schlechter bei ihm in der Wohnung hockt und über sie sicher auch an ihren Mann heranzukommen wäre – unwahrscheinlich und ein Gedanke, der Masseck unrecht tat. So war Masseck nicht. Masseck liebte Speedy. Und wahrscheinlich war es genau das, was Speedy abhielt, sich so früh wie nur möglich auf den weiten Weg nach Grünheide Alt-Buchhorst und zu mir zu machen, weil sie sich am Morgen noch einmal lieben wollten, die beiden – böse Ahnung, eine Unterstellung natürlich, aber nicht auszuschließen. Speedy durchaus zuzutrauen.
Endlich dann um 11 Uhr 34, ich war wieder zur Stelle, nachdem ich mir verzweifelt im Wald die kalten Füße vertreten hatte, entstieg die verzweifelt erwartete Speedy dem Bus. Ich beobachtete es von meinem schon gewohnten Beobachtungsposten im Gebüsch der Bushaltestelle gegenüber aus und wartete dann ab, ob sie denn auch allein aus dem Bus kommt, was der Fall war, um sie dann ansprechen zu können – ich hätte ihr hinterherrufen können, wollte dies jedoch nicht, aus der Furcht heraus natürlich nicht, dadurch die Aufmerksamkeit der Dorfbevölkerung auf uns zu lenken. Ich folgte ihr also durch das kleine Waldstück, durch das dieser schmale Weg von der Bushaltestelle dann zu unserer Petzseestraße führt. Speedy hatte ganz schön einen Schritt drauf, und ich kam ihr nur mit Mühe hinterher – sie hatte es also eilig, nach Hause zu kommen, zu mir, sie hatte vielleicht sogar ein bißchen ein schlechtes Gewissen mir gegenüber, so spät erst zu kommen. Der Schnee schluckte meine Schritte, es war unheimlich still, während ich ihr folgte, sie verfolgte, und als ich’s dann geschafft hatte, nah genug bei ihr hintendran zu sein, sprach ich sie an, von hinten an: »Guten Tag, Frau Schlechter.« Ich nannte sie Frau Schlechter, ich weiß gar nicht, warum und was mich auf diese Idee brachte – ein plötzlicher Einfall, denn natürlich hätte ich sie von der Situation her ebenso gut auch mit Speedy ansprechen können und vielleicht besser sollen, denn natürlich hatte sie mit mir erst in unserm Haus gerechnet und zuckte also erschreckt zusammen. Was ich so gar nicht gewollt, nicht beabsichtigt hatte. Was aber doch wohl signifikant war, bezeichnend für die Zeiten, die nun in Deutschland angebrochen waren, und für mich auch nicht ohne Bedeutung, bedeutete doch dieser Schreck, der sie zusammenfahren ließ, daß auch sie sich in Gefahr wähnte, daß sie wahrscheinlich befürchtete, es könne dies nur jemand von der SA sein, der sie anspricht, der sie anspricht, um sie zu verhaften – sie war so lieb, mir dies später so zu bestätigen, so offen, obwohl es doch all dem widersprach, was sie mir gegenüber dann sehr bald, sehr deutlich als wahrscheinlich beziehungsweise unwahrscheinlich hinstellte: daß uns beziehungsweise, daß mir und damit uns in dieser angespannten politischen Situation Gefahr drohe. Sie habe es aber, so sagte sie mir, im nächsten Moment auch schon für möglich gehalten, es könnte ein Dorfbewohner sein, einer von unsern Nachbarn, der sie so anspricht, der sie anspricht, um sie davor zu warnen, ihr beziehungsweise unser Haus zu betreten, ihm besser gar nicht zu nahe zu kommen, weil dort die SA schon auf sie warte, die mich längst abtransportiert habe – ist sie nicht nett, die nette Schweizerin, die die Deutschen wohl immer noch nicht kennt? Das Denunziantenpack. Leute, die erst glücklich und staatsbürgerlich mit sich zufrieden sind, wenn sie jemand anderen angeschwärzt, der Polizei ans Messer geliefert haben. Aber das wird sie ja nun jetzt endlich doch kapiert haben, was von den Deutschen zu halten ist, nachdem sie mich, ihren Mann, wegen seiner unnationalsozialistischen Lebensweise angezeigt haben.
Speedy drehte sich um, sie sah mich an, sah mir ins Gesicht, stutzte für einen Moment, dann aber erkannte sie mich doch in meiner Verkleidung. Den Mann in der Frau, die ihr da gegenüberstand im Schnee. Und das brachte Speedy zum Lachen, und es war sicher gut, daß sie lachte und mich doch nicht auslachte, wie ich’s befürchtet hatte, die Frau in ihrer ganzen Unbeholfenheit, die ich sein wollte, die ich vorgab zu sein. Und dann begrüßte sie mich, streckte sie mir ihre schmale Hand entgegen und sagte den Satz, ganz feierlich und ernst: »Auch ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Frau de Fries – das ist doch Ihr Name, Victoria de Fries?« Und da, da erst machte es bei mir Klick, und diese fatale Gedankenverbindung stellte sich her, die zwischen Victoria de Fries und Marius van der Lubbe, dessen Name doch im Radio genannt worden war, als der des Hauptverdächtigen, des eigentlich schon überführten Brandstifters: zwei holländische Namen, und wenn Speedy geglaubt hatte, ihren Schlechter besser nicht nur als Frau zu tarnen, sondern dazu auch noch mit diesem Namen Victoria de Fries zu schützen, dann hätte das ebenso gut beziehungsweise schlecht nach hinten losgehen und mich als Holländerin verdächtig machen können, als Gehilfin des schon geschaßten Holländers Marius van der Lubbe. Natürlich war es falsch und in dieser Situation unseres glücklichen Wiedersehens ganz und gar falsch, ihr damit als erstes zu kommen, mit den beiden Holländern, der zwischen ihnen von einem Polizeigehirn zu ziehenden Verbindung, und Speedy hatte natürlich vollkommen recht, und das mußte doch auch einsehbar für mich sein und war es doch auch, daß es sich dabei um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelte und um mehr nicht, daß ihr, als sie mich am Abend zuvor von Masseck aus angerufen hatte, ausgerechnet diese holländisch klingende Victoria de Fries eingefallen war und nicht irgendeine Renate Schmidt Meier Müller Schulze – dieser Marius van der Lubbe, er war doch zu diesem frühen Zeitpunkt noch gar nicht gefaßt, das geschah doch erst eine halbe Stunde später, und in Deutschland kommt es mittlerweile auf jede halbe Stunde an, so rasch ändern sich manchmal die Verhältnisse. Aber es war mir eben doch eingefallen, es war so frisch und so beängstigend in meiner Angst, es mußte einfach heraus und gesagt werden, das mit den Holländern, der holländischen Gefahr – doch natürlich trug es nicht dazu bei, das Ehepaar Schlechter in dieser Situation zusammenzubringen, natürlich trübte es die Wiedersehensfreude sehr. Aber ich bin ja dumm. Dumm und psychologisch ungeschickt. Und also Mann. Also auch dann Mann, wenn ich Frauenkleider trage.
Speedy stapfte entschlossen durch den Schnee Richtung heimwärts, und mir blieb nur, mit ihr Schritt zu halten zu versuchen und dabei, für den unwahrscheinlichen Fall, es beobachte uns jemand, nicht ganz undamenhaft auszusehen – bemerkenswerterweise stellte sie mir die Frage nicht: was ich denn im Wald gemacht hätte, ich hätte sie doch im Haus erwarten sollen. Mein Verhalten war also so ganz unverständlich nicht für Speedy. Was ich aber nicht verstand, war, warum Speedy unbedingt zum Haus zurückwollte, zu unserem Haus, wo doch die Gefahr für uns schon auf der Lauer liegen konnte – wenigstens hätten wir doch mal beraten können, die Situation, und was wir nun am besten unternehmen, aber sie ließ sich von mir nicht aufhalten, zu unserem Haus zu wollen, da halfen alle meine Versuche nicht, mit ihr da auf unserem Weg schon ins Gespräch zu kommen. Daß wir zu Hause in Ruhe darüber reden würden, das war’s, was sie mehrmals wiederholte und mit dem sie alle meine Befürchtungen abtat, das war die Bemerkung, die Nacht und damit das Schlimmste wäre sicher vorüber, wo sie doch den Brandstifter schon hätten, meinen Marius van der Lubbe – einer der wenigen Punkte, in denen sie sich irren sollte, denn dieser eine Marius van der Lubbe reichte ihnen doch nicht, sie wollten die Situation doch nutzen, ein paar Kommunisten mehr ranzukriegen als diesen verrückten Holländer, von dem sie vielleicht da schon wußten, daß er bloß ein fehlgeleiteter Einzelgänger war, mit dem sich keine richtige Verschwörungstheorie basteln ließ. Brecht zum Beispiel, so habe ich gehört, Brecht entging seiner geplanten Verhaftung, Verschleppung durch die SA erst an diesem Tage, am Tage danach, nach dieser Nacht erst des Reichstagsbrandes. Hat mir Franz Jung so erzählt. Jahre später.
Von wegen: in Ruhe darüber reden – wir gingen sofort aufeinander los, nachdem wir uns unerkannt, von niemandem dabei gesehen ins Haus eingeschlichen hatten, in unser Haus, und Speedy, Speedy war da einfach schnurstracks die Petzseestraße langmarschiert, ohne nach links und rechts zu schauen, und mir zitterten die Knie, ich sah den Nazi aus jeder Garteneinfahrt herauskommen, hinter jeder Hecke auch hervorstürmen, aber niemand behelligte uns, und wohl weil wir so unbeschadet ins Haus gelangt waren und auch dort uns nicht eine ihre Gummiknüppel, ihre Totschläger schwingende Meute in Empfang genommen hatte, entlud sie sich so eruptiv, die Spannung in jedem von uns, die Spannung zwischen uns. Speedy fing ganz harmlos an, als wäre das die Zeit, wo man sich mal so philosophisch distanziert über das Weltgeschehen austauschen könnte. Wie oft habe man sich doch gewünscht, sagte sie, es käme jemand und mache diese überflüssige Quatschbude einfach zu, fackele sie von ihr aus auch ab, nun aber, wo der Reichstag brennt, das meine auch Masseck, könne man sich diese Verachtung der Demokratie gar nicht mehr leisten, falle sie auf einen selber zurück. Auch eine schlechte Demokratie, so habe Masseck gesagt, ein Parlament, das sich nur durchwurstelt, erscheine mit einemmal besser als die Diktatur der Nazis und deren rigide Ordnungsvorstellungen – was Masseck so sagt, wenn die Nacht lang wird und auch er ja nicht die ganze Zeit Liebe machen kann. Der Reichstagsbrand, das sei das Menetekel, das Zeichen an der Wand, so Speedy, so wahrscheinlich Masseck. Die Abschaffung der ganzen parlamentarischen Demokratie, das sei doch immer das eigentliche Ziel der Nazis gewesen, dieses Ziel auf parlamentarischem Weg zu erreichen, nur ein Trick – so wiederum wahrscheinlich Masseck. Der Reichstagsbrand, das sei jetzt das Symbol dafür – ich wäre nicht so gut mit Symbolen, sagte ich zu Speedy, ich sei ein realistischer Künstler, ein Nachahmer der Wirklichkeit, und Speedy erwiderte, im Unterschied zu mir aber verstünden sich die Nazis auf Symbole. Womit sie sicher recht hat, und auch mir war doch dann sehr rasch der Gedanke gekommen, es müßten die Nazis selber gewesen sein, die den Reichstag angezündet haben, und zwar genau als Symbol für die von ihnen beabsichtigte Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, aber wo Masseck das nun so meinte, wollte ich’s nicht mehr meinen und auch andere Möglichkeiten gelten lassen, dieser Holländer zum Beispiel, der Marius van der Lubbe – was, wenn er’s wirklich war, selber und ganz allein gewesen ist? Das habe Masseck sofort ausgeschlossen, daß das ein einzelner Mensch, ein Einzeltäter überhaupt schaffen könne, ein so großes Gebäude in Brand zu setzen, und Masseck habe es ja mit eigenen Augen gesehen, wie das Feuer aus mehreren Ecken des Reichstages herausschlug – Masseck, der Brandsachverständige. Das mit dem Brandsachverständigen Masseck, das hätte ich sicher lieber nicht sagen sollen, denn das ärgerte Speedy, und sie giftete zurück: immerhin hätte Masseck garantiert ein paar Brände mehr gesehen als ich, als wir beide zusammen, er sei ja schließlich Lokalreporter – seit knapp einem Monat. Der Hinweis lag mir auf der Zunge, ich verbiß ihn mir dann aber doch. Masseck, so Speedy, sei sich jedenfalls sicher, daß nur die Nazis selber die Brandstifter sein könnten, er habe sich, als er spät in der Nacht von seinem Ortstermin Reichstagsbrand zu Speedy zurückgekehrt sei, nur darüber lustig gemacht, daß die Nazis so rasch einen arbeitslosen holländischen Kommunisten als Brandstifter präsentiert hätten – immer wieder Masseck und wie recht Masseck habe, das ärgerte mich natürlich und weckte meinen Widerstandsgeist, und sei es nur, weil ich mit Masseck partout nicht einer gleichen Meinung sein wollte, sah ich das alles natürlich ganz anders und beharrte darauf, daß das mit dem Reichstagsbrand sehr wohl ein Einzeltäter gewesen sein könne und genau dieser dann, den uns die Nazis vor die Nase setzten, die noch vom Brandgeruch gereizt ist, genau der passende für einen solchen Irrsinn: ein arbeitsloser Kommunist, ein Holländer, der auf eigene Kappe losgeht, ohne den Auftrag seiner Partei, der Kominternzentrale – ich würde doch solche Leute besser kennen als sie und Masseck, ich hätte mit denen schließlich mal etwas näher zu tun gehabt. Auch bei den Kommunisten gebe es doch nicht nur Befehlsempfänger, glatte Funktionäre, die nur auf Anweisung von oben hin aktiv werden. Das Fußvolk habe schon seine eigenen Füße, gehe seine eigenen Wege, zu dirigieren wären die doch alle nicht von ihrer abgehobenen Parteiführung. Und außerdem, sagte ich, ich verstünde das schon, ein Fanal setzen zu wollen, sich dabei selber als Opfer darzubringen, die Verzweiflungstat, ich könne das sehr wohl nachzuvollziehen, auch als Protest gegen die vielen, die nicht merken, nicht wahrhaben wollen, was gespielt wird, die blind gegenüber den gravierenden Veränderungen bleiben, die sich vollziehen. Ich hätte sie doch kennengelernt, solche Leute in der Arbeiterschaft, die ihren eigenen Kopp haben, auf eigene Faust handeln und sich auch nicht von ihrer eigenen Partei disziplinieren lassen. Oben sei das Strategie und Taktik, unten meist die pure Verzweiflung. Ein explosives Gemisch aus Rebellion gegen die Verhältnisse und Unterordnung unter die Partei. Ich sagte Speedy, auch ich würde an eine kommunistische Verschwörung nicht glauben, die würde ich der Partei nämlich gar nicht zutrauen. Die KPD sei doch sicher vollkommen paralysiert, damit beschäftigt, sich diese Niederlage zu erklären, die ihnen der Nazi beigebracht hat. Sie wollen ja immer eine Theorie, diese Welterklärer. Das mag sein, sagte Speedy spitz, und auch Masseck meine ja, den Nazis wäre es eher zuzutrauen, daß sie den Reichstag selber angezündet haben, um das dann den Kommunisten in die Schuhe schieben zu können. »Wie originell«, sagte ich da, und das ärgerte Speedy. Und daß sie sich ärgerte, über mich ärgerte, das war nun überhaupt nicht gut und gar nicht das, was wir in dieser Situation brauchen konnten als Paar, als Ehepaar: daß wir wieder mal in der Einschätzung des politischen Geschehens nicht einig waren.
Aber es sollte noch schlimmer kommen, unsern Streit noch einmal mehr eskalieren und war doch wohl von Speedy ganz anders und gut gemeint, als Mittel grad, unsern Streit zu beenden – sie macht das ja oft so, daß sie abrupt das Thema wechselt und dann meint, das vorherige sei damit beendet. Vielleicht bin ich einfach nicht geistig beweglich genug, zu träge im Malerkopf, aber ich komme da meist nicht mit bei diesen raschen Wendungen, die mir so weiblich irrational erscheinen, zu emotional für einen Mann, der ich eben doch bin, so wenig nachvollziehbar. Ich bocke dann, und Speedy merkt’s nicht, insistiert nur immer mehr, und so auch an diesem Morgen, diesem späten Vormittag, als sie mich dann plötzlich aufforderte, ich solle doch endlich den Mantel ausziehen – ich hatte ihn noch an, diesen Mantel, ihren Mantel, und das nicht nur, weil ich vom Wald noch durchgefroren und es bei uns im Haus nicht warm war, wo ich doch vor meiner Flucht nicht erst noch geheizt, die Glut im Ofen angestochert, wieder angefacht hatte, sonst ja das erste mit, was ich tue. Ich hatte den Mantel noch an, weil wir da gleich, nachdem wir die Haustür hinter uns zugezogen hatten, in unsere leidige Diskussion geraten waren, den Streit, den Speedy nun beenden wollte, mit dem wohl untauglichsten Mittel. Mit dem einer Forderung an mich – nicht, daß sie etwa flötete: Zieh doch den Mantel aus, Schatz, nein, sie verlangte es geradezu von mir, in diesem Ton, den ich doch von ihr kenne, wenn sie unbedingt etwas will und dagegen dann kein Ankommen ist. Ich solle meinen Mantel ausziehen, endlich meinen Mantel ausziehen, sie wolle mich als Frau sehen – als Frau, das war der Themenwechsel, der von ihr angestrebte: vergessen wir den Reichstagsbrand in Berlin. Aber soweit war ich noch nicht, und also purzelte das aus mir heraus, was als Vorwurf gegen Speedy in mir war, das, worauf ich sie irgendwann andermal zu einer ruhigeren Stunde hatte ansprechen wollen. Ich sagte ihr, und ich weiß, daß ich dabei leicht hysterisch klang und mich dadurch schon mal ins Unrecht setzte, daß sie mich durch ihre großartige Idee gestern abend, ich solle mich als Frau zurechtmachen, solle sogar in ihrem Nachthemd schlafen, in eine Lage gebracht habe, wo ich das Opfer einer Vergewaltigung hätte werden können – entweder verstand sie’s wirklich nicht oder sie tat nur so: wovon ich überhaupt reden würde, wer mich denn hätte vergewaltigen können, vergewaltigen wollen? Ich sagte ihr, und ich weiß, mein Ton war furchtbar rechthaberisch dabei: sie habe mir doch diese ganze Sache mit meiner Verweiblichung gestern abend und dann auch noch das mit dem Namen Victoria de Fries nur deshalb suggeriert, ja, zur Aufgabe gemacht, weil auch sie es für möglich gehalten habe, daß ich hier von den Nazis verhaftet werden könnte – Speedy nickte, Speedy nickte kalt, als ich das sagte, und ihr kurzer Kommentar war der, daß sie es nicht habe vollkommen ausschließen können. »Siehst du«, sagte ich, und sie erwiderte, sie sähe, daß ich total übergeschnappt sei, und daß ihre Idee, mich mit meiner derzeitigen Lieblingsbeschäftigung zu beschäftigen, ja wohl ganz weise gedacht gewesen sei, es habe mir schließlich über die Nacht geholfen, ohne da schon vollkommen durchzudrehen – das war zwar die Bestätigung für ihre von mir auch so angenommene Intention, aber es hielt mich nicht auf, konnte mich nicht aufhalten. Ich schrie fast, als ich sagte, sie solle sich doch bitte mal gefälligst vorstellen, wie so ein enthemmter SA-Trupp hier am Abend hereinstürmt oder in der Nacht, und ich liege in ihrem Nachthemd allein im Bett, eine einsame Frau, die behauptet, nicht zu wissen, wo der gesuchte Schlechter sei, wohin er ausgeflogen wäre – ob sie denn etwa meine, die wären dann mir nichts, dir nichts, mir höflich noch eine weiterhin gute und angenehme Nachtruhe wünschend wieder abgezogen? Sie hätten mich doch ausgefragt und in die Mangel genommen, und wenn sie sich vielleicht nicht auch gleich in ihrer männlich angestachelten Wut über mich, das einsame, schutzlose Weib, hergemacht hätten, spätestens dann, wenn sie mich in den Würgegriff genommen hätten, hätten sie’s doch bemerkt, was für ein merkwürdiges Frauchen das ist, das ihnen das Blaue vom Himmel herunter zu erzählen versucht. »Siehst du denn das nicht«, sagte ich schreiend, »ich hätte das Opfer einer Massenvergewaltigung werden können.«
Speedys Reaktion darauf: kalt distanziert, erstaunt mit dem Kopf schüttelnd: an was ich so alles denken würde. Und dann nach einer kurzen Pause: wahrscheinlich wünschte ich mir das, vergewaltigt zu werden, ja, vielleicht sogar sollte ich das mal, vergewaltigt werden, damit ich mich ganz und gar als Frau fühlen könne – das war der Höhepunkt, und wenn ich etwas auf den Tod nicht leiden kann, dann ist es diese billige Psychologisierung. Daß man das einfach umdreht, und plötzlich wird aus dem, was man befürchtet, ein Wunsch, ein natürlich verdrängter, ein unbewußter. Ich muß sie haßerfüllt angesehen haben. Nach Luft schnappend, und beinahe wäre ich explodiert, wäre ich vollkommen ausgerastet. Ich hörte es einen Moment wie hinter einem Schleier, das, was Speedy angesichts meiner Empörung noch obendraufsetzte: sie sehe sich durch diese massive Abwehr von mir in ihrer Vermutung bestätigt. Das ist der Trick, der leicht zu durchschauende Trick der Psychologen mit ihrer Verdrängung, das, wo sie dann immer recht behält, die blöde Psychologie. Ins Unterbewußte, da läßt sich doch alles hineininterpretieren, alles. Auch, daß ich nichts sehnlicher wünsche, als vergewaltigt zu werden, von einer Horde von SA-Männern, und auch wenn sich das hier vielleicht verrückt anhören mag: daß ich, der ich von keiner Nazi-Bande vergewaltigt werden will, diesen Nazis nun recht gebe, recht in ihrer Ablehnung des Doktor Siegmund Freud, der jetzt in London sitzt, im Exil, und den sie beim Einmarsch in Wien besser wohl vergewaltigt hätten, ihn oder seine vielleicht schmuckere Tochter, wenn er denn eine hat, zur Vaterschaft überhaupt fähig gewesen sein sollte, der alte Herr mit dem Krückstock zum Bohren im Unterbewußten – ich verstehe den Anschluß von Österreich, und ich verstehe, daß der Nazi die deutschen Universitäten von dieser Lehre gereinigt hat – daß die Psychoanalyse eine jüdische Wissenschaft sei, wie die Nazis behaupten, das allerdings ist in meinen Augen nur ein Vorwand. Darum geht es doch gar nicht. Sondern darum, daß da endlich mal ein paar Männer, in deren Unterbewußtes allerlei doch hineinzuinterpretieren wäre, aufgestanden sind und mit diesem ganzen Quatsch Schluß gemacht haben – bravo!
»Reg dich doch nicht so auf«, sagte Speedy und kam dabei auf mich zu. »War es denn schön, in meinem Nachthemd zu schlafen, in meinem Negligé?« fragte sie, und als ich nickte, fragte sie weiter: »Willst du auch so was leichtes Duftiges haben für die Nacht?« Ich nickte, und mir kamen die Tränen. Und dann knöpfte sie mir den Mantel auf, zog ihn mir von den Schultern, nahm den Mantel, legte ihn auf den Stuhl, drehte sich wieder um zu mir, betrachtete mich, lächelte mich an und sagte: »Du siehst doch ganz passabel aus als Frau.« Was mir fehle, das sei nur ein bißchen mehr an weiblicher Taille. Und dann kam sie zu mir, näherte sie sich mir, ihrem Mann, als wäre ich eine Frau und sie ein an dieser Frau sexuell interessierter Mann. Sie umfaßte mich, und ich spürte ganz deutlich, wie ihre Finger nach dem Verschluß des BHs suchten, den ich trug, zum ersten Mal trug und bei ihr ausgeborgt hatte. Sie drückte mich an sich, und unsere so verschiedenen Brüste berührten sich. Und dann küßte sie mich. Auf den Mund. Wohl um mich die Gefahr vergessen zu machen. Und ich ließ mich von ihr küssen und vergaß die Gefahr. Für einen Moment vergaß ich sie.
Aber eben nur für einen Moment, denn im nächsten schon teilte Speedy mir mit, daß sie mit mir in die Stadt wolle, nach Berlin zurückfahren wolle, und sofort packte mich die Angst, in Berlin in eine Razzia zu geraten, und ich sagte das Speedy auch, die aber sehr entschieden erwiderte, sie hätte keine Polizei auf der Straße gesehen, sie sei nirgendwo kontrolliert worden, auch am S-Bahnhof Erkner nicht, und dort in Berlin, in der großen, unübersichtlichen Stadt sei es auf alle Fälle doch sicherer für mich als hier bei uns im Haus, wo ich polizeilich gemeldet bin – wie wahr. Aber warum sie dann erst noch mit mir diese Gefahr eingegangen war, zu uns ins Haus zurückzukehren, ich verstand es nicht – jedenfalls nicht im ersten Moment, denn schließlich konnte ich ja wohl schlecht erst im Bus und dann in der S-Bahn als Frau fahren und als Frau durch die Berliner Straßen spazieren. Denn so perfekt als Frau war ich ja nun doch nicht. Sie habe ihren Plan schon fertig, ich solle ihr einfach folgen, nicht groß fragen – ich weiß nicht, ob Speedy damit glaubte mich von allem Fragen abhalten zu können oder ob es ihr reichte, damit dann diejenigen meiner Fragen abwürgen zu können, die ihr allzu sehr ins Detail gingen. Denn natürlich hatte ich Fragen, und ich stellte sie auch – außer die vielleicht wichtigste, die mir in dem Moment noch gar nicht einfiel, die Frage danach, seit wann denn sie mit ihrem Plan, mit mir nach Berlin zu fahren, fertig gewesen sei: in diesem Moment erst, wo sie mich als Frau vor sich hatte, oder schon vorher, als sie auf dem Weg war zu mir zurück. »Und was machen wir da in Berlin?« fragte ich sie. »Und wo bleiben wir die Nacht über?« Und während ich sie dies fragte, kroch die Furcht in mir hoch, Speedy würde antworten: bei Masseck – das wäre zwar nett von Masseck gewesen, uns Unterkunft, Unterschlupf auch zu gewähren, aber: wie hätte ich das ertragen sollen? Von diesem Mann abhängig zu sein, von seinem Wohlwollen, seiner Hilfe, und dann das miterleben zu müssen, daß sich Speedy doch auch in dieser Nacht nicht davon würde abhalten lassen, mit Masseck ins Bett zu gehen, und ich, ich schlafe auf dem Sofa, muß auf dem Sofa übernachten. Aber zum Glück, muß ich sagen, hatte Speedy das nun doch nicht vor – ob aus Rücksicht auf mich und meine Gefühle gegenüber Masseck und ihrer neu aufgewärmten Affaire mit ihm, wage ich aber zu bezweifeln. »Wir übernachten in einem Hotel«, antwortete sie, »und vorher gehen wir ganz normal einkaufen.« Das mit dem Hotel, das war schon mal gut, weil nicht Masseck – aber was wollte sie an diesem Tage kaufen? »Wir kaufen das, was du dir sicher schon lange wünschst.« So Speedy auf meine Frage – gut, wenn sie das normal einkaufen nannte, was das ja wohl nur bedeuten konnte, weniger gut die Szene, die ich sofort als Schreckensvision vor mir sah: wir beide in einem Dessous-, einem Miederwarengeschäft, und Speedy kommt auf den großartigen Einfall, ich solle das, was sie für mich ausgewählt hat, gleich mal anprobieren, ob’s mir denn passe. Ich schluckte, ich wischte es weg, verdrängte diese Aussicht als auch für Speedy zu gewagt und wußte in dem Moment doch noch nicht mal, ob sich Speedy nicht vielleicht sogar in den Kopf gesetzt hatte, ich solle als Frau mit ihr in die Stadt fahren, weil das nach ihrer Meinung sicherer sei – natürlich hätte ich da protestiert und Widerstand zu leisten versucht, wissend natürlich, daß alle Proteste nichts nützen, daß jeglicher Widerstand zwecklos wäre. Wenn Speedy sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann komme ich dagegen nicht an. Ich doch nicht.
Ob sie ein Nachthemd für mich meine, ein Negligé, fragte ich sie, und Speedy nickte, ja, ein Negligé und weil ich mich wohl so gerne in meinem an sie in dem ihren schmiegen würde des Nachts – was für betörende Aussichten. »Gut«, sagte Speedy, »du sollst dein eigenes Nachthemd haben.« Aber das war es nicht, woran sie für mich gedacht hatte, nicht das, wovon sie meinte, daß es schon lange mein Wunsch sein müsse, und sie sollte ja recht behalten, auch darin wieder mal, und das, obwohl ich in diesem Moment gar nicht darauf gekommen wäre. »Du sollst etwas bekommen, von dem ich glaube, daß du’s nötig hast, um weiblich etwas mehr in Form zu kommen.« So Speedy – und was konnte das sein? Natürlich das: ein Korsett. Und natürlich hatte mich dieser Gedanke schon gestreift, der Gedanke an ein Korsett für mich, und nicht allein nur, um mich weiblich mehr zu formen, mich in weibliche Form zu bringen, auch, weil so ein Korsett, weil ein bißchen altmodisch, so gut in die leider schon vergangene Zeit und Epoche des Knöpfschuhs hineingehörte, in meine Jugend, meine Knöpfschuh-Jugend und Korsett-Pubertät. Und damit hatte sie mich – zumindest wieder von der Gefahr abgelenkt und auf etwas anderes hin fixiert, und hätte sie in dem Moment dekretiert: du fährst als Frau, ich hätte es wohl gar nicht mehr versucht, meinem Schicksal zu entgehen. Aber sie verlangte es nicht, das jedenfalls nicht – ich solle mich schnell umziehen, damit wir loskämen und gleich noch den nächsten Bus in die Stadt schaffen würden. Ich zog das Kleid aus, während Speedy die Hose und das Hemd für mich holen ging, und als sie aus der oberen Etage zurückkam, fand sie mich in meinem weiblichen Darunter, meinen Dessous, und beschied mich damit, daß ich die gleich anbehalten könne unter meinen sonstigen Männersachen, und wenn ich ehrlich bin, dann gebe ich zu, daß ich, nachdem ich mir das Kleid ausgezogen hatte, extra etwas damit gezögert hatte, mich auch der schönen Wäsche des schönen Geschlechts zu entledigen, in der Hoffnung, sie möge genau dies von mir verlangen, und ich war natürlich sehr glücklich darüber, daß sie genau dies von mir nun verlangte. Die Wäsche, die weibliche, unter meinen Männersachen anzubehalten, und auch den BH, den ich mir bei ihr im Kleiderschrank ausgeborgt hatte, durfte ich anbehalten, Speedy hatte nichts dagegen einzuwenden, ja, sie lächelte mich aufmunternd an, als ich mir ihre alten Seidenstrümpfe aus den Körbchen ihres Büstenhalters holte, um sie mir dann in die Hosentasche zu stecken, denn vielleicht würde sich ja die Gelegenheit noch ergeben, sie dort wieder hineinzustopfen, um meine weiblichen Formen auch oben herum zu vervollständigen. Nicht, daß ich da irgendwelche konkreten Vorstellungen gehabt hätte, was für eine BH- und Ausstopf-Gelegenheit dies sein könnte. Sie hatte mich, das war’s, ich war schon gedanklich vollkommen in unserer bevorstehenden, gemeinsamen Unternehmung drin, und dann natürlich noch einmal mehr glücklich und überglücklich, als mich Speedy dann auch noch dafür lobte, daß ich auf die Idee gekommen sei, mir einen BH in ihrem Kleiderschrank zu suchen, um mit ihm meine Verweiblichung zu vervollkommnen, und wieder benutzte sie dabei das schöne Wort von der Perfektionierung. Ich sah Speedy Geld aus der Haushaltskasse holen, sah Speedy eine größere Summe in die Tasche stecken, während ich mich äußerlich und in den oberen Kleidungsschichten jedenfalls wieder in einen Mann zurückverwandelte. Fünf Minuten später verließen wir das Haus und waren pünktlich an der Bushaltestelle.