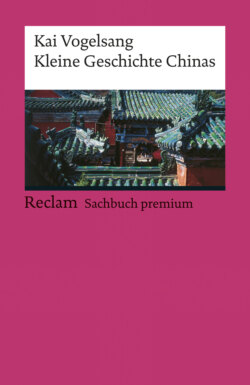Читать книгу Kleine Geschichte Chinas - Kai Vogelsang - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mohisten und Konfuzianer
ОглавлениеDer soziale Strukturwandel, vor allem der Aufstieg von unteren Schichten in Politik und Militär, ließ sich nur allzu leicht als Verfallserscheinung deuten. »Die Welt verfiel, und der rechte Weg ging verloren«, klagten Zeitgenossen, »Irrlehren und Gewalttaten kamen auf, Untertanen, die ihre Fürsten mordeten, und Söhne, die ihre Väter mordeten.« Die Zhanguo-Zeit [63]erscheint als verkommenes, verrohtes Zeitalter – und dennoch war sie ein klassisches Zeitalter; oder besser: gerade deshalb war sie klassisch. Klassische Zeitalter sind nie ruhig, und ruhige Zeitalter können nie klassisch werden. Erst die Rituelle Revolution und die sozialen Krisen der Chunqiu-Zeit machten die Kontingenz der sozialen Ordnung sichtbar und schufen Voraussetzungen für neue Ideen. Sie brachten eine Vielfalt anderer Möglichkeiten in den Blick, angesichts derer kein System mehr selbstverständliche Geltung beanspruchen konnte. Die Einheit der Welt war verloren, und »das Reich stürzte in großes Durcheinander«:
»die Weisen und Würdigen sahen nicht mehr klar, der Rechte Weg und die Tugend waren nicht mehr einheitlich. Viele im Reich erlangten einzelne Einsichten, in denen sie sich gefielen: wie Ohren, Augen, Nase und Mund erfassten sie alle etwas, konnten sich aber nicht miteinander verständigen. […] Wie traurig! Die Hundert Schulen gehen ihren Weg, ohne sich umzuwenden, und kommen gewiss nie mehr zusammen. Die unglücklichen Lernenden späterer Zeiten werden die Welt nicht mehr in ihrer Reinheit sehen, die Alten nicht mehr in ihrer Gesamtheit: der Rechte Weg wird im Reich zerstückelt.«
(Zhuangzi 33)
Was hier als Verfall des wahren Wissens beklagt wird, war nicht weniger als der Beginn der chinesischen Geistesgeschichte. Die Einsicht in die grundsätzliche Wandlungsfähigkeit der sozialen Ordnung und ihre Gestaltbarkeit durch den Menschen forderte zum Nachdenken über neue Weltentwürfe heraus.
Nicht zufällig ging der Beginn der Geistesgeschichte mit einer signifikanten Ausweitung des Schriftgebrauchs einher. Während aus früheren Zeiten lediglich Inschriften – meist [64]staatstragender Dokumente – erhalten sind, entstand in der Zhanguo-Zeit eine regelrechte Manuskriptkultur. Seit etwa 300 v. Chr. sind Texte auf weichen Schriftträgern – Holz- oder Bambusleisten, die durch Schnüre verbunden waren – bezeugt. Auf ihnen finden sich Reden, Lieder, Geschichten, Exorzismen, magische Formeln, philosophische Gespräche, Abhandlungen und andere Äußerungen, die bis dahin der Mündlichkeit vorbehalten waren. Kurz, es entstanden Bücher. War die Schrift in der Zeit der Rituellen Revolution hoffähig geworden, so wurde sie nun gesellschaftsfähig und erreichte damit eine unerhörte Wirkungsmacht. Sie ermöglichte das Lernen unabhängig von Zeit und sozialem Kontext und damit auch den kritisch-distanzierten und bewusst gestalterischen Umgang mit tradiertem Wissen. Die Ausbreitung der Schrift war die Voraussetzung für die Entstehung von Literatur und Philosophie in China. Mit ihr begann das klassische Zeitalter, in dem die »Hundert Schulen« der Philosophie Maßstäbe für die gesamte chinesische Tradition setzten.
Der erste, der seine Vorstellungen von einer gesellschaftlichen Neuordnung in eine Lehre gefasst hatte, war Konfuzius. Doch sein Einfluss blieb auch in den Jahren nach seinem Tod gering. Viel einflussreicher scheint die Lehre eines anderen Denkers gewesen zu sein, die des Mo Di (ca. 479–381). Er entwickelte einen Gegenentwurf zu Konfuzius, indem er Ahnenverehrung und jede Art von familiärem Egoismus ablehnt und stattdessen das Ideal der »allumfassenden Liebe« in den Mittelpunkt stellt:
»Angenommen, alle Welt liebte einander allumfassend, liebte den anderen so wie sich selbst: gäbe es dann etwa noch Pietätlosigkeit? […] Gäbe es etwa Familien von Würdenträgern, die einander ins Unheil stürzten? Fürstentümer, die einander angriffen? Wenn man die Familie eines [65]anderen wie die eigene ansieht, wer sollte dann Unheil stiften? Wenn man das Land eines anderen wie das eigene ansieht, wer sollte dann angreifen? […] Wenn also alle Welt einander umfassend liebt, dann herrscht Ordnung, wenn sie einander hasst, herrscht Chaos.«
(Mozi 14)
Nirgendwo fand die Struktur der neuen Gesellschaft deutlicheren Niederschlag als in dieser radikal egalitären Lehre, die keine Standes- oder Familiengrenzen mehr kennt, die alle Regeln in Frage stellte und grundlegend neue Ideen entwickelte. Die Mohisten suchten nicht nur nach allgemeinverbindlichen Regeln, sondern fragten zugleich, wie sich die Regeln rechtfertigten. Diese Skepsis reflektiert, wie unsicher die Grundlagen jedweder Ordnung in der Zhanguo-Zeit geworden waren. Nichts war mehr sicher, und immer drängender wurde die Frage, wie soziale Ordnung möglich sei. Hatte die Suche nach einer Letztbegründung sozialer Ordnung bei Konfuzius zu den weisen Herrschern der frühen Zhou und allgemeinverbindlichen Sitten geführt, fanden die Mohisten ein ganz anderes Ordnungsprinzip: den »Nutzen«, den alle erstreben. Der Widerstreit der Interessen mache es erforderlich, dass der »Tüchtigste und Fähigste«, in letzter Instanz also der Souverän, die Wertvorstellungen im Reich vereinheitlicht. Mo Di erklärte die Entstehung des Staates ganz ähnlich wie Thomas Hobbes.
Nicht zufällig tauchten diese Überlegungen genau zu dem Zeitpunkt auf, an dem im Alten China ein Leviathan entstand: ein allmächtiger Staat, der die Gesellschaft mehr und mehr in seinen Griff nahm. Die absolute Stellung des Herrschers wurde überall sichtbar. In Residenzstädten trennte nun oft eine zweite, innere Mauer den Palastkomplex ab, hohe Tore, imposante Terrassen und Türme, die geradezu in den Himmel wuchsen: Wolkenkratzer des Altertums, die den alles überragenden Staat symbolisierten. Zunehmend gigantische [66]Fürstengräber, von mächtigen, mit Tempeln bebauten Hügeln überwölbt, gemahnten weithin sichtbar an die Allmacht der Herrscher, die hoch über allen Untertanen thronten. Die Spitze der Gesellschaft entfernte sich weiter von der Basis, bis sie schließlich als etwas grundsätzlich anderes wahrgenommen wurde: so, wie der Himmel den Menschen gegenüberstand, erschien nun der Herrscher als Gegensatz zum Volk.
In der Lücke zwischen Herrscher und Untertanen entstand in der Zhanguo-Zeit eine neue soziale Schicht: die shi, eine gebildete Elite, die sich typischerweise aus den unteren Adelsschichten rekrutierte, deren Status gegenüber den Herrschern so weit gesunken war. Jetzt wurden die shi zu einer ›Mittelschicht‹, die zwischen Herrscher und Volk angesiedelt war – und damit an entscheidender Position. Sie waren es, die im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. den Fürsten ihrer Zeit konkurrierende Entwürfe zur Ordnung von Staat und Gesellschaft anboten.
Das Spannungsverhältnis von Staat und Gesellschaft wurde auf verschiedene Weise aufgelöst. Meng Ke (oder Menzius, ca. 372–289 v. Chr.), ein Denker in der Tradition des Konfuzius, gab der Gesellschaft Priorität. In dem ihm zugeschriebenen Werk, Mengzi, wird aus der Trennung von Staat und Gesellschaft eine Verantwortung des Herrschers für sein Volk abgeleitet – und umgekehrt das Recht des Volkes auf Widerstand gegen den Herrscher. Wie Mo Di ging Menzius von dem Gedanken aus, dass sich der Fürst nicht durch angeborene, sondern durch erworbene Eigenschaften legitimiere: jeder Mensch könne ein »Yao oder Shun«, das heißt ein weiser Herrscher, werden (S. 24). Voraussetzung dafür sei aber nicht Tüchtigkeit, wie bei Mo Di, sondern Güte und die Sorge um das Volk. Menzius nahm die Machtbasis der neuen Eliten ernst, indem er soziale Ordnung – eine Replik auf die Mohisten – nicht mit dem Souverän beginnen ließ, sondern mit dem Volk:
[67]»Das Volk ist am wichtigsten, gefolgt von den Göttern der Erde und der Hirse (Symbolen des Landes), und der Fürst ist am unwichtigsten. Daher wird derjenige Himmelssohn, der das Volk gewinnt.«
(Mengzi 7B14)
In einer raffinierten Neuinterpretation der Herrschaftslegitimation assoziierte Menzius das Volk mit dem Himmel: »Der Himmel sieht, wie unser Volk sieht; der Himmel hört, wie unser Volk hört.« Ebenso, wie der Himmel einem schlechten Herrscher das Mandat entziehen könne, besitze das Volk das Recht, gegen einen Tyrannen zu rebellieren. Der Herrscher solle daher tunlichst gütig, gerecht und im Einklang mit den Bedürfnissen des Volkes regieren: »Wer keinen Gefallen daran findet, Menschen zu töten, kann das Reich einen.«
Eine solche Lehre wäre undenkbar ohne die zhanguo-zeitliche Erosion der Adelsgesellschaft, durch die das Volk zur Stütze des Staates wurde. Doch Menzius verlieh ihr eine zeitlose Legitimation durch die These, dass das Wesen des Menschen von Natur aus gut sei: er besitze »intuitives Wissen« und »intuitives Können«, die ihn zum Guten disponierten. Moralisches Handeln sei demnach ganz im Einklang mit der natürlichen Ordnung – eine recht treuherzige Lehre in einer Zeit, in der Mord und Totschlag grassierten. Es überrascht kaum, dass Menzius keinen Herrscher seiner Zeit überzeugen konnte.
Viel realistischer erscheint demgegenüber ein anderer Denker, der sich ebenfalls auf Konfuzius berief, dessen Lehre aber ganz anders entwickelte: Xun Kuang (313–238 v. Chr.) oder Xunzi, »Meister Xun«. Meister Xuns Denken, in dem gleichnamigen Buch systematisch dargestellt, lässt sich am prägnantesten auf den Begriff der Differenz bringen: Differenz zwischen Himmel und Menschen, Natur und Gesellschaft, Vergangenheit und Gegenwart, Worten und Dingen. Xun Kuang [68]nahm den Grundgedanken der Achsenzeit, die Transzendenz, ernst, indem er den »Unterschied zwischen Himmel und Menschen« nicht überbrückte, sondern zur Grundlage aller Überlegungen machte. Der Himmel folgt seinem ewigen Gesetz, ohne sich nach dem Wohl und Wehe der Menschen zu richten. Naturerscheinungen sind völlig unabhängig von den Handlungen der Menschen. Es gibt kein moralisches Kontinuum, ja der Mensch selbst ist von Natur aus amoralisch und in diesem Sinne: schlecht.
»Menzius behauptete: ›Der Mensch, in seiner Gelehrsamkeit, ist von Natur aus gut.‹ Ich sage: Das ist nicht so. Er verkennt die Natur des Menschen und erfasst nicht den Unterschied zwischen der Natur und der Kultur des Menschen. Grundsätzlich: Natur ist vom Himmel eingerichtet und lässt sich nicht erlernen oder erarbeiten; Sitten und Anstand sind von den Weisen geschaffen, sie kann der Mensch erlernen und beherrschen, erarbeiten und vollenden.«
(Xunzi 23)
Das Gute liegt nicht in der Natur des Menschen, sondern in seiner »Kultur«, es ist »gemacht«, künstlich, uneigentlich: Xun Kuang erkannte den sozialen Ursprung der Moral. Umso wichtiger wurden deshalb zwei Dinge, die schon Konfuzius gelehrt hatte: die Sitten und das Lernen. Erst die Sitten geben den Menschen einen Rahmen für das geordnete Zusammenleben, erst durch das Lernen finden sie zum Guten. Nicht, dass das ›Gute‹ eine von der Erkenntnis unabhängige Existenz hätte, die der Mensch erkennen kann, wie sie eigentlich ist; so gutgläubig war Xun Kuang nicht. Auch hier beharrt er auf einer grundlegenden Differenz: der zwischen den Begriffen und den Dingen. »Begriffe haben keine feste Realität; man vereinbart sie, um Realitäten zu bezeichnen.« Ihr Bezug zu den Dingen ist somit rein konventionell, ohne innere Notwendigkeit. [69]Gleichwohl ist dieser Bezug nicht zufällig oder beliebig, denn die weisen Könige der Zhou selbst hätten diese Begriffe festgelegt. Allein aus der Autorität der Zhou-Könige gewinnt die begriffliche Ordnung ihre Legitimation.
Mit Xun Kuang erreichte die klassische chinesische Philosophie ihren Höhe- und zugleich ihren Endpunkt. Die Kontingenz und Zeitgebundenheit gesellschaftlicher Ordnung, die am Anfang aller Überlegungen stand, wird in seinem Werk in aller Konsequenz zu Ende gedacht – und ad acta gelegt. Allein in der Positivität dieser Ordnung, in ihrer Setzung durch die weisen Könige, liegt ihre Legitimation. Die Ordnung ist so, weil sie so ist. Damit gewann das Denken wieder festen Grund. Es ist kein Zufall, dass die Philosophie im Anschluss an Xun Kuang weniger theoretische als unmittelbar praktische, politische Wirkung entfaltete.