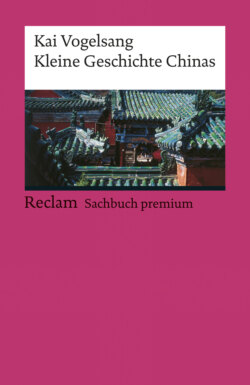Читать книгу Kleine Geschichte Chinas - Kai Vogelsang - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[7]Einleitung
ОглавлениеEine kleine Geschichte Chinas? Nichts scheint unpassender am Anfang des 21. Jahrhunderts, das doch ein »chinesisches« Jahrhundert werden soll. China ist heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auch politisch, militärisch und sportlich ist es zur Weltmacht aufgestiegen. Und je selbstbewusster der erwachte Drache in die Zukunft strebt, desto stolzer blickt er auf seine Herkunft. Ob in Staatsakten, Festreden oder gelehrten Publikationen: allenthalben wird auf Chinas glorreiche »5000jährige« Geschichte verwiesen. Während chinesische Politiker Statuen für historische Persönlichkeiten errichten und Gedenkzeremonien für mythische Kaiser abhalten, fördert die Tourismusindustrie die Renovierung historischer Stätten, das Kino produziert aufwendige Geschichtsepen. In wissenschaftlichen Großprojekten werden Daten der frühesten Herrscher sichergestellt und die Geschichte der letzten Kaiserdynastie festgeschrieben. Im Ausland präsentieren spektakuläre Ausstellungen Chinas kulturelles Erbe, elder statesmen verneigen sich vor der Weisheit der chinesischen Kultur, Fernsehserien, Zeitschriftenbeiträge und Bücher dokumentieren Chinas große Geschichte. Die Geschichte Chinas, so scheint es, darf heute vieles sein: prächtig, episch, einzigartig – nur eins nicht: klein.
Es ist nicht leicht, sich der suggestiven Kraft dieses Geschichtsbildes zu entziehen. Schließlich vermitteln chinesische Historiker schon seit über 2000 Jahren das Bild einer homogenen Hochkultur, die sich im Rahmen eines mächtigen Einheitsreichs entfaltete. Zwar mochten dessen Herrscher im zyklischen Auf und Ab der Dynastien kommen und gehen, auch Grenzen sich hier und da verschieben, doch die Einheit der Tradition blieb unerschütterlich. »China hat politische Teilungen und Vereinigungen erlebt«, so formulierten chinesische [8]Intellektuelle Mitte des 20. Jahrhunderts, »aber im Ganzen bildete stets eine große Linie das bestimmende Prinzip. […] In China ist im wesentlichen ein kulturelles System durchgehend überliefert worden, daran besteht kein Zweifel.« Das »Mandat des Himmels« wechselte, das Reich blieb sich gleich. Paradoxerweise führte dieses Geschichtsbild dazu, dass China weitgehend unhistorisch wahrgenommen worden ist. Im Europa der Aufklärung galt es als »ewiges China«, Land des Stillstandes, in dem die Ereignisse sich wiederholen, ohne dass sich Grundlegendes ändert, kurz: als Land ohne Geschichte. Noch heute wirkt dieser Topos nach. In China wird die Erzählung vom Aufstieg des chinesischen Volkes (mitsamt den »Minderheitenvölkern«, die seit je dazugehört hätten) und seiner Selbstfindung im Nationalstaat gepflegt – als sei die chinesische Nation einfach zu dem geworden, was sie immer schon war. Und in Europa genügt oft der Verweis auf die chinesische »Tradition«, um aktuelle Ereignisse in China zu erklären – als ob sich daran nie etwas geändert hätte. China scheint auf eigentümliche Weise dem Wandel der Zeiten überhoben zu sein.
Während dieses ahistorische Geschichtsbild fleißig gepflegt wird, haben sinologische Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte es Stück für Stück untergraben. Vor allem archäologische Funde legen nahe, dass Zivilisation in China von Anbeginn nicht durch Einheitlichkeit, sondern durch Vielfalt geprägt war. Ihre charakteristischen Ausprägungen sind nicht als Entfaltung ureigener Erbanlagen zu verstehen, sondern nur als Ergebnis eines Prozesses, in dem ganz verschiedene Lebensweisen zusammenkamen und sich einander anpassen mussten. China war stets von unterschiedlichen Kulturen umgeben und durchsetzt; das, was wir als »chinesisch« kennen, ist erst durch diese Kontakte entstanden. Die traditionelle Geschichtsschreibung hat diese Vielfalt sorgfältig verdeckt. Erst [9]neuere quellenkritische Untersuchungen haben nachgewiesen, wie stark diese Geschichte nach einem dogmatischen Idealbild verfasst wurde und wie der Eindruck von Kontinuität durch Rückprojektion jeweils gegenwärtiger Normen erzeugt wurde. Nicht die nationale Geschichte ist in den Nationalstaat gemündet, sondern umgekehrt: erst Chinas Selbstverständnis als Nationalstaat brachte eine Geschichte hervor, die diese neugefundene Identität legitimierte.
»China« ist also Geschöpf der Geschichtsschreibung. Das chinesische Wort für China, Zhongguo, war ursprünglich ein Plural: es meinte die »Mittleren Staaten« der Nordchinesischen Ebene. Später wurde daraus ein Singular: das »Reich der Mitte«, Siedlungsgebiet der »Chinesen«. Im 17.–19. Jahrhundert nahm Zhongguo schließlich eine Bedeutung an, die weit über das chinesische Kernland hinausging und ein Vielvölkerreich bezeichnete. Damit erst wurde es plausibel, unterschiedliche ethnische, religiöse und regionale Gruppen pauschal als »Chinesen« zu bezeichnen, die sich zuvor als eigenständig definiert hatten. Am besten versteht man »China« als Kollektivsingular, der eine Vielfalt von Verschiedenem in einem Begriff bündelt: separate Orte in einem Raum, unterschiedliche Verhaltensmuster in einer Kultur, ethnisch verschiedene Menschen in einer Nation, lokale Dialekte in einer Hochsprache, disparate Ereignisse in einer Geschichte.
Heute plädieren Intellektuelle wie Wang Hui dafür, »den Begriff ›China‹ von dem europäischen Modell nationaler Identifizierung zu befreien. China ist viel reichhaltiger, flexibler und multikulturell verträglicher, als bisher aufgezeigt wurde.« Diese Einsicht bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Darstellung. Wer Chinas Geschichte verstehen will, darf sich nicht von seiner gegenwärtigen Größe beeindrucken lassen. Der genauere Blick zeigt, dass China trotz aller Expansion stets ein kleinteiliges Gefüge geblieben ist, geprägt vom Mit- und [12]Gegeneinander ganz unterschiedlicher Elemente. Jahrtausendelang hat eine dünne Eliteschicht – höchstens 10 % der Bevölkerung – über anonyme Massen geherrscht. Während diese Eliten Politik machten, Recht sprachen, Geschichte, Kunst und Literatur schufen, pflegte die Landbevölkerung eine Vielzahl eigenständiger Lokaltraditionen, die mit der Elitekultur wenig zu schaffen hatten. So prominent diese Elitekultur uns heute erscheint – von einer einheitlichen, von allen getragenen »chinesischen« Kultur kann bis in die Moderne nicht die Rede sein.
Wie könnte es auch anders sein in einem Land, das so groß und divers wie ein ganzer Kontinent ist? 9,6 Millionen km2 umfasst das Gebiet der Volksrepublik China heute, kaum weniger als Europa vom Atlantik bis zum Ural. Zwischen Pamir und Pazifik, Südsibirien und den Tropen sind in China fast jeder Landschaftstyp und jede Klimaart anzutreffen: von tropischer, taifungefährdeter Küstenlandschaft bis zur subpolaren, kontinentalen Steppe; von den felsigen, inselreichen Küsten des Südens bis zu den Sandstränden des Nordens; von fluvialem Tiefland bis zu staubtrockener Wüste und den eisbedeckten Gipfeln des Himalaya. Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest mit 8848 Metern, liegt ebenso in China wie einer der tiefsten Punkte, die Turfansenke mit 154 Metern unter Meereshöhe.
Im Westen trennen die Achttausender des Himalaya und Karakorum, der Pamir, Tianshan und das Altai-Gebirge China von Südasien, Mittelasien und Westsibirien. Östlich dieser gewaltigen Bergketten fällt das Land in drei großen Stufen ab, die ihm ein charakteristisches Profil verleihen. Das Tibet-Plateau und Qinghai, beide über 4000 Meter hoch, sind das »Dach der Welt«. Nördlich und östlich davon bilden das Tarim-Becken, das Mongolische Plateau, das nordchinesische Lößplateau, das Sichuan-Becken und das Hochland von Yunnan eine zweite Stufe in etwa 1000–2000 Meter Höhe. Die Hügel und Ebenen [13]im Osten und Süden, schließlich das dichtbesiedelte Kernland Chinas markieren mit unter 500 Metern Höhe die dritte Stufe.
In diesem fruchtbaren, klimatisch begünstigten Hügel- und Tiefland entstand und verbreitete sich die chinesische Kultur. Dort fließen der »Gelbe Fluss«, Huanghe, und der Yangzi, die Lebensadern der chinesischen Welt. Die Wasserscheide zwischen Huanghe und Yangzi, zugleich die wichtigste Barriere zwischen Nord und Süd, bildet das bis zu 4000 m hohe Qinling-Gebirge. Auf etwa 33 Grad nördlicher Breite von West nach Ost verlaufend, wirkt es als klimatische Grenze, die China in zwei grundverschiedene Hälften teilt. Es trennt die sibirischen Winde, die in den Wintermonaten kalte, trockene Luft von Norden bringen, von den feuchtwarmen Monsunwinden des Südens, die im Sommer für reiche Niederschläge sorgen. Die ausgeprägten klimatischen Unterschiede zwischen Nord und Süd führten dazu, dass an den großen Flüssen des Nordens und Südens zwei ganz unterschiedliche Kulturräume entstanden, geprägt durch andere Wirtschaftsweisen, Lebensformen und Mentalitäten.
In Nordchina mit seinen großen Anbauflächen herrscht trocken-kontinentales Klima, geprägt von heißen Sommern und staubigen, klirrend kalten Wintern. Die Niederschläge von 50–60 cm jährlich fallen vor allem in den Sommermonaten, die Wachstumsperiode dauert nur ein halbes Jahr. Auf dem gelben, fruchtbaren Lößboden werden hauptsächlich Weizen und Hirse im Trockenfeldbau kultiviert. Die Landwirtschaft in Nordchina ist ein prekäres Unternehmen: einerseits führen unregelmäßige Niederschläge dort fast jährlich zu Dürren, andererseits können die verheerenden Überschwemmungen des Gelben Flusses in der Nordchinesischen Ebene ganze Ernten vernichten.
Ganz anders der Süden, jenseits von Qinling-Gebirge und Huai-Fluss. Hier sorgt der Monsunwind, der im Sommer [14]warme, feuchte Luft aus Südosten bringt, für regelmäßige, ergiebige Regenfälle von 100–120 cm; der Yangzi bietet reiche Wasserversorgung. Das Zusammenwirken dieser Faktoren macht das Yangzi-Tiefland zum fruchtbarsten Gebiet Chinas. Hier wird vor allem Nassreisanbau betrieben, mit Weizen als Zweitkultur. Die rund neun Monate lange Vegetationsperiode ermöglicht zwei Ernten im Jahr. Der Süden ist die Kornkammer Chinas und seit tausend Jahren sein demographischer Schwerpunkt: noch immer lebt der Großteil von mittlerweile 1,3 Milliarden Chinesen im Süden.
Während die weiten, trockenen Ebenen des Nordens der Bewegung von Menschen und Gütern kaum Hindernisse entgegenstellen, ist das Land im Süden durchzogen von Hügeln und Flüssen, die das Fortkommen auf dem Landweg erheblich erschweren. Sie sorgen zum einen dafür, dass der Süden lange vom Norden abgeschnitten war: der Yangzi markierte lange Zeit die definitive Grenze der chinesischen Zivilisation. Zum anderen bewirken sie, dass der Süden noch heute stark zersplittert ist und in viele gesonderte Regionen zerfällt. Einige von ihnen waren so stark isoliert, dass sie als eigenständige Großregionen zählen dürfen. Das Sichuan-Becken, von großen Bergketten umgeben, wurde erst spät von Chinesen erschlossen und hat im Laufe der Geschichte immer wieder politische Selbständigkeit behauptet. Das südöstliche Küstengebiet Fujians wurde durch das Wuyi-Gebirge ebenso vom chinesischen Kulturkreis abgeschottet wie der Südwesten durch die dschungelbedeckten Berge Guizhous und Yunnans.
Diese topographischen und kulturellen Abgrenzungen wirken sich in der Geschichte allenthalben aus. Es ist kein Zufall, dass schon die Steinzeitkulturen sich in Nord und Süd unterschiedlich ausbildeten, dass Reichseinigungen stets von den großen Ebenen des Nordens ausgingen, nicht aber vom zerklüfteten Süden, dass Sichuan im chinesisch-japanischen [15]Krieg zur letzten Bastion der Guomindang wurde und dass Deng Xiaoping 1992 in Guangzhou zu wirtschaftlicher Liberalisierung aufrief, nicht in Beijing. Viele Aspekte der Geschichte Chinas lassen sich nur verstehen, wenn man die großen regionalen Unterschiede des Landes im Auge behält.
Doch die Kontraste innerhalb des chinesischen Kernlandes wiegen gering im Vergleich mit denen zu den umliegenden, höher gelegenen Regionen Zentralasiens: den Bergen und Hochplateaus Tibets, der Mongolei mit ihren weiten Grassteppen und der Wüste Gobi sowie dem 1,6 Millionen km2 großen Ostturkestan, heute Xinjiang, mit der Dsungarei, dem Tarim-Becken und der Wüste Taklamakan. Diese Gebiete wurden, ebenso wie die manjurische Tiefebene, erst im 18. Jahrhundert in die chinesische Welt integriert und haben noch heute den Status autonomer Regionen. Sie sind durch natürliche Grenzen klar vom eigentlichen China getrennt: das tibetisch-chinesische Grenzgebirge im Westen, das Große Xing’an-Gebirge im Osten und – bezeichnenderweise – durch eine von Menschenhand errichtete Barriere, die Große Mauer, die von Gansu bis zum Golf von Bohai die Grenze Nordchinas markiert. Doch die entscheidende Trennlinie der chinesischen Zivilisation ist gänzlich unsichtbar: die agrarklimatische Grenze des Regenfeldbaus, die in einem langen Bogen von der Manjurei, entlang der Mauer, bis nach Qinghai und Tibet verläuft. Sie bildet die Scheide zwischen Acker- und Weideland. Nördlich und westlich dieser Linie fallen jährlich weniger als 400 mm Niederschlag, was ertragreiche Landwirtschaft fast unmöglich macht.
Im Laufe der Zeit hat sich der Unterschied zwischen dem chinesischen Stammland und diesen Gebieten zum Klischee verfestigt. Hier die Chinesen: sesshafte Bauern, die geduldig ihre Scholle bestellen, und kultivierte Städter in festgefügten Häusern, die Profite wägend Handel treiben und die höchste Erfüllung in Kunst, Dichtung und Philosophie finden. Dort die [16]»Barbaren«: namenlos und ungestüm, nomadisierende Schaf- und Pferdezüchter, über sich nichts als den Himmel und um sich die endlose Weite der Steppe, rastlose Reiter, deren Leben aus Jagd und Krieg besteht. Ihre Sprachen – Türkisch, Mongolisch, Manjurisch (eine Ausnahme bildet das Tibetische) – sind dem Chinesischen nicht einmal verwandt, Schrift haben sie lange nicht besessen. Hier geht es nicht bloß um den Unterschied zwischen Reis- und Hirsekultur, sondern um den Gegensatz von völlig andersartigen Lebensweisen.
Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Trennlinien keineswegs so scharf konturiert sind, wie sie zunächst erscheinen. Dann fällt auf, dass chinesische Herrscher seit je Heiratspolitik mit Fremdvölkern betrieben haben; dass die großen Dynastien Zhou, Qin und Tang Wurzeln im Westen, außerhalb der chinesischen Stammlande hatten; dass so manche »Barbaren« sich chinesischer gegeben haben als die Chinesen; und vor allem: dass nicht wenige von ihnen – Tuoba, Khitan, Jurchen, Mongolen, Manjuren und andere – für einen großen Teil der letzten 2000 Jahre sogar in China geherrscht haben und weit darüber hinaus. Unter diesen Dynastien hat das Reich seine größten territorialen Ausdehnungen erreicht, sie schufen allererst die Voraussetzung für Chinas heutige Größe.
Die scharfe Abgrenzung Chinas nach außen ist ebenso ein Mythos wie die Entgrenzung im Inneren. Das chinesische »Einheitsreich« war ethnisch und kulturell nie einheitlich. Mongolen, Turk-, Thai- und andere Völker, sogar Indoeuropäer lebten seit je inmitten der »chinesischen« Bevölkerung. Sie brachten Krieg und Verluste, aber auch Anregung und Bereicherung für die »chinesische« Kultur. Die Erzählung von der Ausbreitung einer autochthonen chinesischen Kultur über einen ganzen Kontinent, einer Kultur, die alle Kraft aus sich selbst schöpfte und deren Strahlkraft sich die »Barbaren« willig unterwarfen, verliert damit erheblich an Plausibilität.
[17]Ebenso problematisch ist die Rede von der »ältesten Kultur der Welt«. Denn auch die zeitliche Einheit der chinesischen Geschichte, ihre vielzitierte »Kontinuität«, löst sich bei genauem Zusehen auf. Chinas Geschichte ist geprägt von langfristigem Wandel, abrupten Brüchen und Diskontinuitäten. Schon beim Blick auf die scheinbar so einheitliche Dynastientafel mag man sich wundern: da zerfallen die Dynastien Zhou, Han und Jin in »Westliche« und »Östliche« Teile, sodann liest man von »Kämpfenden Staaten« – im Plural –, »Drei Reichen«, »Südlichen und Nördlichen Dynastien«, »Fünf Dynastien« und sogar »Zehn Königreichen«, die in China geherrscht haben. Alles andere als ein kontinuierliches Einheitsreich, war China über viele Jahrhunderte seiner Geschichte in verschiedene Herrschaftsgebiete geteilt. Allein in den knapp 1700 Jahren vom Ende der Han (220) bis zum Sturz der Qing (1912) war China rund 750 Jahre lang in verschiedene Staaten zersplittert. Diese Perioden staatlicher Schwäche, in denen auch soziale Grenzen porös wurden und sich für neue Einflüsse öffneten, waren keineswegs Zeiten des Niedergangs, im Gegenteil: ihnen verdankt die chinesische Kultur ihre schönsten Blüten und prägende Formung. China existierte nie in splendid isolation, sondern wurde in dem Maße reicher und komplexer, in dem es Anreize von außen erhielt.
Die Geschichte Chinas kann nicht die Erzählung von der kontinuierlichen, stetig fortschreitenden Ausformung einer einheitlichen Kultur sein. Eine solche konnte in China – ebenso wenig wie in anderen Zivilisationen – unter vormodernen Bedingungen nie geschaffen werden. Alle Versuche, die Vielfalt der Kulturen in China einer uniformen Ordnung zu unterwerfen – von der brutalen Reichseinigung der Qin über die Despotien der Späten Kaiserzeit bis hin zum Totalitarismus der Volksrepublik China –, konnten nur einen dünnen Firnis politischer Einheit über die bunte Vielfalt des Lebens legen. [18]Unter dem monochromen Putz der Nationalgeschichte zeigt sich ein farbiges Mosaik, vielfach gebrochen, durchzogen von Rissen und feinen Schattierungen. So gesehen, beeindruckt die Geschichte Chinas weniger durch Einheit und Geschlossenheit, sondern fasziniert durch Vielfarbigkeit und Kontraste; sie entfaltet ihren Reiz nicht in monumentaler Größe, sondern eben: im Kleinen.
Wie aber steht es mit der chinesischen Kultur und ihren Traditionen, dem »Konfuzianismus«, der »Harmonie«, der oben zitierten »großen Linie« und dem »bestimmenden Prinzip«? Sie alle sind, genau wie so viele europäische »Traditionen«, erfunden. Traditionen, das haben die englischen Historiker Hobsbawm und Ranger gezeigt, entstehen immer dann, wenn Kontinuitäten zerbrechen. Das bedeutet nicht, dass erfundene Traditionen, als Fiktionen entlarvt, für die Geschichte keine Rolle spielen. Im Gegenteil, sie sind ein höchst aufschlussreicher Teil der Geschichte, denn Historiker müssen sich fragen: Warum wurden solche Selbstdarstellungen plausibel, ja notwendig? Unter welchen historischen Umständen entstanden sie, auf welche Probleme reagieren sie? Wer so fragt, wird bald entdecken, dass erfundene Traditionen zu den wesentlichen Ordnungsmustern der chinesischen Gesellschaft gehören. Den Erzählungen von Einheit und Kontinuität dürfte eine zutiefst prägende Erfahrung von Haltlosigkeit und Diskontinuität zugrunde liegen. Sie verweisen – das ist die These dieses Buchs – auf das Grundproblem der chinesischen Geschichte: die Ordnung einer heterogenen Gesellschaft.
Auf jede Steigerung sozialer Optionen reagierte die chinesische Gesellschaft mit neuen Ordnungsmustern, um diese Komplexität zu bewältigen: ein Widerstreit von Perfektion und Korruption, Ordnung und Chaos, Entropie und Negentropie. Erzählungen von Einheit antworten auf empirische Vielfalt, Beschwörungen von Kontinuität kompensieren die [19]Erfahrung von Diskontinuität, eindeutige Weltbilder reagieren auf Ambivalenzen der Wirklichkeit. Allemal indiziert die Abwehrreaktion den Infekt. Der Zusammenhang zwischen Strukturwandel der chinesischen Gesellschaft und den darauf reagierenden Ordnungsmustern prägte die chinesische Geschichte tiefer als das Auf und Ab der Dynastien. Jener, nicht dieses, bestimmt daher den Aufbau dieses Buches.
Es beginnt (1) mit der Entstehung Chinas im frühen 1. Jahrtausend v. Chr., als sich eine stratifizierte Adelsgesellschaft bildete, die Regionen und Verwandtschaftsgruppen transzendierte: jetzt wurden Sitten für den Verkehr mit Fremden gebraucht. Als diese Adelsgesellschaft sich im späten 1. Jahrtausend v. Chr. auflöste (2), wurde die Differenz zwischen Zentrum und Peripherie zum entscheidenden sozialen Strukturmerkmal; ihr entsprach die Entwicklung einer Bürokratie, die zwischen beiden vermittelte. Als die Orientierung an der Zentrale zunehmend familiären und konfessionellen Verbänden wich (3), wurde Religion zum integrierenden Ordnungsfaktor. In einer Gesellschaft, die seit dem 8. Jahrhundert von Regionalismus und hoher sozialer Mobilität geprägt war (4), wirkte Moral als integrierendes Element. Als die soziale Mobilität so zunahm, dass eine Auflösung der ständischen Ordnung drohte (5), diente die Despotie als letztes Mittel, um die Gesellschaft zu stabilisieren. Ab dem 19. Jahrhundert (6) war der Übergang zu einer funktional differenzierten Gesellschaft unübersehbar geworden, für die Partizipation und die Selbstbeschreibung als Nation angemessene Ordnungsmuster boten. Im 20. Jahrhundert (7) führte zunehmende Integration von Unterschichten zu einer Massengesellschaft, die mit den Mitteln des Totalitarismus gebändigt wurde. Seit China im 21. Jahrhundert (8) Teil der Weltgesellschaft geworden ist, sorgt ein virulenter Nationalismus für sozialen Zusammenhalt.
[20]Eine solche Einteilung der chinesischen Geschichte dürfte Sinologen irritieren. Die verschobene Perspektive will fraglose Kontinuitäten auflösen und zugleich den Blick auf Zusammenhänge lenken, die durch herkömmliche Unterteilungen allzu leicht verdeckt werden. Nicht zuletzt will sie zeigen, dass die Chinesen uns gar nicht so unähnlich sind, wie es oft dargestellt wird. Denn die chinesische Geschichte ist keineswegs unvergleichbar. Die vorliegende Kleine Geschichte Chinas – darin unterscheidet sie sich von meiner umfangreicheren Geschichte Chinas – will diese Vergleichbarkeit akzentuieren. Sie richtet sich an Leserinnen und Leser, die China weniger um seiner selbst willen studieren, sondern das Land aus europäischer Sicht beobachten und sich wundern mögen, warum China – ein alter Topos – so »anders« erscheint. Statt solche Unterschiede der unergründlichen Tiefe chinesischer »Kultur« zuzuschreiben (und damit einer Erklärung auszuweichen), will diese Darstellung sie wieder der Geschichte zuführen. Eine Reihe kurzer Exkurse mit Vergleichen zur europäischen Geschichte soll verdeutlichen, dass die Chinesen, so einzigartig ihre kulturellen Schöpfungen sind, meist auf die gleichen Probleme reagiert haben, die wir aus der eigenen Geschichte kennen – und oft ganz ähnliche Lösungen gefunden haben. Der Blick auf diese grundlegenden Strukturen hinter den Ereignissen lässt China nicht als Kuriosum erscheinen. Vielmehr zeigt er, wie viel wir mit den vermeintlich so fremdartigen Chinesen gemein haben – und dass wir, um China zu verstehen, auch unsere eigene Geschichte kennen müssen.