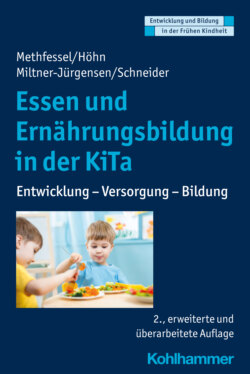Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Emotionen – ihr Einfluss auf Essen und Ernährung
ОглавлениеManchmal wenn ich Ruhe brauche, setze ich mich in meine Bonbonniere und ein Gummibärchen hält mir die Hand.
(Graffiti, zitiert nach Grunert, 1993, S. 2)
Wenn Säuglinge und Kleinkinder essen lernen, wird nicht nur ihr »physischer Hunger« gestillt. Sie erfahren die Befreiung vom Schmerz, den der Hunger ausgelöst hat, und erleben beim Essen Nähe, Zuwendung und Geborgenheit sowie Sicherheit. Zudem werden durch die Nahrungsaufnahme auch Transmitter und Hormone reguliert, die positive Stimmungen fördern. Neben dem physischen wird daher auch ein psychischer und sozialer »Hunger« gestillt. Essen ist mit Emotionen verbunden, wie auch das Zitat zu Beginn deutlich macht (vgl. auch Grunert, 1993; Klotter, 2007, 2015; Meyerhof, 2013; Methfessel, 2020; Pudel & Westenhöfer, 2003).
Essverhalten zur Selbstregulierung von Emotionen ist ein alltägliches, jederzeit beobachtbares Phänomen. Es ist eine Reaktion auf Emotionen, um diese zu modifizieren, aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Emotionsbedingtes Essen dient der Ablenkung oder Verarbeitung von unangenehmen Erlebnissen, der Linderung oder Beseitigung von Frustrationen und der Belohnung nach Erfolg oder nach überstandenen Schwierigkeiten. (Grunert, 1993, S. 1)30
Die enge Verknüpfung von Essen und Emotionen besteht von Anfang bis Ende eines Lebens. Wie sich diese Verbindung entwickelt und welche Bedeutung sie für das Essverhalten hat, wird gelernt. Das Kind muss lernen, seine Emotionen zu regulieren, und erwirbt damit implizit die Fähigkeit zur Differenzierung von Emotionen und zur Entwicklung und Nutzung von Alternativen der Regulierung (vgl. Grunert, 1993; Holodynski & Oerter, 2018).
Stillen als Bezeichnung für das Füttern des Säuglings beruht darauf, dass mit dem Nachlassen des Hungers auch das mit diesem verbundene Unwohlsein und die Unruhe nachlassen und das Kind ruhig und still wird. Essen dient seit jeher dazu, das Kind zu beruhigen, zu trösten, zu belohnen, zu bestrafen usf. Pudel und Westenhöfer (2003, S. 39) sprechen in diesen Fällen vom »Abspeisen« der Kinder. Rützler berichtet, dass viele Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren beginnen, »das Wort ›Hunger‹ für Langeweile, Einsamkeit, Traurigkeit und andere Gefühle zu verwenden« (2007, S. 49).
Die unterschiedlichen Gefühle des Kindes mit nur einem Angebot, nämlich Nahrung bzw. Essen, regulieren zu wollen, kann zwei wichtige Entwicklungen behindern: (1) zu lernen, die eigenen Emotionen zu differenzieren und zu regulieren, (2) ein Essverhalten zu entwickeln, das der physischen, psychischen und sozialen Gesundheit dient. Dafür ist auch wesentlich, dass die Füttersituation nicht die einzige Situation bleibt, in der ein Kind eine intensive Zuwendung erfährt.
Essen beeinflusst Emotionen auch auf weitere Weise: Essenssituationen in fremden (d. h. nicht familialen) Umgebungen sind in KiTas ein wichtiger Stressfaktor, der bei der Organisation bedacht werden muss (Gutknecht & Höhn, 2017, S. 14 ff.; Kap. 7.2). Der Wunsch nach Selbstständigkeit erfordert die Unterstützung zur Selbstregulation ( Kap. 2.2.3). Ein Verständnis der emotionalen Entwicklung und deren Bedeutung für die Beziehung von Essen und Emotionen ist daher eine wesentliche Grundlage für Essen und Ernährungsbildung in der KiTa.