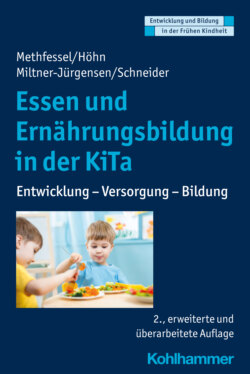Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Ausdrucksformen der Emotionen
ОглавлениеVon Geburt an verfügt der Säugling über Emotionen als Reaktion in bestimmten Situationen und differenziert diese Emotionen aus. Dazu gehören Ekel und damit verbundene Reaktionen (u. a. Ausspucken), die aus phylogenetischer Perspektive der Sicherheit vor giftigen Stoffen dienten ( Kap. 3.2), sowie Interesse und Erregung als Reaktion auf eine bestimmte Umwelt. Ab dem zweiten Monat werden Freude, ab dem siebten Monat Ärger, Trauer und Furcht, ab dem neunten Monat Überraschung ausgedrückt (Holodynski, 2014; Holodynski & Oerter, 2018).
Ein Säugling drückt die jeweilige Emotion mimisch aus. Die Mimik spiegelt wider, wie er die Situation erlebt. Dies geschieht zunächst mit angeborenen Ausdrucksformen, die universell und kulturübergreifend sind. Hingegen ist die mit etwa einem halben Jahr beginnende Emotionsregulierung bereits als Ergebnis von Interaktionen kulturell beeinflusst.
Angeborene Ausdrucksformen für Emotionen sind Distress, Wohlbehagen, Interesse, Erschrecken und Ekel (Holodynski & Oerter, 2018). Vor allem in der frühesten Kindheit sind sie eng mit Essen und Ernährung verbunden:
• Distress: Schreien signalisiert einen dringenden Bedarf, z. B. nach Nahrung, oder auch Schmerz und Unwohlsein, bei Hunger oder Blähungen.
• Wohlbehagen: Lächeln signalisiert den Abschluss eines Spannungs-Entspannungsprozesses und den Aufbau von positiven Emotionen bei Wohlbefinden, z. B. nach dem Essen, bei positiven Geschmackserfahrungen oder als Reaktion auf die soziale Interaktion beim Füttern.
• Interesse: Visuelle Aufmerksamkeit mit leicht geöffnetem Mund signalisiert Interesse bei externen stimulierenden Reizen, z. B. die Wahrnehmung von Signalen für den Beginn einer Mahlzeit oder das Wahrnehmen des Geruchs der Mutter.
• Ekel: Naserümpfen mit Vorstrecken der Zunge (Zungenstreckreflex, Kap. 2.1) zum Ausspucken bei ungenießbarem und als unangenehm empfundenem Geschmack ( Kap. 3.2).
• Erschrecken: Aufgerissene Augen und Körperspannung signalisieren Schrecken und eine als bedrohlich und überfordernd empfundene Situation. Dies spielt für Essen meist nur eine indirekte Rolle, wenn z. B. die Essumgebung oder die Esssituation als bedrohlich wahrgenommen werden.
Schon der Säugling beobachtet andere Menschen und nimmt deren Mimik wahr, er fühlt sich z. B. angenommen, bestätigt oder bedroht. In diesen Interaktionen lernt er ebenfalls, den anderen zu imitieren. Er interagiert mit seinen emotionalen Ausdrücken und reagiert auf die »mimischen Antworten«, die er erhält. Er lernt, den ihm übermittelten Ausdruck zu interpretieren (»Gedankenlesen«) sowie Gefühle nachzuahmen und zu übernehmen (»Gefühlsansteckung«; Holodynski & Oerter, 2018, S. 522).
In diesem Alter beginnt das »Imitationslernen«. Es wird in der Essentwicklung wichtig, da Kinder durch das Nachahmen der Eltern bzw. KiTa-Bezugspersonen neue Wege des Essens (z. B. mit dem Löffel) oder neue Lebensmittel bzw. Speisen kennenlernen und akzeptieren können. Wenn die fütternde Person vormacht, wie man einen Löffel in den Mund steckt, und damit zeigt, dass das angebotene Essen gegessen werden kann, gibt dies dem Kind Orientierung und Sicherheit.
Im Laufe des zweiten Lebensjahres lernt das Kind, nicht nur wahrgenommene Emotionen widerzuspiegeln, sondern auch zu reagieren und Empathie zu entwickeln, z. B. zu trösten (Holodynski & Oerter, 2018, S. 504 ff.). Mit zunehmendem Alter entwickeln Kinder weitere Emotionen wie Freude, Ärger, Stolz, Enttäuschung oder Scham. Sie lernen, diese Emotionen inter- und intrapersonal zu regulieren. Eltern oder pädagogische Bezugspersonen werden dann von dem zu imitierenden Vorbild zur »Bewertungsinstanz«, die durch ihren Umgang mit Essen Sicherheit bieten.
Essen ist eine regelmäßig stattfindende Tätigkeit, die stark mit Emotionen sowie zentralen Bedürfnissen bzw. Motiven und Motivationen verbunden ist. Essen zu lernen ist ebenfalls von Emotionen, Stimmungen und »gegenständlichen Gefühlen« begleitet. Spätestens ab dem Alter von 1 ½ Jahren werden über das Essen auch Konflikte ausgetragen, deren Ursachen in anderen Situationen oder Beziehungen liegen, wie z. B. Sympathie und Antipathie gegenüber Personen oder Dominanz- und Widerstandsversuche.
Da all diese Emotionen das Essen begleiten, ist es notwendig, sie zu (er)kennen und in professionell responsiver Weise zu agieren (Gutknecht, 2015a, 2015b; Gutknecht & Höhn, 2017, S. 12 ff.; Kasten 2.1), um das Kind bei der Emotions- und Tätigkeitsregulierung zu unterstützen.