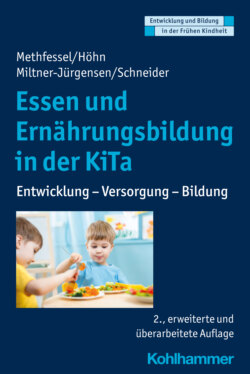Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Essen und die Befriedigung von Grundbedürfnissen
ОглавлениеOhne Essen kann der Mensch nicht überleben. Essen ist grundlegend, und Hunger und Durst sind Basis- bzw. Grundbedürfnisse, welche zum Überleben befriedigt werden müssen. Vermutlich bringt aber nicht (nur) dieses Wissen Menschen dazu, Zeit, Geld und andere Ressourcen für die Nahrungsbeschaffung und -bearbeitung zu investieren, sondern die durch Essen gewonnenen (hormonell gesteuerten) Lustempfindungen (Meyerhof, 2013). Die Steuerung des Essens ist zudem durch zahlreiche weitere psychische und soziale Faktoren beeinflusst: So füllen z. B. Lieblingsgerichte die »innere Leere«, reduziert genüssliches Essen Spannungen, gibt die gemeinsame Mahlzeit Geborgenheit oder soziale Anerkennung. Damit betrifft Essen mehr als die physiologischen Bedürfnisse (Kluß, 2018; Meyerhof, 2013; Methfessel et al., 2020).
Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung sind häufig genutzte Begriffe bei der Beschreibung der kindlichen Entwicklung. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Natur bzw. Art und Definition von Bedürfnissen sowie darauf basierende Bedürfnistheorien haben bereits eine lange Tradition (Grunert, 1993, S. 31 ff.). Allerdings werden die beiden Begriffe nicht einheitlich definiert, interdisziplinär bestehen teilweise große Differenzen (s. Heft 1 »Bedürfnis und Konsum« von Haushalt in Bildung & Forschung, 2020). Auch im pädagogischen Kontext wird schnell von Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung gesprochen, ohne genau zu differenzieren, was gemeint ist. Daher sollen sie im Folgenden definiert und erläutert werden, um zu einem einheitlichen Verständnis beizutragen.
Bedürfnisse drücken einen Mangel aus, der zu dem Bestreben führt, diesen zu beseitigen. Sie sind daher grundlegende Antriebskräfte für menschliches Handeln. Ihre Kenntnis ist elementar, um das Verhalten und Handeln beim Essen zu verstehen.
Aus wissenschaftlicher Perspektive sind Bedürfnisse Ausdruck eines physischen und/oder psychischen Mangels. Folglich werden Bedürfnisse in physische und psychische Bedürfnisse unterschieden (Städtler, 1998, S. 107).33 Des Weiteren wird differenziert nach »sozialpsychologischen Bedürfnissen (wie Zugehörigkeit), individualpsychologische Bedürfnisse (wie Achtung) oder in interpersonale Beziehungsbedürfnisse und personale Entwicklungs- und Wachstumsbedürfnisse« (Methfessel & Schöler, 2020, S. 4; vgl. auch Grunert, 1993, S. 37). Die Befriedigung physischer Bedürfnisse wird u. a. durch das Prinzip der Homöostase reguliert (vgl. Methfessel et al., 2020). Auch das Bedürfnis nach Sicherheit ist unhinterfragt; Neophobie und Xenophobie (Angst vor Fremdem) sind z. B. angeboren. Dass der Mensch Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen sucht, kann als Ausdruck davon gewertet werden, dass er ein soziales Wesen ist. Da in allen bekannten Kulturen »grundlegende Fragen zum Sinn und Ziel ihrer eigenen Existenz […] wie: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich?« (Methfessel & Schöler, 2020, S. 5) gestellt werden, wird deutlich, dass Bedürfnisse über eine physische Versorgung und eine soziale Zugehörigkeit hinausgehen können. Auch das Streben nach Wirksamkeit wird bei Menschen (und einigen Tieren) als angeboren angesehen (Haase & Heckhausen, 2018, S. 492).
Von Grundbedürfnissen redet man also, wenn diese kulturübergreifend festzustellen, also universell gültig sind. Wie diese Bedürfnisse aber zum Ausdruck kommen und wie sie befriedigt werden, ist in allen Kulturen unterschiedlich.
Für viele auf Essen bezogene Handlungen sind z. B. auch Motive bzw. Motivationen auslösend, denen nicht das Grundbedürfnis Hunger zugrunde liegt: Beispielsweise wird aus Frust, Langeweile oder Liebeskummer gegessen, oder die Suche nach sozialer Anerkennung oder Autonomiebestreben sind bei Essstörungen entscheidend. Essen wird dann ein Mittel zur Emotionsregulierung oder zur Befriedigung verschiedener Grundbedürfnisse.
In der Psychologie wird – in Ablehnung diffuser Triebtheorien oder empirisch und theoretisch nicht nachvollziehbarer Strukturierungen von Bedürfnissen (vgl. Grunert, 1993, S. 32 ff.) – seltener von Bedürfnissen gesprochen (ausgenommen sind meist sog. physische Bedürfnisse). Stattdessen werden Begriffe wie Motiv und Motivation bevorzugt. Motivationen sind jedoch nicht die ursprünglichen Triebkräfte. Sie setzen schon voraus, dass das Gefühl des Mangels (Hunger) in den Vorsatz mündet, den Mangel zu beheben (ich will etwas zum Essen suchen). Sie können daher schon auf bestimmte Gegenstände (z. B. Obst) gerichtet sein. Dann wird das Bedürfnis schon mit Vorstellungen des Bedarfs verbunden, d. h. konkreten, materiellen und immateriellen Objekten, mit denen Bedürfnisse zu befriedigen sind. Motivationen können beim Essen auch durch entsprechende Körperprozesse gesteuert werden (vgl. Meyerhof, 2013).
Ein Motiv wird als Anreiz menschlichen Handelns definiert, als ein positiv bewerteter Zielzustand, den eine Person bestrebt ist, zu erreichen.
Der Begriff der Motivation beschreibt den Prozess der Aktivierung und Auswahl von Motiven und der sie befriedigenden Handlungen. (Holodynski & Oerter, 2018, S. 517)
Der Begriff Bedürfnis wird hier bevorzugt, weil damit auch der aus einem Mangel entstehende Bedarf eines Kindes betont wird. Mit diesem Begriff kann zudem eher deutlich werden, wie viele Bedürfnisse und wie diese durch Essen angesprochen werden (können) (Methfessel et al., 2020). Bedürfnis als Ausdruck des Mangels und Bedarf als Objekt zur Bedürfnisbefriedigung sollten nicht verwechselt werden.
Im Folgenden werden vier Ansätze kurz vorgestellt, in denen Grundbedürfnisse jeweils verschieden strukturiert werden: Durch die pädagogisch orientierten Selbstbestimmungs-, Interessen- und Motivationstheorien wurde die Diskussion um grundlegende Bedürfnisse neu aufgenommen. Nach einer umfassenden Analyse der vorliegenden Studien entwickelten die Psychologen Deci und Ryan eine theoretisch begründete Struktur von angeborenen Bedürfnissen, die zu einer anerkannten Grundlage in der pädagogischen Diskussion um Bedürfnisse wurde und die in der Pädagogik favorisiert wird (Deci & Ryan, 1993; Ryan & Deci, 2017, 2019). Darüber hinaus werden die häufig zitierte Bedürfnistheorie von Maslow (1992, 2018), der für die Ernährungsbildung interessante Ansatz von Grawe (2004) und die Grundbedürfnisse von Kindern von Brazelton und Greenspan (2002) angesprochen. Abschließend wird noch einmal kurz die Frage nach Bedürfnissen und Motiven und deren Relevanz für die KiTa aufgegriffen.