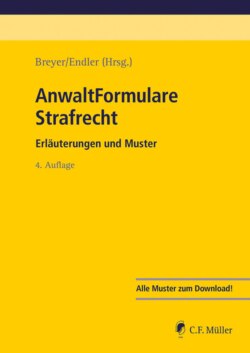Читать книгу AnwaltFormulare Strafrecht - Matthias Klein - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Abgrenzung Strafverteidigung/Strafvereitelung
Оглавление108
Die Tätigkeit des Strafverteidigers ist bereits aufgrund seiner Aufgabenbestimmung davon geprägt, der strafrechtlichen Verfolgung des Mandanten entgegen zu wirken und letztlich – soweit prozessual möglich – seine Bestrafung zu verhindern. Die optimale Erfüllung des Verteidigerauftrags müsste demnach (beim schuldigen Mandanten) immer auch den Tatbestand der Strafvereitelung verwirklichen. Der Beschuldigte selbst kann eine Strafvereitelung zu seinen Gunsten zwar nicht begehen, sondern handelt zum Zwecke des (straflosen) Selbstschutzes,[153] der Verteidiger hingegen grundsätzlich sehr wohl. Dass der Strafverteidiger indes nicht dazu verpflichtet sein kann, sich bereits qua seines Auftrags zwangsläufig wegen Strafvereitelung strafbar zu machen, versteht sich von selbst. „Verteidigung ist nicht Vereitelung, sondern Bedingung rechtsstaatlichen Strafens“.[154]
109
Als grundlegend zur Abgrenzung erlaubter (strafloser) Strafverteidigung von unzulässiger (strafbarer) Strafvereitelung sind insbesondere zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus den Jahren 1992[155] und 2000[156] anzusehen. In diesen Entscheidungen betont der Bundesgerichtshof, dass das in der Stellung des Verteidigers im Strafprozess innewohnende Spannungsverhältnis zwischen Organstellung und Beistandsfunktion einer besonderen Abgrenzung zwischen erlaubtem und unerlaubtem Verhalten in Bezug auf den Straftatbestand der Strafvereitelung erforderlich mache.[157] Einerseits dürfe der Verteidiger grundsätzlich alles tun, was seinem Mandanten nützt, soweit er sich hierbei in dem ihm vom Prozessrecht vorgegebenen Rahmen halte. Standesrechtlich zulässiges Verhalten sei in der Regel prozessual nicht zu beanstanden, standesrechtlich unzulässiges Verhalten führe allerdings nicht ohne Weiteres zur Strafbarkeit.[158] Soweit ein Strafverteidiger prozessual zulässig handle, könne sein Verhalten schon nicht den objektiven Tatbestand des § 258 StGB erfüllen und wirke nicht erst rechtfertigend.[159] Der Verteidiger habe sich jedoch hierbei jedweder aktiver Verdunkelung und Verzerrung des Sachverhalts zu enthalten.[160] Pflichtgemäßes Verteidigerverhalten liege insbesondere dann nicht mehr vor, wenn sich lediglich der Anschein zulässiger Verteidigung ergibt, in Wirklichkeit indessen ausschließlich verfahrensfremde Zwecke verfolgt werden.[161] Insbesondere eine bewusste Verfälschung von Beweismitteln sei ihm untersagt.[162]
110
Dass sich bei dieser weniger konkretisierenden, denn umschreibenden Abgrenzung (noch) zulässigen von (schon) strafbaren Verteidigerhandelns für den Verteidiger schwierige Situationen ergeben können, räumt der Bundesgerichtshof ein. Er meint indes, dass darin zu erblickende „Unstimmigkeiten“ durch eine sorgfältige und strenge Prüfung der Frage ausgeräumt werden könnten, ob – zumindest – bedingt vorsätzliches Verhalten des Verteidigers hinsichtlich der Vortat vorliege.[163] Zudem sei regelmäßig davon auszugehen, dass ein Strafverteidiger als Organ der Rechtspflege strafbares Verhalten nicht billigt und er daher regelmäßig mit dem inneren Vorbehalt handelt, das Gericht werde die Glaubhaftigkeit der (zweifelhaften) Aussage des benannten Zeugen oder der Echtheit der von ihm vorgelegten (ebenso zweifelhaften) Urkunden einer kritischen Prüfung unterziehen.[164] Gerade auch an den Nachweis der Vereitelungsabsicht i.S.d. § 258 StGB seien daher im Hinblick auf die besondere Stellung des Strafverteidigers regelmäßig erhöhte Anforderungen zu stellen.[165]
111
Diese Formulierungen des Bundesgerichtshofs können nicht befriedigen, benötigt der Verteidiger doch eine klare Abgrenzung des Rahmens, innerhalb dem er die Verteidigung führen kann – und muss! Zu Recht betont der Bundesgerichtshof das Spannungsverhältnis, in dem der Verteidiger sich aufgrund der ihm von der Strafprozessordnung zugedachten Stellung befindet. Dabei weist er ebenso zutreffend auf die Verpflichtung des Strafverteidigers hin, seinen Mandanten „bestmöglich“ zu verteidigen (siehe Rn 34).[166] Er verlangt vom Verteidiger, dass er ihm zugängliche Beweismittel zugunsten seines Mandanten in den Prozess einbringt, auch wenn er dabei zunächst objektiv strafbar handeln möge und verweist ihn darauf, dass „Unstimmigkeiten“ auf der Vorsatzseite „ausgeräumt“ werden könnten.[167]
112
Damit wird dem Verteidiger in der Praxis eine schwierige Aufgabe aufgebürdet. Er muss die (teilweise unklaren) Grenzen zulässigen Verteidigerhandelns nicht nur tunlichst einhalten, sondern sie zugleich auch bis zum Randbereich zulässiger Verteidigung ausschöpfen, um dem Anspruch des Mandanten auf optimale Verteidigung zu entsprechen. Im Klartext bedeutet dies, dass der Strafverteidiger kraft seines Auftrags dazu verpflichtet ist, im Zweifel bis an die Grenzen eigener Straffälligkeit zu verteidigen – aber auch nicht darüber hinaus! Dabei bleibt zumindest festzustellen, dass bei auftretenden Konflikten, die sich für den Verteidiger aus seiner doppelten Pflichtenstellung als selbstständiges Organ der Rechtspflege und einseitigem Beistand des Beschuldigten ergeben, grundsätzlich der Beistandsfunktion der Vorzug gebührt,[168] der Verteidiger also in erster Linie die subjektiven Rechte des Mandanten zu wahren und den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf die den Mandanten entlastenden Umstände zu legen hat.[169]
113
Im Übrigen wird sich der Strafverteidiger letztlich an der bestehenden Kasuistik zu orientieren haben, muss sich dabei jedoch bewusst sein, dass sie in vielen Fällen hoch umstritten ist.[170] Die Grenzen (noch) zulässiger Strafverteidigung zur (schon) unzulässigen Strafvereitelung zeigen sich sowohl beim Umgang mit dem Mandanten, als auch bei der Beschaffung und Verwendung persönlicher oder sachlicher Beweismittel und schließlich in der Ausübung oder Überschreitung prozessualer Rechte der Verteidigung.