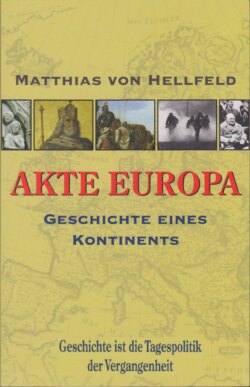Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deutschland und Frankreich
ОглавлениеFrankreich ist seit der Aufteilung des Frankenreichs von Karl dem Großen eine Monarchie. Seit 786 herrschen die Karolinger, die 996 von den bis 1328 regierenden Kapetingern abgelöst werden. Dann folgt das Haus Valois, dessen Regentschaft 1589 endet und von den Bourbonen beerbt wird. Deren letzter Regent ist der berühmt gewordene Ludwig XVI. - seinem Leben wird ein Fallbeil der französischen Revolution 1792 das Ende bereiten. Es folgt Napoleon Bonaparte auf dem Kaiserstuhl, bis die Bourbonen noch einmal von 1814 bis 1848 die französische Monarchie fortsetzen. Den Schlusspunkt markiert Napoleon III., dessen Abdankung 1870 auch das Ende der Monarchie in Frankreich bedeutet. Seither ist das Land eine Republik. Frankreich ist also bis zum Beginn der Republik von fünf Familien regiert worden.
Ganz anders sieht das in Deutschland aus. Hier streiten sich in den Jahrhunderten nach Karl dem Großen die Fürsten und Herzöge um den Königsthron und verhindern damit die Herausbildung einer erblichen Monarchie. Nach den Karolingern regieren die sächsischen Herzöge, ihnen folgen im 11. Jahrhundert die Franken und Salier. Während des 12. Jahrhunderts sind die Schwaben an der Reihe. Das 13. Jahrhundert folgt das „Interregnum“ - in dieser Zeit kann sich keiner der Anwärter auf die Krone gegen seine Konkurrenten längerfristig durchsetzen. Daran anschließend wird das deutsche Reich von einem Luxemburger und dessen Söhnen aus Prag regiert. Erst ab 1438 wird die Kaiserkrone durch eine lange Regierungszeit Friedrichs III. erblich. Der letzte deutsche Kaiser, der dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ vorsteht, ist Franz II. – und der ist Österreicher. Mit der Reichsgründung durch Otto von Bismarck im Januar 1871 wird die kaiserliche Monarchie in dem Moment noch einmal aufgelegt, als sie in einigen anderen Ländern gerade abgeschafft wird. Mit der wenig ruhmvollen Abdankung Wilhelm II. im Jahr 1919 endet die kaiserliche Zeit auch in Deutschland.
Der Streit um die Vorherrschaft zwischen weltlicher und geistlicher Macht wird nach zähen Verhandlungen am 23. September 1122 auf den Lobwiesen bei Worms vertraglich geregelt. In einer als „Wormser Konkordat“ bekannt gewordenen Urkunde befreit Papst Kalixt II. den Kaiser vom Kirchenbann, gestattet ihm die Anwesenheit bei Bischofs- und Abtwahlen, erlaubt die Belehnung der vom Papst erwählten Würdenträger und sichert ihm begrenzte Einflussmöglichkeiten bei strittigen Wahlen zu. Kaiser Heinrich V. muss aber die von seinem Vater konfiszierten Kirchengüter zurückgeben und obendrein garantieren, dass er der römischen Kirche „getreulich“ beistehen werde. Damit ist die römische Kurie eine reiche und mächtige Organisation geworden, denn nun ist sie (wieder) Eigentümerin der über das ganze Land verteilten Bistümer. Das Privileg ist nicht nur an Papst Kalixt II. gerichtet, sondern an die „heilige römische Kirche“ im Allgemeinen. Damit gilt der militärische Beistand des deutschen Kaisers nicht nur für Heinrich V., sondern auch für alle seine Nachfolger.