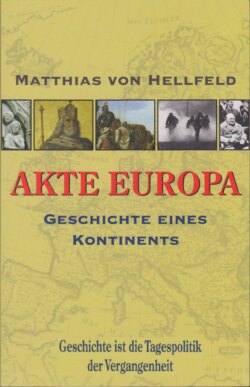Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die „goldene Bulle“
ОглавлениеDie starken Fürsten haben erstritten, dass der deutsche König von ihnen gewählt wird. Das Wahlentscheidende kurfürstliche Kollegium setzt sich aus den drei geistlichen Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier und ihren weltlichen Kollegen aus Böhmen, Sachsen, Kurpfalz und Brandenburg zusammen. Dieses Gremium ist mit Angehörigen des Klerus und des Adels nahezu paritätisch besetzt – ein kluger Schachzug, wie sich bei den Verhandlungen mit Kaiser Karl IV. über ein entsprechendes Verfassungsdokument herausstellt. Dieses mit dem zur Depression neigenden Kaiser verabredete Dokument ist das bis dahin wichtigste Gesetz des deutschen Reiches, es hat den Charakter eines Grundgesetzes und wird bis 1806 seine Gültigkeit behalten. Die wegen des goldenen Königssiegels so genannte „Goldene Bulle“ des Jahres 1356 legt fest, dass bei einer Königswahl das Mehrheitswahlrecht gilt. Da es dank dieser Regelung immer ein Wahlergebnis geben muss, sind innerdeutsche Kriege um die Thronfolge ebenso ausgeschlossen wie die Erhebung eines Gegenkönigs. Durch die Einführung des Mehrheitsprinzips wird außerdem eine lähmende Pattsituation vermieden, die Vakanzen auf dem Königsthron nach sich ziehen würde. Damit ist verhindert, dass eine Königswahl in Deutschland zum Tummelplatz ausländischer Interessen wird. Mit der „goldenen Bulle“ ist aber auch garantiert, dass es immer einen König geben wird, dem nach seiner Wahl in Frankfurt und seiner Krönung in Aachen das Anrecht zusteht, vom Papst zum Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ gekrönt zu werden. Der Papst kann in Zukunft nicht mehr selbst entscheiden, ob er einen deutschen König zum Kaiser krönt. Dafür hat er aber über „seine“ geistlichen Kurfürsten direkten Zugang zu der sehr viel wichtigeren Entscheidung – nämlich wer deutscher König wird!
Neben der Befriedung des Verhältnisses zwischen Kaisern und Päpsten bedeuten diese Regelungen, dass es in Zukunft keine „könig- oder kaiserlosen“ Zeiten mehr geben wird. Die Kurfürsten lassen sich diese Zusicherung gut bezahlen. Sie erhalten ein eigenständiges Münz- und Zollrecht, dürfen unbeschränkt Gebiete erwerben und ihr kurfürstliches Wahlprivileg vererben. Die ohnehin schon mächtigen Territorialfürsten, deren so genanntes Kurland fortan nicht mehr geteilt werden darf, weiten ihre Macht noch dadurch aus, dass sie die kaiserlichen Machtbefugnisse an die Zustimmung eines Reichstags binden, ohne den der Kaiser nahezu nichts entscheiden kann. Der Reichstag, in dem neben den Landesherren auch die Reichsstädte vertreten sind, entscheidet über Krieg und Frieden ebenso wie über Steuern. Mit diesem System kann der weitere Zerfall des Landes zwar aufgehalten werden, aber die äußere Macht des deutschen Reichs bleibt begrenzt. Die eigentlichen Herrscher sind nicht die Könige sondern die Kurfürsten. Während sich mit der „Goldenen Bulle“ des Jahres 1356 in Deutschland eine Stabilisierung der politischen Verhältnisse zu Gunsten der Kurfürsten abzeichnet, gerät die mittelalterliche Welt des 14. Jahrhunderts durch drei weitere Ereignisse in Turbulenzen, deren Folgen sich für die Menschen in Europa verheerend auswirken.