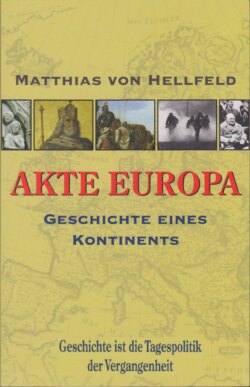Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Investiturstreit
ОглавлениеWie wichtig dem Papst diese Veränderungsabsichten sind, kann man einem Papier entnehmen, das den beunruhigenden Titel „dictatus papae“, also „Diktat des Papstes“, trägt. Der Text findet sich im päpstlichen Briefregister, ist aber nicht veröffentlicht worden. Es könnte also sein, dass es sich lediglich um das Gedächtnisprotokoll einer Sitzung im März 1075 handelt, bei der im Vatikan die weitere Vorgehensweise Gregors VII. besprochen worden ist:
„3. Er (der Papst) allein kann Bischöfe absetzen und wieder einsetzen.
7. Er allein darf nach Maßgabe der Zeitumstände neue Gesetze erlassen, neue Völker vereinen, aus einer Kanonie eine Abtei machen und umgekehrt, ein reiches Bistum teilen und arme zusammenlegen.
8. Ihm allein steht die Verfügung über die kaiserlichen Insignien zu.
9. Einzig des Papstes Füße müssen alle Fürsten küssen.
12. Er kann den Kaiser absetzen.
18. Sein Urteilsspruch kann von niemand aufgehoben werden, während er allein alle anderen Urteile aufheben kann.
27. Er kann die Untertanen von der Treue gegen Böse entbinden.“
Dieses „päpstliche Diktat“ ist ein Frontalangriff auf Heinrichs IV. weltliche Herrschaft. Als geradezu ungeheuerlich muss er den universalen Anspruch des Papstes aufnehmen, den „Kaiser absetzen und die Untertanen von ihrem Treueschwur entbinden“ zu können. Das kann sich er auf keinen Fall gefallen lassen, weil damit die Grundfeste seiner Herrschaft erschüttert werden. Wer ihn absetzen und seine Untertanen vom Treueschwur befreien kann, ist mächtiger als er selbst und legt obendrein Hand an die Grundlagen der Reichsordnung. Damit ist für Heinrich IV. klar, wohin die Reise gehen soll – nämlich in die Unterordnung des Kaiser- oder Königtums unter die Macht des Vatikans und deshalb spitzt sich der Konflikt unaufhaltsam zu.
Heinrich IV. bekommt die praktischen Auswirkungen dieses päpstlichen Griffs nach der Macht unmittelbar zu spüren. Als er in Mailand und im Kirchenstaat Bischöfe einsetzt, provoziert er den Papst und der Konflikt eskaliert innerhalb kurzer Zeit. Im Dezember 1075 bedroht Gregor VII. den König mit dem Kirchenbann. Damit fordert er Heinrich IV. heraus und wirft zudem jenen Glaubensbrüdern im deutschen Episkopat den Fehdehandschuh auf den Tisch, die sich mit dem geistlich-weltlichen System von Geben und Nehmen bestens arrangiert haben. Nicht weniger besorgt sind die deutschen Kirchenmänner über die strikte (Wieder-) Einführung des Zölibats, da sie sich auch auf diesem Sektor den weltlichen Genüssen durchaus zugewandt zeigen. Auf einer von zahlreichen Bischöfen besuchten Synode in Worms beschließen die Versammelten am 10. Januar 1076 dem Papst den Gehorsam aufzukündigen. Sie richten ein Schreiben an den „falschen Mönch Hildebrand“ und fordern diesen auf, den Stuhl Petri unverzüglich zu verlassen. Jener nahezu vergnüglich zu lesende Brief ist uns überliefert in der „Weltchronik“ des Abtes Ekkehard von Aura:
„Als du dich in die Leitung der Kirche eindrängtest, waren wir uns zwar darüber klar, welches verbotenen und frevelhaften Unterfangens gegen Recht und Gerechtigkeit du dich mit der dir eigenen Anmaßung erfrechtest, doch glaubten wir stillschweigend über deinen schlimmen Amtsantritt in der Hoffnung hinweggehen zu sollen, dass der so verbrecherische Anfang im Lauf einer tüchtigen und eifervollen Regierung ausgeglichen werden könnte. (…) Du hast durch bittere Spaltungen die Brandfackel der Zwietracht in die römische Kirche hineingeworfen und hast diesen Brand mit deinem rasenden Wahnsinn durch alle Kirchen Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens auflohen lassen, indem du ruchlose Neuerungen einzuführen bestrebt bist und dich in unerhörter Überhebung aufblähst. (…) und so ging durch deine berühmten Erlasse – nur unter Tränen kann man davon sprechen – Christi Namen fast zugrunde. (…) Weil wir dies schlimmste der Übel nicht mehr länger dulden wollen, so fassten wir in gemeinsamer Berufung den einmütigen Beschluss, dir kundzutun, was wir bislang verschwiegen haben. Du kannst darum weder jetzt dem Apostolischen Stuhl vorstehen, noch wirst Du dies je können. (…) Nachdem du deinen Lebenswandel durch so vielerlei Schmach und Schande entehrt hast, werden wir (…) künftig nicht gehorchen, und weil, wie du öffentlich erklärt hast, keiner von uns für dich Bischof war, so wirst auch du für keinen von uns von nun ab Papst sein.“
Das ist starker Tobak. Der Zorn des deutschen Episkopats über die vielen Neuerungen, die der Papst gegen ihren Willen durchsetzen will, spricht Bände. So lassen die Folgen dieses Briefes nicht lange auf sich warten. Denn nach der Lektüre des Schreibens ergreift der Papst die nächste Stufe der Eskalation und erklärt den König gemäß seines „dictatus papae“ für abgesetzt und exkommuniziert. Damit ist etwas für die mittelalterliche Welt Unerhörtes geschehen. Noch nie hatte sich ein Papst so unmissverständlich in die Belange der weltlichen Herrschaft eingemischt, noch nie hatte ein Papst öffentlich einen weltlichen Herrscher so degradiert und gedemütigt und ihn auch noch aus der Kirche geworfen. Mehr noch: Noch nie hatte ein Papst so unüberhörbar zum Ausdruck gebracht, dass die geistliche über der weltlichen Macht zu stehen habe - und nicht umgekehrt.
Der Streit mit dem Papst zeigt Wirkung: Einige Fürsten in Sachsen und Süddeutschland sowie ein Teil der Bischöfe nutzen die Gunst der Stunde und fallen vom König ab, dessen Position nun höchst unerfreulich zu werden beginnt. Die Fürstenopposition – unter ihnen Welf von Bayern, Rudolf von Rheinfelden und Berthold von Kärnten - wittert eine Möglichkeit, sich selbst ins Spiel zu bringen und fordert Heinrich IV. auf, binnen „Jahr und Tag“, also in den nächsten zwölf Monaten, die Aufhebung des päpstlichen Bannes zu erreichen. Andernfalls müsse ein neuer König gewählt werden. Nun bleibt Heinrich IV. keine andere Wahl mehr, als zum Bußgang anzutreten.
Doch er hat die Rechnung ohne die grimmige Entschlossenheit der Fürsten gemacht, die ihn unter allen Umständen abzusetzen trachten. Ohne den König zu informieren, laden sie Gregor VII. nach Augsburg ein, wo er über das Schicksal Heinrichs IV. letztinstanzlich entscheiden soll. Ein durchsichtiger Plan, denn welche Entscheidung würde der Papst wohl treffen? Das Datum der Veranstaltung, auf der nichts anderes als die Absetzung Heinrichs IV. beschlossen werden soll, ist der 2. Februar 1077. Gregor VII. macht sich sofort auf den Weg von Rom nach Süddeutschland, denn diesen Termin will er sich keinesfalls entgehen lassen. Zur gleichen Zeit - aber in umgekehrter Richtung - bricht auch Heinrich IV. auf. Mit kleinem Gefolge überquert er die Alpen, um zum Papst zu gelangen. Diesen höchst beschwerlichen Gang hat der Mönch Lampert von Hersfeld festgehalten:
„Als er (Heinrich IV.) unter den größten Fährlichkeiten den Gipfel des Mont Cesius erstiegen hatte, konnte man zunächst nicht weiterkommen, weil sich der Berg jäh senkte und der Abstieg infolge des glatten Eises völlig unmöglich schien. Mit allen Mitteln suchten die Männer die Gefahr zu überwinden. Bald kroch man auf Händen und Füssen, bald stützte man sich auf die Schultern der Führer, bald verlor man auf dem glatten Boden jeden Halt, fiel und rutschte ein Stück ab, bis man endlich unter schwerer Lebensgefahr zur Ebene hinab kam. Die Königin und die Frauen ihres Gefolges zog man auf Ochsenhäuten den Berg hinunter. Die Pferde ließ man teils auf Schlitten herab, teils band man ihre Beine zusammen und zog sie herunter, wobei viele umkamen, andere schwere Schäden erlitten, nur ein kleiner Rest entkam heil der Gefahr.“
In der Emilia Romagna in der Nähe von Modena kommt es zum Show-down im Schnee. Gregor VII. erfährt von der kaiserlichen Gewalttour und lässt sich von seiner Reisebegleiterin Mathilde von Tuszien überreden, Heinrich IV. zu empfangen. Ort des Geschehens am 28. Januar 1077 ist die Burg Canossa, die der wohl zu Unrecht als päpstliche Konkubine denunzierten Mathilde gehört. Dort legt Heinrich IV. seinen Eid ab, nachdem er im Büßergewand ohne königlichen Schmuck drei Tage barfuss im Schnee seine offensichtliche Reue dargeboten haben soll. Der Papst befreit ihn vom Bann und nimmt den König wieder in die Kirchengemeinde auf. Das ist zweifellos ein demütigender Augenblick für den König, der durch seinen Bußgang der Oberaufsicht des Papstes über die weltliche Herrschaft zustimmt und dem königlichen Ansehen schweren Schaden zufügt. Mit seiner Unterwerfung akzeptiert Heinrich IV. die päpstliche Strafgewalt nicht nur über sich, sondern auch über sein Amt, womit auch der Anspruch erlischt, dass seine weltliche Herrschaft unmittelbar von Gott gegeben ist. Aber es bleibt ihm keine andere Wahl, denn ohne seinen inzwischen sprichwörtlichen „Gang nach Canossa“ hätte er gegen die heimische Fürstenopposition keine Chance mehr gehabt. Heinrich IV. wird durch den Reformeifer des Papstes eine schmähliche Niederlage beigebracht und seine Position gegenüber den Fürsten und Herzögen des Reiches ist nachhaltig geschwächt.
Ganz anders verhält es sich bei seinem französischen Amtskollegen Philipp I.. Der sieht den apostolischen Reformen gelassen entgegen, weil seine Vorgänger sich sehr viel weniger in kirchliche Belange eingemischt haben und es deshalb auch weniger gegenseitige Abhängigkeiten gibt. Nur in gerade mal zwei Dutzend Fällen beeinflusst der französische König die Wahl von Bischöfen und diese besitzen keinen so großen Einfluss wie in Deutschland. Philipp I. stimmt den tief greifenden Reformen der Kirche in seinem Reich leichten Herzens zu, weil seine Interessen auch ohne einen direkten Einfluss auf die Wahl von Geistlichen durch einen bischöflichen Treueeid gewahrt sind.
Da wird Heinrich IV. neidisch über die Ufer des Rheins geblickt haben, denn für ihn kommt es noch schlimmer. Trotz der Aufhebung des Bannes wird sechs Wochen später, am 15. März 1077, in Forchheim bei Nürnberg Rudolf von Rheinfelden von den anwesenden Territorialfürsten zum Gegenkönig gewählt. Und bei dieser Auseinandersetzung kann Heinrich IV. wieder fest mit einem Gegner rechnen: Gregor VII.. Der Papst schlägt sich auf die Seite von Rudolf, erneuert den gerade aufgehobenen Bann gegen König Heinrich IV., setzt ihn zum zweiten Mal ab und löst den Treueeid seiner Untertanen erneut auf. Doch Rudolf von Rheinfelden stirbt Mitte Oktober 1080 in der Schlacht von Hohenmölsen, sodass die Opposition für einen Moment kopflos ist. Das nutzt Heinrich IV., bricht sofort nach Rom auf und belagert die Stadt drei Jahre lang. 1083 setzt er seinerseits Gregor VII. ab und setzt auf der Synode von Brixen einen gewissen Wibert von Ravenna als Clemens III. auf den apostolischen Stuhl in Rom. Von Clemens III. lässt sich Heinrich IV. Ende März 1084 zum römischen Kaiser krönen. Damit scheinen sich die Ereignisse für Heinrich IV. doch noch zum Guten gewendet zu haben. Aber der im Jahr zuvor seines Amtes enthobene Gregor VII. bekommt 1084 Hilfe vom Heer des Robert Guiskard, unter dessen Führung sich die Normannen in Sizilien festgesetzt, die päpstliche Lehnshoheit über das Land aber anerkannt hatten. Beim Anblick der Truppen des Normannenherzogs ziehen sich die kaiserlichen Bataillone Heinrichs IV. aus Rom zurück. Bald stellt sich jedoch heraus, dass die als Befreier des abgesetzten Papstes herbeigesehnten Truppen lieber die Stadt plündern als sie zu verteidigen. Zum Entsetzen Gregors VII. verkehrt sich sein Plan ins Gegenteil. Wie einst der römische Kaiser Nero steckt Guiskard die halbe Stadt in Brand und zieht unbekümmert von dannen, nicht ohne Gregor VII. mitzunehmen. In Salerno lässt der Normannenfürst den ehemaligen apostolischen Oberhirten laufen, wo er am 25. Mai 1085 frustriert stirbt.