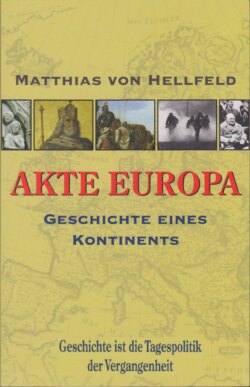Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Erneuerung des Römischen Reichs
ОглавлениеDie in der Zeit Ottos des Großen wichtigste politische Theorie geht von der Vorstellung aus, dass die Herrschaft über die zivilisierte Welt von dem vor rund 450 Jahren untergegangenen Römischen Imperium erst auf die Franken und in deren Nachfolge auf die Sachsen, zu denen Otto der Große gehört, übergegangen ist. Mit der Krönung Karls des Großen durch Papst Leo III. im Jahr 800 sei auch die Kaiserwürde des alten römischen Reiches auf den fränkischen König übergegangen. Das ist die so genannte „translatio“, also die „Übertragung“. Die Kaiserkrönung des Jahres 962 wiederholt und erneuert diesen Vorgang. Das ist die so genannte „renovatio“, also die „Erneuerung“. „Übertragung“ und „Erneuerung“ sind die beiden ideologischen Begriffe, mit denen Otto I. sein hohes Amt antritt. Seine Kaiserwürde liegt in der direkten Tradition des römischen Kaisertums und als römischer Kaiser steht Otto I. an der weltlichen Spitze der „christianitas“ – der Christenheit. Er ist der Beschützer des Abendlandes vor den Angriffen der „Heiden“ und der Motor der Christianisierung des europäischen Kontinents.
Ausgestattet mit der Machtfülle eines Kaisers will Otto I. ein geeintes Europa unter dem Zeichen des Kreuzes schaffen – Kolonisation und Mission gehen fortan Hand in Hand. Dazu gehört auch der Versuch, den Süden Italiens – die Fürstentümer Benevent, Capua und Salerno – zu erobern. Nachdem dies misslingt, kehrt der mittlerweile 60jährige ins Reich zurück und betreibt die Errichtung eines Bistums in Prag, um die Ostexpansion des christlichen Europas voranzutreiben. Das ist seine letzte Tat, denn Otto der Große stirbt am Abend des 7. Mai 973 an den Folgen einer fiebrigen Erkältung. Er stirbt mit der Vorstellung, dass die Verbindung der deutschen mit der römischen Kaiserwürde segensreich für alle Beteiligten ist. Doch schon die spätere Regentschaft seines Enkels Ottos III. zeigt, dass der Spagat zwischen einer deutschen und einer römischen Kaiserschaft nicht beiden Seiten gerecht werden kann.
996 wird jener Otto III. in Rom von Papst Gregor V. zum Kaiser gekrönt. Doch keine 12 Monate später fällt Gregor V. einer Intrige zum Opfer und wird von einem Gegenpapst gestürzt. Otto III. muss in Rom einmarschieren, um dem legitimen Papst wieder auf den Heiligen Stuhl zu helfen. Offenbar ist er so angetan von Rom und seiner prunkvollen Schönheit, dass er der Idee verfällt, dort eine Kaiserpfalz zu errichten. Rom ist der Mittelpunkt seines Weltbildes. Von Rom aus will er das Reich regieren. Hier soll das künftige Zentrum der von ihm vereinigten geistlichen und der weltlichen Macht errichtet werden. Die „renovatio imperii Romani“ („Wiederherstellung des Römischen Reiches“) soll durch ihn ins Werk gesetzt werden, so jedenfalls plant es der Kaiser. Otto III. möchte – ebenso wie der Papst – als irdischer Vertreter des Apostelfürsten gelten und lässt sich als „servus apostolorum“ („Diener der Apostel“) ansprechen. Damit beansprucht er das oberste Verfügungsrecht über den Kirchenstaat und macht deutlich, dass er sich als Nachfolger eines römischen Kaisers aus der Blütezeit des untergegangenen Römischen Reiches sieht.
Otto III. will seine weltanschaulichen Ideen verwirklichen, aber sein Tod im Jahr 1002 beendet das Vorhaben, bevor er richtig damit angefangen hat. Die „deutsch-italienischen“ Kaiser stehen vor einem Problem: Die Italienpolitik wird nicht nur viel Energie und Zeit, sondern auch immense finanzielle Aufwendungen erfordern. Bis ins hohe Mittelalter werden sie immer wieder gezwungen sein, mit Streitkräften nach Italien zu ziehen und die politischen Ränkespiele ihrer Tage zu ordnen. Das wird ihr Interesse von dem Teil des Reiches ablenken, dem sie eigentlich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten: dem Deutschen Reich.
Das gefestigte Verhältnis zwischen Papst und Kaiser fügt sich harmonisch in das Weltbild des 11. Jahrhunderts. Der Papst ist der alleinige Interpret der göttlichen Vorstellungen, der Kaiser herrscht von Gottes Gnaden und mit päpstlichem Segen, um in einer gewalttätigen Welt für Ordnung zu sorgen. Der Papst, als Vertreter der geistlichen Welt und sein weltliches Pendant, der Kaiser, stellen eine Symbiose dar. Beide sind im Verständnis der Zeitgenossen Figuren einer von Gott gewollten Weltordnung, der sich niemand widersetzen kann. Für beide stehen das jeweilige Amt und das damit verbundene Ansehen auf dem Spiel und beide verlieren an Bedeutung und Einfluss, wenn sie den Pakt zwischen weltlicher und geistlicher Macht brechen. Und schließlich müssen in dieser mittelalterlichen Zeit auch die Vorstellungswelten der Menschen befriedigt werden. Ein europäisches - was entsprechend der Kenntnis über das Ausmaß der Welt gleichbedeutend ist mit einem „universalen“ – Kaisertum hat für die Zeitgenossen große Anziehungskraft. Diese überirdische Ordnungsmacht liefert ihnen das Koordinatensystem, an dem sie ihr eigenes „kleines“ Leben ausrichten können.
Aus dem einen Teil des Vielvölkerstaats von Karl dem Großen ist in der östlichen Hälfte ein eigener Vielvölkerstaat geworden, der sich in der Zukunft als schwer regierbar erweist. Das Reich wird durch Zugewinne zwar immer größer und der deutsche Kaiser ist der mächtigste Herrscher in Europa. Aber die politischen Möglichkeiten, das Reich zusammen zu halten, wachsen nicht in gleichem Maße. Die militärische Herrschaft über Italien ist schwer zu halten und die kaiserliche Macht muss weite Teile ihres Einflusses an die immer stärker werdenden Fürsten und Herzöge abtreten.
In der Mitte des 11. Jahrhunderts ist noch eine Entscheidung gefallen: Europa wird christlich geprägt sein. Einzig in Süditalien, in Spanien und in einem kleinen Teil Frankreichs behindern muslimische Besetzungen das weitere Vordringen des Christentums. Spanien wird in den kommenden Jahrhunderten – ausgehend von der Grenzmark Karls des Großen – Stück für Stück „zurückerobert“. In Sizilien ist die nicht-christliche Herrschaft ebenfalls zeitlich begrenzt und die „heidnischen“ Normannenherzöge, die den Nordwesten Frankreichs okkupiert haben, nehmen den christlichen Glauben an. Der Vatikan als das ideologische Zentrum der Christenheit spielt in der europäischen Geschichte eine bedeutende Rolle. Auch wenn es in Europa oft genug ganz und gar unchristlich zugeht, sind christliche Moralvorstellungen und Traditionen das gemeinsame Bindeglied aller Mitglieder der europäischen Völker.
Wenn die christliche Kirche am Beginn des 11. Jahrhunderts das nach ihr benannte Abendland prägt, was ist dann mit dem Rest der damals bekannten Welt? Soll auch dort der lange Arm des Vatikans hinreichen oder findet man ein Auskommen mit den Anhängern Mohammeds, die herablassend als „Heiden“ abqualifiziert werden? Kann die geistliche Macht Könige und Kaiser veranlassen, gegen die Muslime in einen Krieg zu ziehen, um die frohe Botschaft der Bibel auch bei denen zu verkünden, die offensichtlich nichts davon wissen wollen? Fragen, die das Schicksal Europas für mehrere Jahrhunderte bestimmen und Millionen Menschen das Leben kosten wird. Denn die Antworten werden nicht in einem akademischen Disput gefunden, sondern in blutigen Schlachten.
Immer wieder versuchen die Päpste politische, also weltliche Macht an sich zu reißen und auszuüben. Das führt zwangsläufig zu einigen Fragen, die nun ebenfalls beantwortet werden müssen: Wer hat wirklich das Sagen in Europa? Ist es der Papst oder ist es der Kaiser? Welchen Einfluss kann die weltliche Macht der geistlichen zubilligen, ohne sich überflüssig zu machen? Und umgekehrt: Wie viel weltlicher Einfluss auf die Entscheidungen der Kirche ist dem Ansehen des Papstes noch zuträglich? Die Suche nach den Antworten beginnt in Goslar am 11. November des Jahres 1050…