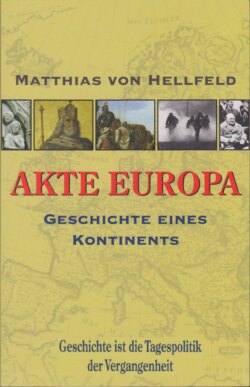Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Karolinger
ОглавлениеÜber das Geburtsjahr Karls sind sich die Historiker nicht ganz einig; fest steht, dass er zwischen 740 und 750 geboren wird. Seinen jüngeren Bruder Karlmann kann er nicht ausstehen und als beide Brüder nach dem Tod ihres Vaters Pippin III. Könige werden, halten sie möglichst großen Abstand zwischen sich. Der frühe Tod seines Bruders Karlmann nährt seit je her die Spekulation, Karl habe ihn ermorden lassen. Wie auch immer: Karl sichert sich nach dem Tod seines Bruders die Alleinherrschaft und schiebt – eine damals gern gewählte Methode - dessen Familie in ein möglichst weit entfernt gelegenes Kloster ab. Karl spricht den althochdeutschen, fränkischen Dialekt, der schon zu seiner Zeit als „lingua theodisca“ („Sprache des Volkes“) oder „deutsch“ bezeichnet wird. Zudem spricht er fließend Latein und etwas weniger flüssig auch Griechisch. Lesen und Schreiben gehören nicht zu seinen Stärken, dafür hat er seine Leute – zum Schreiben und zum Vorlesen.
Der Frankenkönig ist um die Jahrhundertwende zweifellos der mächtigste Mann in Europa. Kaum ein Stammesherzogtum kann seinem Ansturm widerstehen. In vielen, grausamen Schlachten unterwirft der Franke alles, was um sein eigenes Stammland versammelt ist: Die Langobarden, die Bayern, die Awaren, auch Friesland werden nach brutalen Kämpfen gegen sie in das fränkische Herrschaftsgebiet eingegliedert. Einzig die Sachsen machen ihm Schwierigkeiten: Die Kriege mit ihnen dauern bis 804. Die Sachsen werden von ihrem Herzog Widukind angeführt, der dem Frankenkönig an der Ostgrenze seines Reiches schwere Verluste zufügt. Der blutige Höhepunkt der fränkisch-sächsischen Kriege findet im Jahr 782 statt, nachdem sächsische Heere im fränkischen Grenzgebiet schwere Verwüstungen angerichtet haben. Als Revanche lässt Karl in Verden an der Aller nahezu 5.000 sächsische Krieger hinrichten. Diese wahnsinnige Bluttat bringt ihm später den Namen „Sachsenschlächter“ ein. Nachdem ihr Widerstand 804 endgültig gebrochen ist, werden auch die Sachsen Teil des fränkischen Reiches von Karl dem Großen.
Karl ist der Enkel von Karl Martell, der später mit dem schmückenden Beinamen „der Hammer“ versehen wird, weil jener Karl Martell in einer opfervollen Schlacht bei Tours und Poitiers im Jahr 732 arabische Heerscharen geschlagen und so das Frankenreich vor einer muslimischen Eroberung bewahrt hat. Zum ersten Mal verwendet 732 ein unbekannter Chronist dieser Schlacht den Begriff Europäer für die Streitmacht Karl Martells. Die „europenses“, so berichtet er, hätten die muslimischen Invasoren, die sich von Spanien nach Aquitanien und in die Provence vorgekämpft hatten, in die Flucht geschlagen und seien anschließend wieder in ihre verschiedenen „patriae“, also Heimatländer, zurückgegangen. Auch wenn Franken, Sachsen und Bayern oder Alemannen, Burgunder und Aquitanier sonst nicht viele Gemeinsamkeiten haben und sich kaum kennen, identifizieren sich die Bedrohten als Angehörige einer Gruppe – als Europäer. Der Chronist hat festgehalten, was die Menschen in der Mitte des europäischen Kontinents noch viele Jahrhunderte kennzeichnen wird: Sie verstehen sich als Thüringer, Sachsen oder Franken und nicht als „Deutsche“.
Wahrscheinlich gehört die Schlacht bei Tours und Poitiers im Jahr 732 zu den bedeutendsten des Jahrhunderts, weil sie das weitere Vordringen der Erben Mohammeds ins Frankenreich verhindert. Muslimische Heere haben sich im 7. und 8. Jahrhundert im Mittelmeerraum, in Syrien, in Ägypten, in Spanien und Teilen Afrikas festgesetzt. Ihr Einbruch in die christliche Welt Europas und in den von der mächtigen Stadt Konstantinopel beherrschten asiatischen Raum hat zu einer neuen Mächtekonstellation geführt, in der die Kalifate von Bagdad und Kairo zu einer Bedrohung für die christliche Welt geworden sind. 732 jedenfalls gilt Karl Martell als „Retter des Abendlandes“ offensichtlich in der Annahme, dass ein muslimisches Europa die schlechtere Alternative ist. Er ist nicht der letzte europäische Feldherr, der gegen die „Ungläubigen“ – wie es die christliche Lehre verkündet – zu Felde zieht. Seine Heldentaten machen ihn zum unumstrittenen Anführer der Franken. Karl der Hammer verleibt seinem Reich anschließend noch diverse rechtsrheinische Stammesgebiete ein, sodass er seinem Sohn Pippin III. ein ziemlich machtvolles, aber noch nicht so großes Reich vererben kann. Groß wird das Reich erst, als jener Pippin III. einen in seinen Augen unfähigen Merowinger vom Königsthron stürzt und so das Frankenreich vereinigt.
In der mittelalterlichen Gedankenwelt ist es für die weltliche Herrschaft unabdingbar, den geistlichen Segen zu erlangen – und dafür ist der Papst in Rom zuständig. So trifft es sich für Papst Stefan II. prächtig, dass Pippin III. die apostolische Legitimation durch das Oberhaupt der römischen Kirche wünscht und er sich deshalb an den fränkischen König mit einem Kuhhandel wenden kann. Er, der Papst, würde Pippin III. (und seine Söhne gleich mit) salben und ihm den Titel „patricius romanorum“ verleihen, wenn er, Pippin III., ihm Schutz gegen den Langobardenfürsten Aistulf gewährt. Angesichts der wilden Entschlossenheit der Langobarden, sich des Nordens der italienischen Halbinsel zu bemächtigen, sind die Sorgen des Papstes zu Recht groß, schließlich ist er verantwortlich für den Fortbestand einer angemessenen Repräsentanz seines Herrn auf Erden. Würde die Stadt Rom eingenommen und vielleicht noch einmal – wie bei den Vandalen im Jahr 455 – geplündert werden, könnte das Ende der religiösen Oberhoheit über das christliche Abendland eingeläutet sein.
Die apostolische Angst ist berechtigt, denn die Langobarden, die 741 Ravenna schon eingenommen haben, liegen nun – im Jahr 754 – mit ihren Truppen in bedrohlicher Nähe vor den Toren Roms. Der Verlockung des geistlichen Segens kann Pippin III. nicht widerstehen, sodass er dem besorgten Papst einen Feldzug gegen den langobardischen Fiesling Aistulf garantiert, den er in den folgenden Jahren auch erfolgreich durchführt. Diese Schutzvereinbarung, die 754 zwischen Pippin III. und Papst Stefan II. geschlossen wird, ist die „Pippinische Schenkung“. Nach erfolgreichen Schlachten gegen die Langobarden übereignet der fränkische König nämlich dem Papst die Städte Rom und Ravenna, sowie die so genannte Pentapolis, ein Gebiet in Mittelitalien zwischen Rimini und Ancona. Dieses bildet fortan den Kirchenstaat, der - immer wieder umkämpft – in seinen Restbeständen noch heute besteht. Ab 754 ist der fränkische König also de facto der Schutzherr des Papstes und erhält als Gegenleistung die Unterstützung des obersten Christen. Auf den ersten Blick ist das ein gelungener Coup für beide Seiten: Der Papst kann sich in Sicherheit wiegen und der König hat die Macht der Kirche für sich gewonnen.
Karl der Große – Gotteskrieger und Lebemann
Karl ist ein religiöser Mensch und akzeptiert die Vorstellung einer Einheit zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Das entspricht der Denktradition seiner Zeit, die die Welt von Gott geleitet sieht. Karls Kriege dienen dementsprechend einerseits seiner Machterweiterung, andererseits aber auch der Ausbreitung des Christentums. Zu diesem Zweck lässt er seine Gegner nach jeder gewonnenen Schlacht zwangsweise taufen. Karl ist ein regelrechter Gotteskrieger und strahlt auf die schlichten Gemüter seiner Zeitgenossen den Nimbus des Unbesiegbaren aus. Während er einerseits den religiösen Geboten gehorcht, lebt er privat durchaus weltlich. Karl ist verheiratet mit Hilmitrud und ehelicht gleichzeitig auf Betreiben seiner Mutter die langobardische Prinzessin Desiderata. Darüber hinaus erfreut er sich der Aufmerksamkeit vieler anderer so genannter „Friedelfrauen“. Solche Konkubinen sind in dieser Zeit des Mittelalters nicht ungewöhnlich. Derartige Verbindungen lassen sich unproblematisch auflösen, wobei die Partner wieder in den Schoß ihrer Familien zurückkehren. Der Mann hat lediglich für die Kinder einer solchen Nebenehe zu sorgen. Offensichtlich macht Karl von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch, denn nachdem er sowohl Hilmitrud als auch Desiderata verstoßen hat, werden noch drei weitere Ehen überliefert, die bedauerlicherweise alle mit dem Ableben der Frauen enden. Karl ist kein Kind von Traurigkeit und Politik ist nicht alles in seinem Leben. Das Leben wird für Karl auch zudem gewisse Freuden bereitgehalten haben, weil er die uneingeschränkte Macht im Frankenreich hat und weil er diese für sich durchaus zu nutzen weiß.
Wenn man davon absieht, dass der Papst sich als oberster Christ und Stellvertreter des Herrn auf Erden fühlen darf, lebt Karls Gastgeber am 1. Weihnachtstag 800 eher spartanisch. Er sitzt in seinem Kirchenstaat wie ein Gefangener, ist abhängig von den jeweils herrschenden politischen Gegebenheiten in Oberitalien und sieht seinen Einfluss auf den europäischen Kontinent auf Grund dieser misslichen Lage zunehmend schwinden. Diesen Zustand haben auch schon seine Vorgänger beklagt, die nach dem Untergang des römischen Reiches – rund 350 Jahre zuvor - zwar die geistliche Vorherrschaft über den Kontinent beansprucht haben, aber niemanden um sich hatten, der diesem Anspruch auch die entsprechende weltliche Durchsetzungskraft zur Seite stellte. Als die Römer in der Antike noch weite Teile des europäischen Kontinents beherrschen, ist der Sitz des apostolischen Stuhls in Rom im Zentrum der weltlichen Macht angesiedelt und somit sicher. Seit sich aber der politische Schwerpunkt der Welt über die Alpen in nördliche Richtung verlagert hat, sitzen die Päpste abseits und beklagen dies lautstark. Mit dem Krönungscoup des Weihnachtsabends 800 hat sich diese missliche Lage schlagartig verbessert: Papst und Kaiser sitzen in einem Boot und stellen eine in der mittelalterlichen Welt unangreifbare Einheit dar. Der Papst wiegt sich in Sicherheit und der Kaiser herrscht über ein riesiges Reich, das zu regieren, ihn aber vor große Probleme stellt.