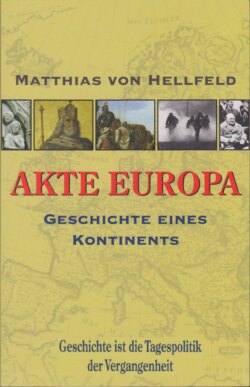Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Aufteilung des Frankenreichs
ОглавлениеDen Bürgern Straßburgs ist es in diesem eisigen 14. Februar 842 bange ums Herz als sie aus zwei Richtungen schwer bewaffnete Heere auf ihre schöne Stadt zukommen sehen. Das eine Heer wird angeführt von dem 37-jährigen König Ludwig. Jener Ludwig, der im Nachhinein „der Deutsche“ genannt wird, herrscht über den östlichen Teil des Frankenreichs. Das andere Heer steht unter dem Kommando seines erst 18-jährigen Stiefbruders Karl II., der „der Kahle“ genannt wird. Karl der Kahle ist Judiths Sohn und König von Westfranken. Die beiden Heere treffen sich auf einem Platz im Zentrum der Stadt. Zur Überraschung der Straßburger Bürger aber beginnt keine Schlacht sondern eine erstaunliche Zeremonie. Etwas langatmig und umständlich erklärt erst Ludwig den anwesenden Heerscharen, dass sein Bruder Lothar I. für das hohe Amt des Kaisers gänzlich ungeeignet sei. Seine angeblich unbezähmbare Streitsucht treibe die Teile des großen Frankenreiches auseinander und dieser Zustand sei nicht hinnehmbar. Deshalb wolle er hier und jetzt mit seinem Stiefbruder einen Eid ablegen, der beide untrennbar miteinander gegen das gemeinsame Bruderherz Lothar I. verbindet. Ludwig der Deutsche verwendet dabei „romana lingua“, aus der sich später die französische Sprache entwickelt. Karl II. schließt sich in der „teudisca lingua“, der Grundlage der deutschen Sprache, an. Beide leisten also in dem Dialekt des jeweils anderen den so genannten Straßburger Eid. Diesem Eid schließen sich die beiden Heere an, ohne den jeweils anderen Dialekt zu verstehen. Ein anwesender Geschichtsschreiber notiert, dass dies „der Eid der Völker“ gewesen sei. Und tatsächlich: Dieser 14. Februar 842 kann als die Geburtsstunde Deutschlands und Frankreichs gelten. Aus den beiden Teilen eines Reiches (von Karl dem Großen) werden im Laufe der nächsten Jahrhunderte die beiden Bruderstaaten Deutschland und Frankreich. Die heute so oft beschworene deutsch – französische Partnerschaft, die als Motor für die europäische Entwicklung unverzichtbar sei, hat ihre Wurzeln im frühen 9. Jahrhundert, als aus einem Reich zwei Teilreiche werden, die sich im Laufe der kommenden Jahrhunderte eigenständig entwickeln.
Die Straßburger Eide sind logische Konsequenz der politischen Umstände jener Jahre. Keiner der Nachfolger Karls des Großen hat das Format, ein derart großes Reich zu regieren. Die Erhaltung des Frankenreiches als eine politische und ökonomische Einheit, wie zur Zeit des großen Karl, stellt für seinen Sohn und vor allem für seine Enkel keinen erstrebenswerten Zustand dar. Sie sind eher an der eigenen Macht interessiert und sind - so betrachtet - Kinder ihrer Zeit. Die Erhaltung der fränkischen Einheit hätte vermutlich alsbald gezeigt, dass die bei Karl dem Großen noch integrierten Einzelinteressen der unterworfenen Stämme sehr schnell wieder an die Oberfläche gekommen und nach Eigenständigkeit gestrebt hätten. Die rasche Herausbildung unterschiedlicher Sprachen und der stabile Fortbestand der östlichen Herzogtümer (Sachsen, Thüringen, Kärnten, Bayern, Schwaben und Franken), die sich zum Teil in ihren damaligen Stammesgrenzen bis heute erhalten haben, sprechen ebenfalls gegen ein Gesamtreich.
In den folgenden Jahren jedenfalls werden Verträge geschlossen, die die Aufteilung Europas besiegeln und dem Kontinent ein bis heute erkennbares Gesicht geben. Im Vertrag von Verdun 843 erhält Ludwig der Deutsche das ostfränkische Reich, das an seiner westlichen Seite ungefähr durch den Lauf des Rheins, im Süden entlang einer Linie von Genf nach Chur und im Osten bei Regensburg, Magdeburg und Hamburg begrenzt ist. Die Mitte Europas wird Lothar I. zugeschlagen und reicht von Friesland über Lothringen, Burgund und die Lombardei nach Italien. Der Westen schließlich unter Karl dem Kahlen wird das westfränkische Reich, das in seinen Grenzen im Wesentlichen dem heutigen Frankreich entspricht. Aber dabei bleibt es nicht lange. 870 im Vertrag von Meersen wird der mittlere Teil, also die heutigen Benelux-Staaten, aufgelöst und in fast gleichen Teilen dem ost- bzw. westfränkischen Reich zugeschlagen.
Für einen kurzen Moment wird das Reich Karl des Großen unter der Regentschaft eines weiteren Karls, der wegen seiner Leibesfülle mit dem Beinamen „der Dicke“ prämiert wird, noch einmal auferstehen. Als sein Vater Ludwig der Deutsche 876 stirbt, folgt er ihm als König im Ostteil des Frankenreiches. Er beteiligt sich an der Unterwerfung mittelitalienischer Provinzfürsten, die mit Unterstützung der Sarazenen Papst Johannes VIII. an den Kragen wollen. Dieser revanchiert sich prompt mit der Kaiserkrone für den Verteidiger des „patrimonium petri“. Über Erbschaften und andere glückliche Umstände bekommt Karl III., der Dicke, ein paar Jahre später auch noch die Königswürde des westfränkischen Teils. Weil der dicke Karl an der Bekämpfung der Normannen scheitert, die unbarmherzig den Flussläufen folgend ins Landesinnere vorstoßen, brandschatzen und plündern, muss er 887 abdanken. Er wird seines Lebens nicht mehr froh und stirbt bald darauf. Die Todesursache ist allerdings umstritten. Während die einen auf Grund seiner Epilepsie von einem natürlichen Tod sprechen, halten es andere für einen glatten Mord. Einig ist man sich allein im Datum: 13. Januar 888.