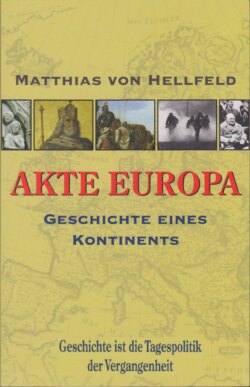Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Die Macht der Päpste 1050 - 1106
Оглавление... als ein weiterer Heinrich das Licht der Welt erblickt. Schon als Vierjähriger wird er auf Wunsch seines Vaters Kaiser Heinrich III. zum König gekrönt. 1055 verlobt sich das Kind – ebenfalls einem väterlichen Gebot gehorchend – mit Bertha von Turin, die sogar noch ein Jahr jünger als Heinrich IV. ist. Diese Verbindung mündet zwar 10 Jahre später in eine Ehe, bleibt aber zeitlebens eher von Abneigung als von Liebe erfüllt. Doch dem sechsjährigen Heinrich stehen nach dem frühen Tod seines Vaters im Oktober 1056 weitere Komplikationen bevor. Seine Mutter - Agnes von Poitou - führt als Vormund die Amtsgeschäfte für ihn, erweist sich aber als hoffnungslos überfordert. Das provoziert Begehrlichkeiten vor allem bei den sächsischen Fürsten, die das Machtvakuum für sich nutzen wollen. Die Fürsten verschwören sich gegen die Kaiserin – an ihrer Spitze der Kölner Erzbischof Anno II.
Jener Anno II. sorgt im Frühjahr 1062 für das bis dahin einschneidenste Erlebnis im Leben des inzwischen 12-Jährigen Königs Heinrich IV. Kurz nach Ostern bricht Heinrich IV. mit seiner Mutter nach St. Switbertswerth – dem heutigen Kaiserswerth bei Düsseldorf – auf, um an einem großen Fest teilzunehmen. Zur Überraschung der versammelten Gäste taucht auch der prunkvoll gekleidete Kölner Erzbischof mit seinem Gefolge auf. Kaum sind die offiziellen Feierlichkeiten vorbei, lädt der Erzbischof den königlichen Knaben auf eines seiner prächtigen Schiffe ein, das am Ufer des Rheins vor Anker liegt. Aber diese Einladung entpuppt sich rasch als Entführung, denn kaum hat Heinrich IV. das Boot betreten, legt es ab und steuert auf die Strommitte zu. Der verängstigte junge König hechtet über Bord und versucht schwimmend das Ufer zu erreichen. Seine Entführer ziehen ihn aber aus dem Wasser und verschleppen ihn ins nahe gelegene Köln. Kaiserin Agnes von Poitou muss die Szene hilflos vom Ufer verfolgen. Den Staatsstreich, den der Gottesmann vor ihren Augen inszeniert, kann sie nicht verhindern: Sie ist entmachtet und Anno II. Erzbischof von Köln führt die politischen Geschäfte im Reich.
Anno II. von Köln kann sich jedoch nicht lange an der so erworbenen Macht erfreuen, er gerät in ein Gemisch aus Intrigen und Denunziationen und wird schließlich von Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen abgelöst. Mit diesem Erzbischof kommt Heinrich IV. besser klar, denn als er im März 1065 endlich selbst regieren darf, bleibt Adalbert von Hamburg-Bremen als Berater an seiner Seite. Auf dem Reichstag zu Tribur im Januar 1066 wird er aber eines Besseren belehrt und von einigen Fürsten gezwungen, jenen Adalbert von Hamburg-Bremen aus dem Amt zu jagen, weil er andernfalls seiner Entmachtung entgegen sehen müsse. Die reale Macht des Königs der Deutschen existiert zwar – aber nur wenn die Fürsten einverstanden sind.
Die Regentschaft Heinrichs IV. steht unter einem ungünstigen Stern. Er hat kein eigenes Herzogtum mehr, da seine Mutter Agnes von Poitou bei ihrer Absetzung durch die Fürsten alle Besitztümer hatte abgeben müssen. Also lässt er neue Burgen bauen und versucht an Ländereien zu kommen, die ihm als Machtbasis dienen können. Derartige Schwierigkeiten sind auf der anderen Seite des Rheins im westfränkischen Teil des alten Karlsreiches weitgehend gebannt. Dort regiert mit Philipp I. ebenfalls ein Minderjähriger. Philipp I. wird als Siebenjähriger zu Pfingsten 1059 gekrönt, auch sein Vater stirbt früh, auch für ihn gibt es einen Vormund – den Grafen Balduin von Flandern. Sobald Philipp I. selbst regieren kann, beginnt er den königlichen Einfluss gegenüber den mächtigen Fürsten, die es auch westlich des Rheins gibt, auszubauen. Im Gegensatz zu Heinrich IV. gelingt es ihm, die Krondomäne, also das Gebiet, in dem er – der König – das Sagen hat, zu erweitern. Seine Nachfolger werden diesen Prozess fortführen und so den Grundstein für das zentralistisch organisierte Frankreich von heute legen. Außenpolitisch steht für Philipp I. die militärische Auseinandersetzung mit dem englischen Königreich ganz oben auf der Tagesordnung. Das wird die Politik der französischen Monarchie für viele Jahre prägen und verlustreiche Kriege für das Land nach sich ziehen. Philipps I. schwerste politische Bedrohung kommt also von außen und nicht von einer inneren Opposition, die ihm den königlichen Stuhl streitig machen will. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Heinrich IV. und dem deutschen Reich mit wesentlichen Folgen für die Entwicklung der beiden Staaten.