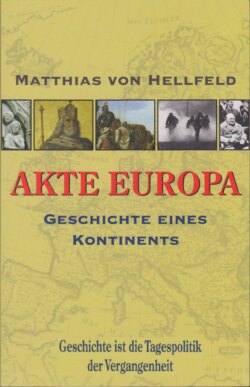Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 16
Italienische Verhältnisse
ОглавлениеAnders als im Osten und Westen kristallisiert sich im Süden des alten Frankenreiches kein halbwegs einheitliches Gebilde heraus. Ganz im Gegenteil: Sizilien wird von den Arabern erobert, spaltet sich vom restlichen Teil der Halbinsel nahezu ab und stellt bis weit ins 10. Jahrhundert hinein eine latente Gefahr für den italienischen Norden dar. Der Kirchenstaat gerät immer mehr in die Gewalt des oberitalienischen Adels. Zwischen 904 und 951 beherrscht die Familie des Herzogs Alberich II. von Spoleto den Kirchenstaat und damit auch die Papstwahlen, die nun zur lächerlichen Farce werden. In der später verfassten Geschichte der Päpste wird diese Zeit verächtlich als „Pornokratie“ bezeichnet. Wie korrekt diese erstaunliche Bezeichnung ist, verrät ein Blick in die Annalen der römischen Kurie. In den Augen der Chronisten wird der Vatikan in dieser Zeit von einem Hurengespann geleitet. Es handelt sich um ein Mutter-Tochter-Tandem, Theodora und Marozia, die beide Mätressen diverser Päpste sind. Die Geschichte des Papsttums verkommt in diesen Jahren zur Räuberpistole. Besonders hemmungslos wird der christliche Kodex unter Sergius III. mit Füßen getreten, der 904 mit Unterstützung des Herzogs Alberich II. von Spoleto einen Marsch auf Rom inszeniert und sich anschließend unter dem militärischen Schutz des Herzogs zum Papst weihen lässt. Diesem abstoßenden Machtgebaren folgt ein Blutrausch, dem seine beiden Vorgänger zum Opfer fallen. Sergius III. lässt in einem Anfall von wahnsinniger Verfolgungswut zwei seiner Brüder im Herrn umbringen. Kommentatoren dieser Zeit bezichtigen den Stellvertreter Christi auf Erden, „ständig grenzenlose Abscheulichkeiten mit leichten Frauen“ zu begehen.
Man könnte über diese nur kurze Phase des Papsttums leicht hinwegsehen, wenn nicht die Gefahr bestanden hätte, dass das italienische Königreich in diesen Sog von Auflösungserscheinungen und Rechtlosigkeit hineingezogen worden wäre. Die politische Lage in Italien ist jedenfalls zur Mitte des 10. Jahrhunderts - vorsichtig formuliert - unübersichtlich. Im Mai 946 wird mit Johannes XII. ein Sohn Alberichs II. auf dem Heiligen Stuhl platziert, der den Beinamen „der Schlechte“ trägt. Johannes XII. ist Atheist und sein Benehmen dient nicht gerade als Vorbild für sittenstrenges Verhalten. Jede Menge Geliebte beiderlei Geschlechts begleiten ihn bei ausschweifenden Orgien im Vatikan. Der für seine papstkritischen Bemerkungen bekannte zeitgenössische Chronist Liutprand von Cremona berichtet nicht nur von einem Bordell im Vatikan, sondern auch noch von Mordanschlägen, Inzest, Simonie und einer Jagd- und Spielleidenschaft des Papstes, so dass der Vorwurf der permanenten Gotteslästerung nicht weiter ins Gewicht fällt. Jedenfalls endet sein ganz und gar unchristliches Leben 964 mit einem Hammerschlag – ausgeführt von einem gehörnten Ehemann, der den Papst beim Geschlechtsverkehr mit seiner Frau erwischt hat. Zu Lebzeiten sieht sich jener Johannes XII. dauerhaften Attacken Berengars II. von Ivrea ausgesetzt, der sich nicht nur des Kirchenstaats sondern der Macht in ganz Italien bemächtigen will. Der italienische König Hugo fühlt sich von der Familie aus Ivrea, die über weite Teile der Lombardei, über das Aostatal, bis nach Piemont und im weiter südlich gelegenen Spoleto herrscht, ernsthaft bedroht.
Deswegen forciert König Hugo den Sturz seiner mächtigen Widersacher aus Ivrea. Im Verlaufe der daraufhin einsetzenden Kämpfe muss Berengar II. von Ivrea fliehen. Es gelingt ihm 941 bei König Otto I. für einige Zeit Unterschlupf zu finden. Mit schwäbischer Hilfe und der Duldung Ottos I. erobert Berengar vier Jahre später weite Teile Norditaliens zurück und übt fortan in diesem Teil des Landes die Macht aus. Anfang 945 geht die Regierungsgewalt von König Hugo auf den immer mächtiger gewordenen Berengar II. von Ivrea über. Der mitregierende Sohn Hugos - König Lothar - bleibt im Amt, ist aber in Berengars Augen nur noch geduldete Randfigur. Lothar heiratet 947 eine gewisse Adelheid von Burgund, die Tochter des burgundischen Königs Rudolf II.. Drei Jahre später strebt Berengar II. schließlich nach der ganzen Macht in Italien und vergiftet – so die kolportierte Vermutung – Lothar. Die Witwe Adelheid soll seinen Sohn heiraten. Als sie sich aber weigert, macht Berengar II. einen folgenschweren Fehler: Er beraubt und misshandelt sie, um sie anschließend in Garda gefangen zu setzen. Die Überlieferung berichtet dann von einem Priester namens Martin, der Adelheid und ihre Tochter erst befreit und dann versteckt. Berengar II. wird derweil in Pavia zum König von Italien gekrönt.
Die schöne Adelheid aber hat noch gute Verbindungen im Lande und lanciert einen Hilferuf an Otto I., der sie daraufhin befreit. Ein Jahr später heiratet er Adelheid – mit der nicht unmaßgeblichen Folge, dass er damit wegen der Herkunft seiner zweiten Frau auch noch rechtmäßiger König in Oberitalien wird. Berengar II., nach wie vor auch italienischer König, leistet am 7. August 952 Otto I. einen Treueeid und damit ist das Verhältnis der beiden zumindest vorerst geklärt.
Es wäre vermutlich nie zum Streit und damit auch nicht zur Kaiserkrone für Otto I. gekommen, hätte nicht ein anderer Sohn Berengars II. – namens Wido - auch Gefallen an der Macht gefunden und 959 das Herzogtum Spoleto erobert. Dieses Herzogtum grenzt im Süden an den Kirchenstaat und eignet sich bestens zum Angriff auf das „patrimonium petri“. Angesichts des kriegslüsternen Wido und des nicht minder entschlossenen Berengar II. fühlt sich Johannes XII. in Rom in seiner Haut nicht mehr sicher. Es kommt es zu einem Hilferuf des Papstes, dem Otto I. - wie 160 Jahre vor ihm Karl der Große - Folge leistet. Er besiegt die Aufständischen und sichert damit dem ostfränkischen Reich die Hoheit über Italien, obwohl Berengar II. und Wido nach Kräften Widerstand leisten. Die apostolische Dankbarkeit von Papst Johannes XII. findet am 2. Februar 962 in Form der in Ottos Hände gelegten Würde eines römischen Kaisers seinen weltlichen Ausdruck. Berengar II. hingegen wandert in kaiserliches Gewahrsam, dem er lebend nicht mehr entkommt.
Das deutsche Kaisertum
Mit der Kaiserkrönung Ottos I. sind zwei Entscheidungen mit langfristigen Folgen gefallen. Zum einen bekommt das Oberhaupt der weltlichen Macht – der Kaiser –die Aufgabe übertragen, die römische Kirche und das Papsttum gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen und die Christianisierung Europas voranzutreiben. Otto I. widmet sich zeitlebens mit großem Engagement dem Aufbau einer christlichen Kirche in Südosteuropa. Zum anderen ist mit Ottos I. Kaiserkrönung der Bruderkampf zwischen den West– und den Ostfranken um das italienische Erbe beendet. Der östliche, der „deutsche“, Teil des alten Frankenreichs bekommt mit der römischen Kaiserkrone die Hoheit über Norditalien und die Verantwortung für den Kirchenstaat. Fortan herrscht der deutsche König in Personalunion auch über den nördlichen Teil Italiens. An diesem Tag ist eine politische Entscheidung von großer Tragweite gefallen. Denn die ostfränkischen Herrscher sind von nun an immer auch römische Kaiser, sie stehen an der Spitze des „Römischen Reiches“, dem seit dem 13. Jahrhundert der Zusatz „heilig“ und ab dem 15. Jahrhundert der Zusatz „deutscher Nation“ angehängt wird. Der letzte, der diesen ehrenvollen Titel trägt, ist der Habsburger Franz II. - von 1792 bis 1806! Was mit der Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom am 1.Weihnachtstag 800 beginnt und mit der erneuten Übertragung der Kaiserwürde an Otto den Großen im Jahr 962 fortgesetzt wird, endet erst zur Zeit der napoleonischen Kriege am Beginn des 19. Jahrhunderts!