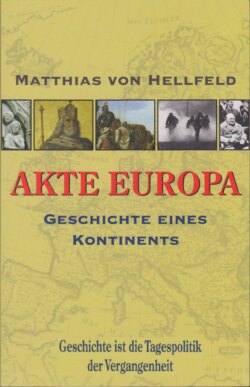Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Knabe aus Apulien
ОглавлениеNun schlägt die Stunde von Friedrich II., dem „Knaben aus Apulien“, wie er etwas verniedlichend genannt wird. Um diesen zweifellos faszinierenden mittelalterlichen Herrscher ranken sich von der Geburt bis zum Tod Gerüchte und Legenden. Angeblich auf einem Marktplatz geboren, wächst er in „ungeordneten“ Verhältnissen auf. Er wird als ungehobelt, keinen Widerspruch duldend, ja geradezu frech geschildert. Zwar wohnt der Knabe im königlichen Palast von Palermo, die meiste Zeit jedoch treibt er sich im bunten Völkergemisch Palermos herum, lernt die Sprachen der verschiedenen Volksgruppen und ist auf mildtätige Gaben der Bürger angewiesen, die den kleinen Prinzen, mit dem was übrig ist, über Wasser halten. Für den künftigen König ist das Leben auf der Straße offensichtlich eine ertragreiche Schule für das Leben. Er lernt, wie das Volk lebt, sieht Gutes und Schlechtes, erfährt von Eigensucht und Verrat. Dennoch grenzt es an ein Wunder, dass der junge Mann in diesen Jahren nicht verwahrlost, sondern es offenbar versteht, sich die Grundlagen für seine bedeutende Herrschaft zu erarbeiten.
Eine Kehrtwende nimmt sein Leben, als er die zehn Jahre ältere Konstanze von Aragon heiratet. Diese Ehe kommt auf Vermittlung des Papstes zustande, der seit dem Tod seiner Mutter auch sein Vormund ist. Konstanze ist anfangs irritiert über das ungehobelte Verhalten ihres jugendlichen Ehemanns. Sie wird den Verdacht nicht los, Friedrich habe sie vor allem wegen der opulenten Mitgift geehelicht. Aber ihr Schock wandelt sich rasch in tiefe Zuneigung, die von Friedrich II. erwidert wird. Konstanze von Aragon ist wohl der erste Mensch, zu dem er ohne Vorbehalte Vertrauen entwickelt. Von ihr wird er in das Zeremoniell des höfischen Lebens eingeführt, sodass sein Image sich alsbald von dem eines ungehobelten Klotzes zu dem eines charmanten Mannes wandelt, der seine mittlerweile verfeinerten Lebensgewohnheiten mit einem für diese Zeit ungewöhnlichen täglichen Bad krönt.
Aber das Leben Friedrichs II. besteht nicht nur aus den Wonnen des Ehelebens, denn als sich Otto IV. daran macht, Sizilien einzunehmen, löst er bei Papst Innozenz III. schwere Angstzustände aus. Der Heilige Vater sieht den Kirchenstaat von Norden und Süden umklammert und belegt den Urheber dieses Albtraums umgehend mit dem Kirchenbann. Damit tut er Friedrich II. einen großen Gefallen, da die wankelmütigen Fürsten in Deutschland sofort von Otto IV. abfallen und den jungen König von Sizilien, Friedrich II., zum deutschen König wählen. Daraufhin eilt Otto IV. nach Deutschland zurück, kann aber den Siegeszug Friedrichs II. nicht mehr aufhalten. Nach einer weiteren militärischen Niederlage schwindet sein Einfluss mehr und mehr, bis er schließlich auf einige norddeutsche Gebiete beschränkt ist. Ende Juni 1218 stirbt mit Otto IV. der einzige römische Kaiser aus dem Haus der Welfen.
Der Weg ist frei für Friedrich II., der sich sofort an die Absicherung seiner eben gewonnenen Position macht. 1220 lässt er sich von Papst Honorius III. zum Kaiser krönen, stimmt einer Erweiterung des Kirchenstaats zu und verzichtet auf einige kaiserliche Rechte innerhalb der Kirche. Da immer noch Ungemach über das frevelhafte Verhalten der „Heiden“ in Jerusalem an die päpstlichen Ohren dringt, verspricht Friedrich II. außerdem einen Kreuzzug zu organisieren. Das Verhältnis zwischen dem Papst und dem frisch gebackenen Kaiser scheint also in Ordnung zu sein, aber die Eintracht zwischen den beiden währt nicht lange, denn Friedrich II. hat nicht nur einen Bund mit einigen oberitalienischen Städten geschlossen, sondern beginnt unmittelbar nach seiner Krönung mit brutaler Härte den Adel in Sizilien zu unterdrücken. Wie vorher bei Otto IV. reagiert der Papst vorhersehbar: Eine machtpolitische Umzingelung durch den deutschen Kaiser, den er zu allem Unglück auch noch selbst gekrönt hat, kann er nicht widerspruchslos hinnehmen. Er belegt den Kaiser mit dem Kirchenbann.
Da Kaiser Friedrich II. sich vor allem in Sizilien aufhält, um dort eine straffe und zentralistische Verwaltung aufzubauen, muss er Deutschland den Fürsten und Bischöfen überlassen, die in Abwesenheit des Kaisers alles daran setzen, ihre eigenen Machtbereiche auszubauen. Das wird sich später rächen. Zunächst ist Friedrich II. mit den Verhältnissen in – wie es heißt - „Deutschlandsizilien“ und mit den Vorbereitungen eines 5. Kreuzzuges beschäftigt, zu dem schließlich 1228 aufgebrochen wird. Zu regelrechten Kämpfen kommt es nicht, da einerseits die Zahl der Kreuzritter nicht wirklich erschreckend ist und andererseits der potenzielle Gegner Al-Kamil, der Sultan von Ägypten, in andere Konflikte verstrickt ist. So greifen die Beteiligten zum Mittel der Diplomatie und verhandeln miteinander. Friedrich II. gelingt es Jerusalem, Jaffa, Nazareth, Bethlehem und Teile Galiläas seinem Gegenüber abzuringen. Das hatte keiner seiner Kreuz tragenden Vorgänger erreicht: Jerusalem wird ohne Blutvergießen zurück gewonnen. Am 18. März 1229 setzt Friedrich II. zu Füßen der Gebeine des Herrn in der Grabeskirche sich selbst die Krone des Königs von Jerusalem auf den Kopf und ist damit am Ende des 5. Kreuzzugs in Personalunion König von Jerusalem, Italien, Deutschland und Sizilien und zugleich Kaiser des römischen Reiches.
Eine derartige Ämterhäufung kann nicht gut gehen. Vor allem im Norden Italiens hat er es – genau wie sein Großvater Friedrich I. Barbarossa - mit dem erbitterten Widerstand des lombardischen Städtebunds zu tun. Im Zuge der Streitigkeiten marschiert Friedrich II. mehrmals im Vatikan ein, wird öfters gebannt und wieder in den Schoß der Kirche aufgenommen. Am 17. Juni 1245 greift der Kaiser nochmals den Kirchenstaat an und wird daraufhin vom Papst, der seinerseits einen blutig niedergeschlagenen Aufstand in Sizilien gegen Friedrich II. anzettelt, für abgesetzt erklärt. Während Friedrich II. sich fast ausschließlich in Italien aufhält, wächst die Macht der Fürsten in Deutschland immer weiter. Friedrich II., ein Mann, dem viele Zeitgenossen hohe Bildung und außergewöhnliche Persönlichkeit nachsagen, stirbt Mitte Dezember 1250. Die Fundamente der Königsmacht in Deutschland sind bis zu diesem Zeitpunkt durch den staufisch-welfischen Konflikt dauerhaft zerstört.
Seine diplomatischen Erfolge im Nahen Osten sind auch nicht von langer Dauer, denn 1244 wird Jerusalem wieder von den Türken zurückerobert. Der darauf 1248 einsetzende 6. Versuch, die Heilige Stadt von den „Heiden“ zu befreien, endet für das vom französischen König Ludwig IX., „dem Heiligen“, angeführte Heer in ägyptischen Gefangenenlagern. Der 7. und letzte Kreuzzug dauert nur wenige Monate, weil eine verheerende Beulenpest unter den Rittern wütet. 1270 ist nicht nur der letzte Kreuzzug beendet, sondern auch die Begeisterung für heilige Kriege unter der christlichen Bevölkerung des Abendlands geschwunden. Ohne die christlichen Heere können sich die so genannten Kreuzfahrer-Staaten nicht mehr halten, Syrien und Palästina werden von muslimischen Truppen zurückerobert. Damit geht die knapp 200-jährige militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten zu Ende. Wie vielen Millionen Menschen dieses Unterfangen unter dem höhnischen Kampfruf „Gott will es!“ das Leben gekostet hat, kann man nur schätzen. Die geopolitische Landkarte des Nahen Ostens ist durch die Kreuzzüge jedenfalls nicht nachhaltig verändert worden. Vorher wie nachher ist dieser Teil der Welt mehrheitlich von islamischen Staaten geprägt, von denen das bis 1922 existierende Osmanische Reich das bedeutendste werden wird.