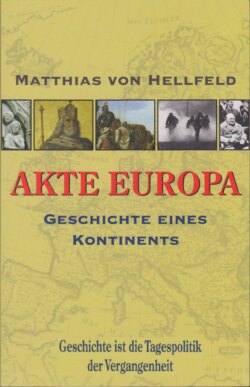Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Politische Partizipation in Deutschland
ОглавлениеDer machtpolitische Spagat zwischen Deutschland und Italien, den die deutschen Kaiser seit der Aufteilung des Reichs Karls des Großen vollführen, hat den Aufstieg der Herzöge und Fürsten befördert. Zweifellos haben deren eigene Machtinteressen zu den teilweise chaotischen Zuständen am Beginn des 14. Jahrhunderts geführt. Der Umstand, dass in den letzten Jahrzehnten mehrfach Ausländer auf dem deutschen Königsthron gesessen haben, wird einer Identifikation der Menschen mit „ihrer“ Krone eher im Wege gestanden haben. Aber das politische Taktieren um mehr Macht und Einfluss auf die Führung des deutschen Reiches schafft ein System von Gegengewalten. Die Fürsten erstreiten immer mehr Teilhabe an den politischen Entscheidungen ihrer Zeit – mit einem Begriff von heute würde man das „politische Partizipation“ nennen. Ein schwacher König und starke Territorialherren: beide Seiten können nicht ohne den anderen handeln, so wird Despotie und Machtmissbrauch – wenigstens weitestgehend – verhindert. Und noch etwas entspringt dieser politischen Situation: die Städte. Sie werden immer mächtiger und einflussreicher, vergeben eigene Rechte und Privilegien, schützten ihre Bürger und entwickelten ihre eigenen Identitäten, die zum Teil bis heute überdauert haben. Das gilt auch für Frankreich, wo schon 1302 die erste „Ständeversammlung“ abgehalten wird, der die Städte, der Klerus und der Adel angehören. Die gegenseitige Kontrolle der politischen Machthaber in Deutschland wird im Laufe der Geschichte immer wieder mal außer Kraft gesetzt, sie hat sich aber letztlich bis in unsere Tage erhalten. Keine Bundesregierung kann das Deutschland regieren, ohne die Belange der Bundesländer zu berücksichtigen. Und umgekehrt kann kein Bundesland, die Politik der Bundesregierung so torpedieren, dass sie langfristig handlungsunfähig wird.