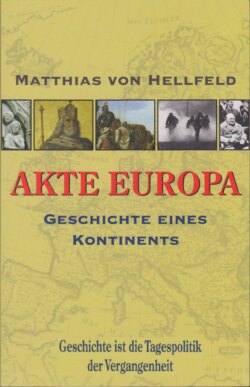Читать книгу AKTE EUROPA - Matthias von Hellfeld - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frankreich und die deutsche Krone
ОглавлениеDas Machtvakuum in der geographischen Mitte des europäischen Kontinents reizt die Nachbarn. Der französische König Philipp III. streckt seine Hand nach der deutschen Königskrone aus und kann sich auf manchen Territorialfürsten verlassen, die das deutsche Kaisertum dadurch zu schwächen suchen, indem sie mit dem französischen König paktieren. Der immer deutlicher werdende hegemoniale Anspruch des französischen Königs ruft den bekannten Reflex des Papstes hervor, der sich für den Fall der erfolgreichen Übernahme der deutschen Krone nun von Frankreich umzingelt sieht. Da diese Vorstellung kaum besser ist, als die von Deutschland umklammert zu sein, geht Papst Gregor X. in die Offensive und fordert das kurfürstliche Kollegium auf, einen neuen deutschen König zu wählen, der mächtig genug ist, sich gegen die französischen Begehrlichkeiten zur Wehr setzen zu können. So berufen am 11. September 1273 die Kurfürsten den Herzog Rudolf I. von Habsburg zum deutschen König. Über das machtpolitische Geschacher vor der Wahl berichtet der Chronist Mathias von Neuenburg in seiner „Chronik“:
„Als aber die Wahlfürsten versammelt waren (…) und über den Verlust aller fürstlichen Rechte klagten und sich über die Person eines zu wählenden Fürsten besprachen, rühmte der Mainzer Erzbischof den Mut und die Klugheit des Grafen Rudolf von Habsburg (…) Der Herzog von Bayern aber, der seine edle Gemahlin (…) wegen des ungerechten Verdachts eines Ehebruchs hatte enthaupten lassen (…) sagte dem Burggrafen von Nürnberg, einem Neffen Rudolfs: ‚Welche Sicherheit habe ich, wenn Rudolf erwählt wird, vor seiner Verfolgung? Hat er eine Tochter, die er mir zur Gemahlin geben würde?’ Als nun jener versicherte, dass Rudolf sechs Töchter hätte und dass ihm eine von diesen gegeben würde und er sich für die Einsetzung aller seiner Besitzungen verbürgte, stimmte der Herzog dem Mainzer Erzbischof bei. Als dies der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg hörten, welche auch beide keine Frauen hatten, stimmten sie gleichfalls bei, nachdem ihnen die Sicherheit gegeben war, dass sie Töchter Rudolfs zu Gemahlinnen erhalten würden.“
Abgesehen von der damals offenbar uneingeschränkten Verfügungsgewalt des Vaters über die eigenen Töchter, sind die fürstlichen Sorgen nicht unberechtigt, denn der neue König erklärt als erstes die Rückgewinnung aller königlichen Rechte und Güter zum obersten Ziel seiner Politik. Dabei findet er im böhmischen König Ottokar II. seinen schärfsten Widersacher. Ottokar II. hatte Österreich, Steiermark und Kärnten seinem böhmisch-mährischen Herrschaftsgebiet einverleibt und ist obendrein Lehnsnehmer des gerade verstorbenen englischen Königs Richard von Cornwall. Rudolf von Habsburg lässt sich aber nicht erschrecken, fordert ultimativ die Rückgabe der österreichischen Reichsgüter und löst damit einen fünfjährigen Streit aus. Ottokar II. verliert im Laufe dieser Auseinandersetzung die Unterstützung der österreichischen Bevölkerung und wird nach der verlorenen Schlacht auf dem Marchfeld am 26. August 1278 von steirischen Soldaten aus dem Leben befördert. Nach dem Sieg in diesem böhmisch-deutschen Krieg baut Rudolf von Habsburg seine königliche Stellung im Lande konsequent aus, indem er eine ansehnliche habsburgische Hausmacht am Oberrhein und im Elsass zusammenbringt und so zum Stammvater der Habsburger-Dynastie wird, die in den kommenden 600 Jahren ihre Erblande und vor allem Österreich regieren wird. Rudolf von Habsburg, der 1291 in Speyer stirbt, räumt den Städten besondere Privilegien ein und ermutigt sie, Stadtbündnisse zu gründen, um eine „dritte“ Macht im Staate gegen die geistlichen und weltlichen Territorialherren zu etablieren. Der Aufstieg der Städte, die im Rheinland, in Westfalen und in Süddeutschland genauso wie im Norden Städtebündnisse gründen, beginnt.
Noch bevor der Leichnam des verblichenen Rudolf von Habsburg erkaltet ist, brechen die alten Streitigkeiten wieder auf. Die Fürsten wählen 1292 den unbedeutenden Adolf von Nassau zum König, setzen ihn sechs Jahre später wieder ab und erheben gegen reichlich Schmiergeld einen weiteren Habsburger zu ihrem König. Jener Albrecht I. bemüht sich erfolgreich um einen friedlichen Ausgleich mit den französischen Nachbarn, mit denen es immer wieder zu Grenzstreitigkeiten gekommen war. Als er versucht, habsburgische Ansprüche in Böhmen und Polen durchzusetzen, fällt Albrecht I. 1308 einem heimtückischen Anschlag seines Neffen Johann zum Opfer. Die Schlacht um die Krone im deutschen Reich geht weiter, denn nun will Philipp IV., König von Frankreich, seinen Bruder auf den deutschen Königstuhl setzen, scheitert aber am Netz der von ihm selbst gesponnenen Intrigen und muss 1308 die Wahl des Luxemburgers Heinrich VII. zum deutschen König zur Kenntnis nehmen.
Philipp IV. ist in diesen Jahren nicht nur darum bemüht, die deutsche Königskrone zu erlangen. 1303 wendet sich Papst Bonifatius VIII. gegen seine Steuerpolitik und fordert die Steuergelder des Klerus für einen neuerlichen Kreuzzug einzusetzen. Jener Bonifatius VIII. ist bei vielen Zeitgenossen ein Papst, der sich schon zu Lebzeiten Denkmäler setzen lässt und damit auf herbe Kritik stößt. Bei der Betrachtung seiner eigenen prunkvollen Grabstätte fragt Bonifatius VIII. einen neben ihm stehenden Bischof, was dem Bauwerk denn an Schönheit noch fehle. Die Antwort ist überliefert: „Heiliger Vater, dass Ihr noch nicht drin seid!“. Der eitle Bonifatius VIII. mischt sich auch kräftig in die Tagespolitik seiner Zeit ein. Als er eine Bannbulle verfasst, die den aufmüpfigen französischen König zur Raison bringen soll, platzt Philipp IV. der Kragen. In einer spektakulären Aktion lässt er den Papst in der Kirche von Anagni verhaften und festsetzen. Drei Tage später wird der fast verhungerte Bonifatius VIII. von aufgebrachten Bürgern der Stadt wieder befreit und auf dem Marktplatz öffentlich mit Brot und Wein verköstigt. Aber der Papst ist ein gebrochener Mann, die erlittene Schmach trübt seinen Geist und lässt ihn in Tatenlosigkeit verharren. Die Qual nach dem ruchlosen Überfall ist derart groß, dass er einen Monat später die Augen für immer schließt. Sein Nachfolger Clemens V. ist etwas flexibler im Umgang mit der weltlichen Macht und stimmt 1309 der dauerhaften Verlegung des Amtssitzes der römischen Kurie nach Avignon zu. Mit diesem Aufsehen erregenden Coup, der die Päpste bis 1377 ins Exil zwingt, geraten die politischen Verhältnisse in Oberitalien außer Kontrolle. Der Papst residiert nun zwangsweise in Avignon und lässt sich in Rom durch einen Legaten vertreten, von dem Heinrich VII. von Luxemburg 1312 zum deutschen Kaiser gekrönt wird. Doch die Freude über den ersten deutschen Kaiser seit 1256 währt nur kurz, denn ein Jahr später rafft die Malaria Heinrich VII. von Luxemburg dahin.