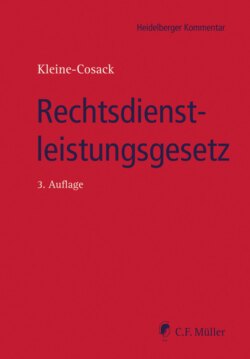Читать книгу Rechtsdienstleistungsgesetz - Michael Kleine-Cosack - Страница 24
c) Neue Studiengänge
Оглавление26
Auch im Bereich der Hochschulausbildung wird der zunehmenden Verrechtlichung des Wirtschaftslebens durch neue Studiengänge Rechnung getragen:[41] Universitäts- und Fachhochschulstudiengänge verbinden wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Ausbildungsinhalte mit einem juristischen Studienschwerpunkt. Mittlerweile wird der ursprünglich auf die Qualifikation der Studierenden für eine Tätigkeit in einem Wirtschaftsunternehmen ausgerichtete Studiengang Wirtschaftsrecht an über zwanzig Fachhochschulen und an mehreren Universitäten angeboten. Bei den Studieninhalten entfallen mindestens 50 % auf das Wirtschaftsrecht und 25 % auf Betriebs- und Volkswirtschaftslehre; zusätzlich werden Schlüsselqualifikationen (z. B. Sprachen, Informatik, Rhetorik, soziale Kompetenz) angeboten. Nach einer regelmäßig achtsemestrigen Studiendauer erlangen derzeit jährlich etwa 800 Absolventen den Abschluss Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) bzw. Bachelor of Laws – LLB als berufsqualifizierenden Abschluss. Angesichts dieser Entwicklung verleihen mittlerweile auch zahlreiche Universitäten den Studierenden mit dem erfolgreichen Abschluss der Ersten Staatsprüfung ein universitäres Abschlussdiplom.
27
Diesen Absolventen muss das Recht auf selbstständige juristische Betätigungen zugestanden werden. Es wird ihnen bisher noch verfassungs- und europarechtswidrig verweigert, wie das Scheitern einer gerichtlichen Erzwingung des Rechts zu selbstständiger rechtsberatender Tätigkeit gezeigt hat.[42]
28
Der Gesetzgeber des RDG hat in nicht haltbarer Weise argumentiert, dass Belange des Verbraucherschutzes – so die ABG[43] – der Einführung eines Rechtsdienstleistungsberufs unterhalb der Rechtsanwaltschaft entgegen stehen würden.
29
„Als Folge der aufgezeigten Entwicklung im Bereich der juristischen Fachhochschulstudiengänge haben insbesondere die Diplom-Wirtschaftsjuristen für sich und für Absolventen vergleichbarer juristischer Hochschul- oder Fachhochschulstudiengänge (z. B. Diplom-Sozialjuristen, Diplom-Informationsjuristen) die Befugnis zur selbstständigen außergerichtlichen Rechtsberatung gefordert. Der im Schwerpunkt juristische Fachhochschulstudiengang ende mit einem berufsqualifizierenden Abschluss, der nicht nur zur abhängigen Beschäftigung in einem Unternehmen, sondern auch zur selbstständigen Berufsausübung berechtigen müsse. Dieser Forderung hat sich zuletzt auch die Monopolkommission angeschlossen, (Sechzehntes Hauptgutachten „Mehr Wettbewerb auch im Dienstleistungssektor!“ vom 5. Juli 2006, http://www.monopolkommission.de/haupt. html). Sie hält darüber hinaus die Einführung einer Rechtsdienstleistungsbefugnis für alle Absolventen eines juristischen Studiengangs für geboten.
In der Tat könnte die Frage, ob Absolventen eines juristischen Studiengangs eine eigenständige, umfassende Befugnis zur außergerichtlichen Rechtsberatung erhalten sollen nicht auf einen einzelnen Fachstudiengang beschränkt werden. Dies belegen die bereits heute vorhandenen zahlreichen interdisziplinären Universitäts- und Fachhochschulstudiengänge mit juristischem Ausbildungsschwerpunkt. Vielmehr könnte eine solche Befugnis allein an objektive Ausbildungskriterien, insbesondere an die Dauer des Studiums und den Anteil spezifisch juristischer Studieninhalte geknüpft werden. Insbesondere die Absolventen des „klassischen“ rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums dürften daher angesichts von Studiendauer und -inhalten des Jurastudiums nicht schlechter behandelt werden als Absolventen von Fachhochschulen; dies gilt unabhängig davon, ob sie das Studium mit der Ersten Staatsprüfung nach altem Recht oder nach neuem Recht abschließen und ob ihnen zusätzlich zu der staatlichen Prüfung ein Diplomgrad verliehen wird.
Die Zulassung all dieser Hochschulabsolventen zur selbstständigen Rechtsberatung würde indes dazu führen, dass jedenfalls im Bereich der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen zwei Berufe – der des Rechtsanwalts und der des nichtanwaltlichen Rechtsberaters – nebeneinander bestehen, die bei völlig unterschiedlichen Ausbildungsstandards gleichartige Tätigkeiten anbieten.
Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf die Belange des Verbraucherschutzes nicht wünschenswert. Die geringere juristische Qualifikation führt in Anbetracht der Tatsache, dass eine Einschränkung der Rechtsberatungsbefugnis auf weniger bedeutsame oder weniger komplexe Lebenssachverhalte nicht möglich ist, zu einer Gefährdung der Verbraucherinteressen jedenfalls in den Fällen, in denen die außergerichtliche Rechtsberatung Kenntnisse erfordert, die regelmäßig erst im juristischen Vorbereitungsdienst vermittelt werden.
Darüber hinaus wäre das Nebeneinander zweier auf die gleiche Tätigkeit ausgerichteter Rechtsberatungsberufe mit völlig unterschiedlicher Berufsqualifikation den Rechtsuchenden auch bei Statuierung umfassender Informationspflichten nicht zu vermitteln.
Dies gilt vor allem dann, wenn die nichtanwaltlichen Rechtsberater – wie gefordert wird – denselben berufsrechtlichen Regelungen unterworfen wären wie Rechtsanwälte. Berufsrechtlich bestünde dann kein Unterschied mehr zwischen den beiden Berufen, die nach außen nur noch durch die Befugnis zur Vertretung vor Gericht zu unterscheiden wären. Diese Befugnis allein macht allerdings nicht den Kern spezifisch anwaltlicher Tätigkeit aus, die sich – wie der Anteil der außergerichtlichen Beratungstätigkeit der Rechtsanwälte belegt – nicht lediglich auf den forensischen Bereich reduzieren lässt.
Diesem Umstand hat der Gesetzgeber zuletzt durch die mit der Reform der Juristenausbildung erfolgte stärkere Ausrichtung des rechtswissenschaftlichen Studiums und des juristischen Vorbereitungsdienstes auf die anwaltliche Beratungstätigkeit Rechnung getragen. Er hat damit auch für den Bereich der außergerichtlichen Rechtsberatung die Ausbildungsstandards vorgegeben, die er zum Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifiziertem Rechtsrat grundsätzlich für erforderlich hält. Der Gesetzgeber hat hierdurch den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum für die Typisierung des Berufs des Rechtsberaters ausgefüllt. Ein Anlass, neben diesem Beruf einen weiteren Beruf des nichtanwaltlichen Rechtsberaters mit geringeren Zugangsvoraussetzungen zu schaffen, besteht nicht, zumal eine Ausweitung der anwaltlichen Berufspflichten auf andere Berufe, auch um eine Erosion dieser Berufspflichten zu verhindern, unterbleiben soll. Die Ausgestaltung eines umfassend rechtsberatenden Berufs ohne solche Berufspflichten würde aber im Hinblick auf die Belange des Verbraucherschutzes zusätzlichen Bedenken begegnen.
Die Schaffung eines rechtsanwaltsähnlichen Berufs unterhalb der Rechtsanwaltschaft ist auch verfassungsrechtlich nicht geboten: Grundsätzlich erfordert eine qualifizierte Rechtsberatung umfassende Kenntnisse des geltenden Rechts und nicht nur solche in einem speziellen Bereich. Die Rechtsordnung wird zunehmend komplexer, die Lebensverhältnisse zunehmend verrechtlicht. Von daher werden die zu beratenden Lebenssachverhalte zukünftig noch häufiger als bisher rechtliche Bezugspunkte zu mehr als einem Rechtsgebiet aufweisen. Dies erfordert die Vertrautheit mit der Rechtsordnung insgesamt und das Verständnis übergreifender rechtlicher Zusammenhänge. Darüber hinaus sind vielfach schon in der Rechtsberatung mögliche prozessuale Auswirkungen mitzubedenken, deren Kenntnis erst durch den juristischen Vorbereitungsdienst vermittelt wird. Soweit Personen mit einer teiljuristischen Ausbildung Berufe ausüben, die nicht im Kern rechtsdienstleistend sind, wird ihrer Berufsfreiheit durch die Neuausrichtung des Begriffs der Rechtsdienstleistung und die Zulässigkeit rechtsdienstleistender Nebenleistungen Rechnung getragen. Vor allem die Regelung über zulässige Nebenleistungen (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 5 RDG), die in Abhängigkeit von der beruflichen Qualifikation Rechtsdienstleistungen bis zu einem erheblichen Grad erlaubt, stellt dabei das verfassungsrechtlich gebotene und ausreichende Korrektiv für die Nichteinführung eines eigenständigen Rechtsdienstleistungsberufs dar.
Schließlich können Diplom-Wirtschaftsjuristen und Absolventen anderer juristischer Studiengänge eine selbstständige rechtsberatende Tätigkeit ausüben, indem sie ein ergänzendes Jurastudium nebst Referendariat absolvieren und anschließend die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beantragen; wollen oder können sie diese subjektiven Berufswahlvoraussetzungen nicht erfüllen, so bleibt es ihnen unbenommen, selbstständig etwa als Unternehmensberater tätig zu werden und im Rahmen dieser Tätigkeit spezifisch juristische Beratungsleistungen in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt zu erbringen. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält Vorschläge, um die Voraussetzungen für eine solche Zusammenarbeit zu schaffen.
Die genannten Gründe sprechen auch dagegen, Hochschullehrern des Rechts – ungeachtet ihrer fachlichen Qualifikation – allgemein die Befugnis zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen zu erteilen. Auch hierdurch entstünde letztlich ein zweiter, nichtanwaltlicher Rechtsberatungsberuf, zumal dann grundsätzlich alle Personen mit Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz unter Hinweis auf ihre umfassende juristische Qualifikation eine Rechtsdienstleistungsbefugnis für sich beanspruchen könnten, ohne sich zugleich den anwaltlichen Berufspflichten unterwerfen zu müssen.
Nicht berührt werden soll aber die überkommene, in mehreren Verfahrensordnungen verankerte Befugnis von Hochschullehrern, als Verfahrensbevollmächtigter oder Strafverteidiger tätig zu werden. Soweit sie im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit auch außergerichtliche Rechtsdienstleistungen erbringen, sind diese über § 5 Abs. 1 RDG erlaubt.“
30
Diese Erwägungen des Gesetzgebers halten einer näheren Überprüfung nicht stand. Letztlich dient die Diskriminierung der Wirtschaftsjuristen nur dem verfassungs- und europarechtsirrelevanten Konkurrenzschutz der Anwaltschaft. Zudem mißachtet sie die Autonomie des Verbrauchers, der nach § 1 I 2 geschützt werden soll, dem aber auch hier ein Rechtsanwalt aufgezwungen wird, obwohl er mit einem Wirtschaftsjuristen zufrieden wäre. Wenn der Staat Wirtschaftsjuristen ausbildet, dann muss er ihnen auch eine selbstständige Tätigkeit ermöglichen. Der Verbraucher – so auch die aktuelle Praxis – muss die Wirtschaftsjuristen nur bei sich anstellen; dann steht das RDG mangels Fremdheit der Leistungen i. S. d. § 2 I nicht mehr entgegen. Es ist auch widersprüchlich, den Wirtschaftsjuristen über die Nebenleistungsbestimmung des § 5 I in erheblichem Umfang die Erbringung von Rechtsdienstleistungen zu erlauben; nur müssen sie diese hinter einer nicht-rechtsdienstleistenden Haupttätigkeit – z. B. als Unternehmensberater – „verstecken“.