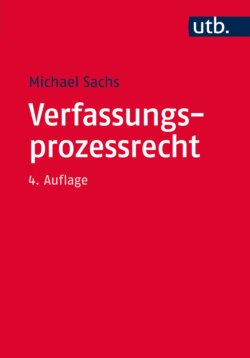Читать книгу Verfassungsprozessrecht - Michael Sachs - Страница 34
3. Untersuchungsgrundsatz
Оглавление79Im Hinblick auf die Beschaffung der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen ist der Verfassungsprozess vom Untersuchungsgrundsatz (auch: Inquisitionsmaxime) beherrscht, der in § 26 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG seinen Ausdruck gefunden hat. In der Praxis des BVerfG stehen freilich Fragen der Beweisaufnahme eher selten im Mittelpunkt. Dies erklärt sich zum Teil daraus, dass die Problematik vieler Verfahren weitgehend auf reine Verfassungsrechtsfragen konzentriert ist. Namentlich gilt dies für die Verfassungsbeschwerde, bei der nach Feststellung eines relevanten Rechtsanwendungsfehlers die Möglichkeit besteht, die Streitsache an die Gerichte zurückzuverweisen, so dass dort auch unterbliebene Beweiserhebungen stattfinden können. Was die im verfassungsgerichtlichen Verfahren häufig bedeutsame Beurteilung größerer gesellschaftlicher Entwicklungen angeht, kann sich das BVerfG vielfach auf die im Verfahren von den Beteiligten abgegebenen Erklärungen oder sonst eingeholten Stellungnahmen stützen. Gerade in neuerer Zeit hat das Gericht aber auch in derartigen Fällen sogar in der mündlichen Verhandlung ausführlich durch Anhörung von Sachverständigen selbst Beweis erhoben.
|23|Beispiele: Dies war der Fall etwa im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle gegen das Altenpflegegesetz, BVerfGE 106, 62 (104), oder auch im Verfahren zum Kopftuch bei Lehrerinnen, BVerfGE 108, 282 (304ff., aber S. 293: sachverständige Auskunftspersonen). Zuletzt hat das BVerfG in demselben Rahmen auf sachkundige Dritte gem. § 27a BVerfGG (auch → Rn. 80), Vertreter von Organisationen (BVerfGE 135, 259 Rn. 84), aber auch Einzelpersonen (BVerfGE 135, 259 Rn. 28: „als sachverständige Auskunftspersonen“) zurückgegriffen.
80Für den Fall einer Beweisaufnahme stehen dem BVerfG nach den §§ 26ff. BVerfGG als Beweismittel sowohl Urkunden als auch Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen zur Verfügung. Über die gesetzlich ausdrücklich genannten Möglichkeiten hinaus kann das BVerfG grundsätzlich auch andere Beweismittel einsetzen, etwa Beweis durch Augenschein erheben oder eine Parteivernehmung durchführen. In § 27a BVerfGG neu eingefügt ist die Möglichkeit, sachkundigen Dritten (zumal einschlägig tätigen Verbänden, vgl. BVerfGE 136, 194 Rn. 78; 137, 108 Rn. 45; auch → Rn. 79) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Beweisaufnahme findet in der mündlichen Verhandlung oder in gesonderten Beweisterminen statt. Die Beteiligten können der Beweisaufnahme in jedem Falle beiwohnen und dabei Zeugen und Sachverständige befragen, vgl. § 29 BVerfGG. In seiner Beweiswürdigung ist das BVerfG frei, vgl. § 30 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG.
81Nicht gesetzlich gelöst ist das Problem der objektiven Beweislast. Diese betrifft die Frage, wie im Falle der objektiven Nichterweislichkeit einer entscheidungserheblichen Tatsache zu entscheiden ist. Insoweit ist es problematisch, allgemeine Beweislastregeln aus anderen Gerichtsbarkeiten zu übernehmen. Dies gilt namentlich im Verhältnis zur Zivilgerichtsbarkeit, deren Normenmaterial ganz anders als das Verfassungsrecht vielfach von vornherein auf Probleme der Nichtfeststellbarkeit von Tatsachen zugeschnitten ist. Im Rahmen von Verfassungsbeschwerdeverfahren spricht einiges für die Anerkennung des Prinzips „in dubio pro libertate“, das dem Grundsatz der größtmöglichen Effektivität der Grundrechtsgeltung entsprechen dürfte. Seine Geltung kann aber keinesfalls als allgemein gesichert angesehen werden.