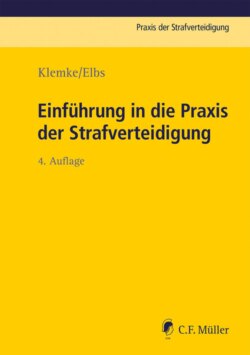Читать книгу Einführung in die Praxis der Strafverteidigung - Olaf Klemke - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
aa) Interessenkollision als „wichtiger Grund“
Оглавление119
Die Rspr. sieht dies anders. So haben das OLG Frankfurt/M. und der BGH entschieden, dass die Bestellung des vom Beschuldigten vorgeschlagenen Verteidigers zu unterbleiben hat, wenn ein Fall der Wahrnehmung widerstreitender Interessen nach § 43a Abs. 4 BRAO, § 3 BORA vorliegt.[55] Nach Auffassung des OLG Frankfurt/M. ist der Gerichtsvorsitzende nicht grundsätzlich daran gehindert, mehreren Angeklagten, welche derselben Tat beschuldigt werden, Pflichtverteidiger beizuordnen, die in einer Sozietät verbunden sind. Eine Ablehnung der Bestellung der gewünschten Verteidiger ist nur zulässig, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie zu einer sachgerechten Verteidigung außer Stande sind, insbesondere ihre Verteidigung grob pflichtwidrig an den Interessen des Mitangeklagten bzw. der Sozietät ausrichten werden. Der BGH hat entschieden, dass die Bestellung des vom Beschuldigten gewünschten Verteidigers nicht allein wegen einer möglichen Interessenkollision abgelehnt werden darf, die sich aus einem Fall sukzessiver Mehrfachverteidigung ergibt. Dies folge aus der Gleichwertigkeit von Wahl- und Pflichtverteidigung, da das Vorliegen einer sukzessiven Mehrfachverteidigung die Zurückweisung eines Wahlverteidigers nach § 146a StPO nicht erlaube. Anderes gelte jedoch in Fällen der konkreten Gefahr einer Interessenkollision.
120
Dem ist nicht zu folgen. Es ist Sache des Verteidigers, seinen Berufspflichten, insbesondere dem Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen zu entsprechen und nicht Aufgabe des Gerichts, den Verteidiger dahin zu überwachen. Die Rspr. begründet ihre Ansicht damit, dass die Abberufung des Pflichtverteidigers anders als beim Wahlmandat, welches ohne weiteres entzogen werden könne, ausschließlich in der Hand des Gerichtsvorsitzenden liege. Dies ist so nicht richtig. Das Institut der Pflichtverteidigung soll auch sicherstellen, dass der Beschuldigte von dem Verteidiger seines Vertrauens verteidigt wird. Dieses Zweckes wegen ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Bestellung eines Pflichtverteidigers dann zurückgenommen werden kann, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Verteidiger gestört ist. Die Rspr. verlangt vom Beschuldigten, substanziiert Tatsachen vorzutragen, die belegen, dass vom Standpunkt eines „vernünftigen und verständigen Beschuldigten“ aus das Vertrauensverhältnis endgültig zerstört ist.[56] Erkennt der Gerichtsvorsitzende die konkrete Gefahr einer Interessenkollision des Pflichtverteidigers, wird er den Beschuldigten und den Verteidiger hierauf hinzuweisen und nachzufragen haben, ob die Bestellung trotz der nahen Gefahr einer Interessenkollision bestehen bleiben soll. Bittet auch nur einer von beiden um die Rücknahme der Bestellung, hat der Gerichtsvorsitzende dem nachzukommen. Der substanziierten Darlegung der Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses bedarf es dann nicht. Die Zerstörung des Vertrauensverhältnisses ist beim Vorliegen der konkreten Gefahr einer Interessenkollision und dem gleichzeitigen – auch einseitigen – Begehren auf Auswechslung des Pflichtverteidigers unwiderlegbar zu vermuten. Wünschen hingegen Beschuldigter und Verteidiger, die Bestellung aufrechtzuerhalten, muss der Vorsitzende dem entsprechen. Allerdings wird er i.d.R. Anlass haben, einen zweiten Verteidiger, einen sog. „Sicherungsverteidiger“, zu bestellen. Die hier vorgeschlagene Verfahrensweise trägt im Unterschied zu autoritären Vorstellungen der Rechtsprechung vom Institut der Pflichtverteidigung der Autonomie des Beschuldigten und seiner Verteidigung hinreichend Rechnung.