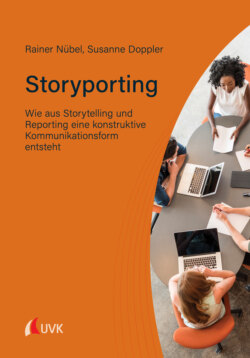Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 10
Struktur des doppelten Weges: Individuum und Gemeinschaft
ОглавлениеObwohl Vogler in seiner Darstellung der Heldenreise als Story-Grundmuster wiederholt beispielhaft die Artussage anführt, wo die tiefste Höhle (Stadium sieben) die Gralskapelle sei, bleibt unberücksichtigt, dass die deutsche Artusforschung seit den 1970er-Jahren eine andere Struktur ausgemacht hat: die des doppelten Weges. Nach der Analyse mehrerer Mediävisten ‚funktionieren‘ mittelalterliche Artusromane wie der Erec von Hartmann von Aue so: Der aus seiner alltäglichen Welt aufbrechende Held gewinnt nach erfolgreich gemeisterten Herausforderungen sowie der Gewinnung einer Frau persönlichen Ruhm und Ehre und wird von Artus an dessen Hof aufgenommen. Doch plötzlich wird der Held mit eigener Schuld, dem Bewusstsein eigenen Versagens oder einer Schuldzuweisung konfrontiert – das zuvor erreichte ideale Stadium ist gebrochen, verloren gegangen. Daraus ergibt sich für den Helden die Notwendigkeit, noch einmal loszuziehen – auf einen zweiten Weg, eine zweite Abenteuerreise. Auf diesem zweiten Weg geht es nicht mehr nur darum, die persönliche Idealität zu beweisen, sondern vielmehr darum, sich in den Dienst der sozialen Gemeinschaft zu stellen und Hilfsbedürftigen zu helfen. Hat der Held auch diese im Vergleich zum ersten Weg schwierigeren Abenteuer erfolgreich gemeistert, kehrt er ein zweites Mal an den Artushof zurück, jetzt im bleibenden Besitz der vollständigen Ehre und Macht (Mertens 2007; Haug 1990; Ruh 1977).
Zwar gibt es in der literaturwissenschaftlichen Mittelalterforschung inzwischen auch Kritik an diesem Modell, u. a. an seiner Dogmatik (Schmidt 1999), doch gilt die Doppelwegstruktur bis heute als ein wesensbestimmendes Merkmal dieser historisch-spezifischen Form des fiktionalen StorytellingStorytellingfiktionaless. Interessant ist sie auch und besonders deshalb, weil sie das handelnde Subjekt, den Helden, zunächst im individuell-ethischen und dann, auf dem zweiten Weg, im sozial- oder systemethischen Kontext positioniert. Gerade vor dem Hintergrund ethischer, sozialpsychologischer sowie narratologischer Aspekte könnte ein solches Modell auch für das Storytelling in unserer postmodernpostmodernen Zeit relevant sein. Jedenfalls ließe sich ein impliziter Bezug zum SozialkonstruktivismusSozialkonstruktivismus herstellen, der davon ausgeht, dass Menschen Wirklichkeit zum einen individuell und zum anderen sozial konstruieren und die damit geschaffenen Wahrheiten innerhalb von Kulturen, Gesellschaften und sozialen Segmenten geteilt werden (Gergen 2002).