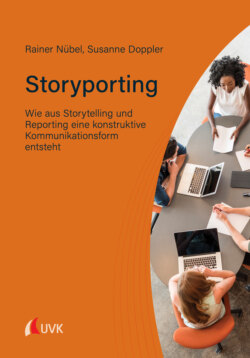Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 16
Storytelling und Orientierung
ОглавлениеDie Megatrends Globalisierung und Individualisierung erzeugen eine Komplexität in der Lebenswelt und im Bewusstsein der Menschen, die zu einem Verlust an Übersicht und zu Orientierungslosigkeit führt. Dieser Verlust bringt in der hochgradig individualisierten und global vernetzten Kultur ein Bedürfnis nach Orientierung und Ordnung hervor, eine Sehnsucht nach Dramaturgie (Varga/Ehret 2016, S. 33). Im März 2020 zwang die Coronapandemie die gesamte Event- und Tourismusbranche zu einem flächendeckenden Lockdown. Die Eventbranche verlegte sich in der Folge sehr schnell in digitale Begegnungsräume. In Deutschland, aber auch weltweit, fanden Veranstaltungen zunehmend online statt. Mit dieser sprunghaft zunehmenden Digitalisierung und Virtualisierung wuchs das Bedürfnis nach Orientierung, Ordnung und Dramaturgie weiter. Bereits 2011 mutmaßte der Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter in seinem Leitartikel zum Schwerpunkt Marketing/Event, dass „die Virtualisierung der wirklichen Welt […] die Sehnsucht nach echten Gesprächen, nach dem Gesichtsausdruck des anderen, nach Gesten [weckt]“ (Lotter 2011). Interessanterweise stellt Wolf Lotter bereits 2011 in jenem Artikel die kritische Frage, ob „man sich wirklich noch immer einmal im Jahr an engen Messeständen zusammenrotten [muss]“ (ebd.).
Im Kontext von Events beinhaltet das Storytelling eine kohärente Geschichte mit einem erkennbaren Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Die Geschichte transportiert Informationen über den zeitlichen und räumlichen Kontext, die handelnden Charaktere und den Konflikt, sie wirft unbeantwortete Fragen oder ungelöste Konflikte auf und bietet Lösungen an (Fischer/Storksdieck 2018). Die Geschichte wird als ein roter Faden erzählt, der einem dramaturgischen Aufbau folgt, in dem Akteure – das können Menschen, Marken, aber auch Produkte sein – „zu Wort kommen und dem Rezipienten eine Identifikation erlauben“ (Heimes 2016, S. 853, zitiert in Fischer/Storksdieck 2018). Gundlach (2007, S. 87–89) unterscheidet im Kontext von Events vier Formen der DramaturgieDramaturgie: (1) die szenische Dramaturgie, die Szene für Szene unveränderlich und ohne Interaktionsmöglichkeiten abläuft, (2) die architektonische Dramaturgie, bei der Teilnehmer:innen sich durch einen dramaturgisch gestalteten Raum bewegen, (3) die interaktive Dramaturgie, bei der die Teilnehmer:innen durch Interaktion die Handlung und Szenen beeinflussen können, und (4) die strategische Dramaturgie, die die gesamte Zeitspanne einer Kommunikationskampagne betrachtet.
In der Event- und Tourismusbranche beginnt das Erlebnis, die Reise, bereits in der sogenannten Pre-Event- bzw. Pre-Reise-Phase, also der dem eigentlichen Event bzw. der Reise vorgelagerten Zeit. Die Teilnehmenden informieren sich, vernetzen sich, interagieren untereinander, aber auch mit den Veranstalter:innen und Akteur:innen. Im privaten Bereich werden Fahrgemeinschaften gebildet, Pläne geschmiedet, es wird eingekauft, gepackt, Vorfreude zelebriert. Die ‚Erzählung‘ beginnt. Das Event bzw. die Reise selbst werden live erlebt, aber auch in den sozialen Medien zur Story. Digitale Posts und Instagram-Storys, Tik-Tok-Videos, private oder professionelle Blogs, Postkarten, Online-Tagebücher und vor allem im B2B-Bereich auch Twitterbeiträge erzählen und kommentieren das Erlebte medial. In der Post-Event- bzw. -Reisephase wird das Erlebte in Erzählungen unter Freund:innen, in der Familie und unter Kolleg:innen manifest. Diese Erzählungen über Aktivitäten und Erlebtes über die Pre-, Live- und Post-Event-/Reisephase konstruieren eine Wahrnehmung der Identität einerseits, andererseits beziehen Aktivitäten und das Erlebte aber ihren Sinn aus der Story, im Kontext derer sie erlebt werden. Diesen Zusammenhang aus eigener Story, Selbstwahrnehmung der Identität und Sinnbezug bestätigt Fernandez (2021) im Kontext seiner Analyse zum Einfluss von Covid-19-Maßnahmen auf die narrative Dimension des menschlichen Lebens. Der Biologe und Hirnforscher Werner Siefer (Siefer 2015, S. 159ff.) erklärt aus Perspektive der menschlichen Evolution, dass Erzählungen ein autobiografisches Gedächtnis formen und das „Ich entstehen [lassen]“ (ebd., S. 159). Er betont die Zukunftsgerichtetheit von verinnerlichten Geschichten und deren besondere Bedeutung bei der Entstehung eines Erfahrungsschatzes und bei der Lösung für Probleme, die zuvor bereits in ganz ähnlicher Weise aufgetreten sind (ebd., S. 160f.).