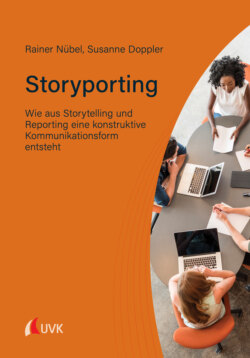Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 5
1.1 Fiktionales Erzählen in Filmen und Serien
ОглавлениеRomane, Theaterstücke, Kino- und Fernsehfilme oder Serien stehen typischerweise für die fiktionale NarrationNarrationfiktionale. Romanautor:innen und Drehbuchschreiber:innen haben die Lizenz zur Erfindung jeglicher nur denkbaren oder imaginären Figuren, Handlungen und Welten. Sie sind nicht an realitäre Räume und Zeiten gebunden, können die unglaublichsten Dinge und kühnsten Utopien schildern. Doch sehr häufig beinhalten fiktionale Texte Bezüge zu realen Orten, historischen Zeiträumen oder Sachverhalten. Und insbesondere in der Rezeption des fiktionalen StorytellingStorytellingfiktionaless kommen Aspekte des Faktualen zum Tragen: Rezipient:innen erwarten meist nicht nur Kohärenz, Verständlichkeit und Logik, sondern fordern nicht selten, dass auch erfundene Geschichten ,realistisch‘ sein sollen.
Tatort-Drehbuchautor:innen kennen dies. Wenn sie in einem – fiktiven – Mordfall die TV-Kommissar:innen mit Strategien und Methoden jenseits des professionellen Polizeialltags ermitteln lassen, lässt die Kritik an den Macher:innen der ARD-Krimikultserie nicht lange auf sich warten: „viel zu unrealistisch.“ Inzwischen werden nach Ausstrahlung der Krimis Fakten-Checks zu deren Realitätsgehalt publiziert. Wahrgenommene Widersprüche zwischen der fiktiven Erzählwelt und der selbst erlebten oder empirisch nachprüfbaren Welt des Faktualen können bei Rezipient:innen also kognitive DissonanzenDissonanzenkognitive auslösen.
Weichen Inhalte eines Spielfilms von gesellschaftlich-konventionellen Denkmustern, Realitätsdarstellungen, Frames, brain scripts und Narrativen ab, kann die evozierte Dissonanz sogar hochpolitisch konnotiert sein. Fast schon zu einer Staatsaffäre wuchs sich 2017 die Stuttgarter Tatort-Folge „Der rote Schatten“ aus. Regisseur Dominik Graf hatte nicht nur zeitgeschichtliche Dokumente zum RAF-Terror im Jahr des ‚Deutschen Herbstes‘ 1977 in den Krimi eingebaut. Vielmehr hatte er die in linken Kreisen lange ventilierte Spekulation, das Führungstrio um Andreas Baader habe im Stammheimer Hochsicherheitstrakt nicht Selbstmord begangen, sondern sei von einem Mordkommando umgebracht worden, szenisch durchgespielt. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sah sich damals, nachdem die Bild-Zeitung bereits großbuchstabig die Skandalisierungsmaschine angeworfen hatte, zu einer staatlich-offiziösen Kritik an einer fiktionalen Krimiserie veranlasst: Der Tatort habe „die Märtyrerlegende vom Justizmord an den Häftlingen“ wiederaufleben lassen (Körte 2017).
Gerhard Baum, der in der ‚bleiernen‘ Zeit der RAF-Morde an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer und anderen Repräsentanten des Staates Bundesinnenminister war, warf dem Tatort-Regisseur vor, „die unerträgliche Vermischung von Realität und Fiktion“ sei „unverantwortlich“ (Körte 2017). Dies löste wiederum im Feuilleton deutscher Medien Erregung aus. „Was Baum unerträglich findet, man muss leider so trivial werden, ist das Prinzip fiktionalen Erzählens in Literatur, Film und Theater“, schrieb Peter Körte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (ebd.). „Dass er es so unerträglich findet, mag auch damit zu tun haben, dass Graf ein unausgesprochenes Bilderverbot übertreten hat. Zu sehen, wie die Häftlinge getötet werden, hat eine größere Wucht, als würde lediglich darüber gesprochen“ (ebd.). Man solle trotzdem das Durchspielen von Möglichkeiten nicht mit einer These verwechseln (ebd.). Und der Kulturjournalist gab zu bedenken:
„Wenn die empörten Kritiker im staatstragenden Ton warnen, nach Ansicht des Films werde man die Tötung für die amtliche Version der Wahrheit halten, dann erklären sie implizit das Publikum für unfähig zu begreifen, was sie selbst natürlich durchschaut haben; es treibt sie dabei weniger die Sorge um fatale Auswirkungen auf das politische Bewusstsein der Nation als die Angst um ihre Deutungshoheit, die sie mit Filmen wie dem ‚Baader-Meinhof-Komplex‘ durchgesetzt glauben. Für diese Hegemonie ist Grafs Verfahren natürlich ein Affront, weil auch die immergleichen RAF-Bilder, die zirkulieren, nun konkurrieren müssen mit neuen“ (Körte 2017).
Reflexion | Was denken Sie?
Wie realistisch sollen oder dürfen fiktive Filme sein?
Dieses Fallbeispiel zeigt exemplarisch, wie stark die Wirkung von Narrativen in einem fiktionalen Genre auf das Verständnis oder die Konstruktion von Realität im faktualen Kontext sein kann.