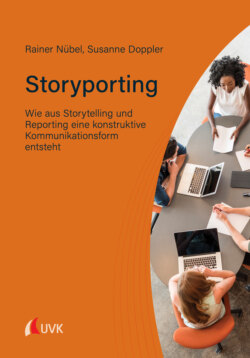Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 8
Die Heldenreise als narratives Grundmuster
ОглавлениеBei allen transformationsbedingten Neuerungen und Entwicklungen im Filmbereich scheinen die Grundstrukturen des fiktionalen Storytellings derweil gleichzubleiben und in gewisser Weise archetypisch zu sein. In Gesprächen, Vorträgen oder Workshops zu ihrem Metier verweisen Drehbuchautor:innen häufig auf dieselben oder zumindest sehr ähnliche Regeln, mit denen sie arbeiten: Authentisch zu sein, lautet eine Regel, eine Geschichte bzw. Handlung aus den Figuren heraus zu schildern, eine andere. Dies bedeutet, sich in die erfundenen Figuren hineinzudenken, ihre mögliche Biografie, ihre Entwicklungen, Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte oder auch Abgründe kohärent zu konstruieren und die möglichen Beweggründe für das, was sie tun, auszuloten. „Wenn ich eine Figur einen Mord begehen lasse“, erzählte etwa Jürgen Werner im Dezember 2020 vor Studierenden in Heidelberg, „versuche ich mich zuvor in sie hineinzuversetzen und frage mich: warum tue ich das, geschieht es aus Rache, habe ich ein Sohn-Vater-Problem, oder welches andere Motiv habe ich?“
Für Werner, der Drehbücher sowohl für den Tatort als auch für die ZDF-Romantikserie Traumschiff schreibt, ist es zudem besonders wichtig, die ersten Szenenfolgen in beiden Genres so zu setzen und zu arrangieren, dass sich die Rezipient:innen ‚wohlfühlen‘. Er meint damit, dass das Publikum Situationen, Figuren und Zusammenhänge antrifft, die ihm vertraut sind. Man könnte auch sagen: die einer bekannten Ordnung entsprechen. Dazu dienen StereotypenStereotypen. Das David-Goliath-Prinzip gehört dazu. Jürgen Werner führt in diesem Kontext gerne die Figur des zerknautschten und notorisch unterschätzten Kommissars Columbo aus der gleichnamigen US-Krimiserie an. Dass Columbo am Anfang heillos überfordert und linkisch wirkt, am Ende aber den Mordfall auf seine eigene knitze Weise lösen wird, weiß das Publikum nach den ersten Folgen. „Das ist nicht langweilig“, sagt Werner, „vielmehr will das Publikum wissen, wie Columbo es schafft.“ Gängige Erzähltricks, gerade in Krimis, sind auch der Einsatz des ‚roten Herings‘ als Handlungselement, bei dem die Erwartungen der Rezipient:innen bewusst in die falsche Richtung gelenkt werden und Überraschung evoziert wird, wenn die falsche Fährte evident wird, oder die überraschende Wendung, der Plot-Twist.
Sprechen Drehbuchautor:innen darüber, wie sie erzählen, welchen Mustern sie folgen, fällt meist ein Schlüsselbegriff des filmischen Storytellings: hero’s journey – die HeldenreiseHeldenreise. Grundlage des im Filmbereich mitunter fast schon zu einem Erzählgesetz mutierten Modells sind die Forschungen des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Joseph Campbell in den 1950er-Jahren zu Märchen, Mythen und modernen Erzählungen. Aus seiner Analyse Der Heros in tausend Gestalten leitete er die Heldenfahrt als Grundstruktur des Geschichtenerzählens ab, die der Hollywood-Berater, Film-Dozent und Autor Christopher Vogler Ende der 1990er-Jahre in seinem Buch Die Odyssee des Drehbuchschreibers in leichten Abänderungen auf den Film übertrug. Bekannte Filmemacher wie George Lucas, Steven Spielberg oder Francis Ford Coppola ließen sich von Campells Modell sehr stark inspirieren oder es zeigen sich in ihren Arbeiten Einflüsse davon (Vogler 2018, S. 35 u. 41).
Die Ausgangssituation der zyklisch strukturierten Heldenreise liegt darin, dass der Held sich in seiner gewohnten alltäglichen Welt befindet, von der aus er in „eine andersartige, neue und fremde Welt“ (Vogler 2018, S. 48) aufbricht. Wenn der Held dann den ‚Ruf des Abenteuers‘ erhält, Stadium zwei, wird er „mit einem Problem konfrontiert; er steht vor einer Herausforderung oder muss sich auf ein Abenteuer einlassen“ (ebd., S. 49). Zunächst weigert sich der Held, dem Ruf des Abenteuers zu folgen, Stadium drei. In dieser Situation begegnet er einem Mentor. Daraufhin überschreitet er die erste Schwelle, nimmt das Abenteuer an und begibt sich „zum ersten Mal völlig in die besondere Welt seiner Geschichte“ (ebd., S. 52). Für Vogler geht die Geschichte im Grunde erst mit diesem fünften Stadium richtig los, er verweist in diesem Kontext auf die gängige Drei-Akt-Struktur von Filmen: „Im ersten geht es um die Entscheidung des Helden zu handeln, im zweiten um die Handlung selbst und im dritten um die Konsequenzen, die daraus entstehen“ (ebd., S. 52f.).
Jetzt steht der Held vor Prüfungen und Bewährungsproben, er findet Verbündete, stößt aber auch auf Feinde. Besonders häufig scheinen Kneipen oder Bars die Schauplätze dieses sechsten Stadiums zu sein (Vogler 2018, S. 53f.). Dann betritt der Held einen gefährlichen Ort, er dringt im siebten Stadium der hero’s journey ‚zur tiefsten Höhle‘ vor, wo große Gefahr droht (ebd., S. 55). Bei der ‚entscheidenden Prüfung‘, dem achten Stadium, muss der Held „seine größte Angst bezwingen; ihm steht der Kampf auf Leben und Tod mit einer feindlichen Macht bevor“ (ebd., S. 56). Nach dem erfolgreichen Bestehen der entscheidenden Prüfung bekommt er seine Belohnung – „den Schatz, um dessentwillen er aufgebrochen war“ (ebd., S. 57). Dabei kann es sich laut Vogler um eine spezielle Waffe, einen symbolisch-essenziellen Gegenstand oder aber um erworbenes Wissen und Erfahrung handeln (ebd., S. 57f.).
Mit dem anschließenden ‚Rückweg‘, dem zehnten Stadium, beginnt in Voglers Dramaturgie der filmischen Heldenreise der dritte Akt, in dem sich der Held „den Konsequenzen stellen muss, die sich aus seiner Begegnung mit den dunklen Mächten in der entscheidenden Prüfung ergeben haben“ (Vogler 2018, S. 59). Verfolgungsszenen resultieren daraus, gleichzeitig fasst der Held in diesem Stadium der Handlung die Entscheidung, in seine gewohnte Welt zurückzukehren. Bevor er dort ankommt, verändert durch die erlebten Abenteuer und Herausforderungen, muss er in einer letzten Prüfung seine ‚Auferstehung‘ erleben, d. h. er muss in diesem elften Stadium beweisen, „dass er seine Lektionen aus der entscheidenden Prüfung auch wirklich gelernt hat“ (ebd., S. 60). Schließlich kehrt der Held in seine alltägliche Welt zurück – mit einem erworbenen Elixier, einem Schatz oder neuem Wissen.
Nach diesem Grundmuster des Mythos, davon ist Vogler überzeugt, „lässt sich der schlichteste Comic genauso entwickeln wie das anspruchsvollste Drama“ (Vogler 2018, S. 64). Die Reise des Helden sei eine sehr flexible Vorlage, die „endlose Variationen“ (ebd.) erlaube, ohne dabei ihre ursprüngliche Magie zu verlieren, betont der Filmexperte und scheint damit präventiv die Kritik ausräumen zu wollen, dass der Ansatz (allzu) hermetisch oder dogmatisch sein könnte. Es gebe auch Geschichten, in denen der Held eine Reise nach innen antrete (ebd., S. 46). Das Grundmuster gilt demnach auch für das Genre der Romantikfilme. „Die Abenteuer solcher Reisen des Gefühls“, so Vogler, „nehmen das Publikum gefangen und machen eine Geschichte lesens-, hörens- und sehenswert“ (ebd.). Gute Geschichten vermitteln den Rezipient:innen demnach das Gefühl, „etwas Neues über das Leben oder über uns selbst gelernt zu haben“ (ebd., S. 30). Dies bedeutet, dass Storys einerseits die Selbsterfahrung von Menschen abrufen und andererseits neue oder andere Facetten des Lebens vergegenwärtigen, damit das Erfahrungspotenzial erweitern.
Die Wirkung und Reichweite dieses Heldenreisen-Modells sind beachtlich. Wie Vogler im Vorwort der 2018 erschienenen Ausgabe seines Buches schreibt, „ziehen nicht mehr nur Autoren aller Provenienzen und Genres die Odyssee bei ihrer Arbeit heran, sondern auch Lehrer, Psychologen, Werbeleute, Strafvollzugsexperten, Mythenforscher und Wissenschaftler, die sich mit der Popkultur beschäftigen“ (Vogler 2018, S. 12). Der Hollywood-Berater hat auf seinen Vortragsreisen allerdings festgestellt, dass der Begriff ‚Held‘ nicht überall auf Akzeptanz stößt. Die deutsche Kultur hat nach seiner Wahrnehmung ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu, was er historisch begründet. Der Nationalsozialismus und der deutsche Militarismus hätten die Symbole des Heldenmythos für ihre Zwecke missbraucht, indem sie damit Unterwerfung, Entmenschlichung und Zerstörung beschworen hätten. Nach 1945, im Kontext der Reorganisation kultureller Werte, legte man nach Voglers Darstellung keinen Wert auf die Idee des Helden (ebd., S. 20f.).
„Leidenschaftslose, kühle Anti-Helden entsprechen dem derzeit in Deutschland vorherrschenden Geschmack eher; ein Anklang von unsentimentalem Realismus wird hier deutlich bevorzugt, obgleich auch ein gewisser Hang zum Romantizismus und ein Faible für Fantasy spürbar sind“ (Vogler 2018, S. 20f.).