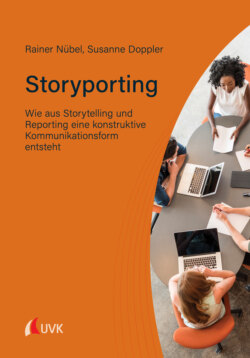Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 11
Оглавление1.2 Medienpsychologische Perspektive
Aus der Perspektive der MedienpsychologieMedienpsychologie ist wiederum die Frage relevant, warum Menschen bestimmte TV- oder Kinofilme bzw. Genres auswählen und rezipieren. Der Uses-And-Gratifications-Ansatz geht davon aus, dass Menschen Medien und deren Narrative nutzen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Die aktive Medienselektion und -rezeption erfolgt demnach immer funktional und dient der Erreichung gewünschter Wirkungen. Wichtig sind dabei das Informations- und Unterhaltungsbedürfnis. Die GratifikationGratifikation stellt die Befriedigung und Motive einer Person dar (Batinic/Appel 2008, S. 113f.). Spielfilme und andere Medien können ablenken oder nützlich sein für persönliche Beziehungen, indem man z. B. mit anderen über Filminhalte sprechen kann oder glaubt, mit den Protagonist:innen bzw. Held:innen soziale Beziehungen aufzubauen. Sie können aber auch helfen, eine eigene Identität zu entwickeln oder die eigenen sowie andere Unwahrheiten zu verstehen (ebd., S. 157).
Die Entscheidung zur Nutzung eines bestimmten Medienangebots hängt nach diesem Ansatz zum einen von Persönlichkeitsmerkmalen wie Extraversion, Ängstlichkeit oder Offenheit für Erfahrungen ab, zum anderen von den momentanen Befindlichkeiten und Bedürfnissen. Letzteres kann, als affektives Bedürfnis, die Ablenkung von eigenen Problemen durch das stellvertretende Erleben nicht erfüllter Wünsche (emotional release) sein, damit auch ein eskapistisches Bedürfnis, aber auch die Identifikation mit den Helden und deren Lebensstil (wishful thinking) oder, als kognitives Bedürfnis, die Suche nach Anregungen für das eigene Leben (advice) aus anderen, erzählten Lebensgeschichten (Batinic/Appel 2008, S. 113f.). Der soziale Kontext einer Medien- oder Filmwahl, so lautet eine Kritik an diesem Ansatz, wird dabei kaum berücksichtigt (ebd., S. 116).
StimmungsmanagementStimmungsmanagement und SensationslustSensationslust
Ausgehend von der generellen These, dass es im Fernsehverhalten zwei entgegengesetzte Motive gibt, nämlich Entspannung und Abbau von Stress auf der einen, die Suche nach Aktivation und Aufregung auf der anderen Seite, wurden zwei verfeinerte Ansätze zur Medienselektion und -nutzung entwickelt: Nach der vom US-Forscher Dolf Zillmann in den 1980er-Jahren erarbeiteten Mood-Management-TheorieMood-Management-Theorie wählen Menschen TV-Angebote so aus, dass ihr erwünschter emotionaler Zustand erreicht wird. Damit nehmen sie aktiv Einfluss auf ihren aktuellen Stimmungszustand. Ziel der Medienauswahl ist demnach die Herstellung eines positiven Gefühlszustands und die Minimierung von aversiven Gefühlen. Dieser Prozess erfolgt automatisiert und ist weitgehend frei von willentlicher Steuerung. Positive Erfahrungen führen jedoch dazu, dass auch künftig eine solche Auswahl getroffen wird. Menschen betreiben demnach aktives Stimmungsmanagement. Wählen sie traurige Filminhalte aus, etwa die Titanic-Tragödie, verbindet sich das Erleben medialer Trauer mit positiver Selbstattribution – man spricht sich z. B. die Fähigkeit zur Empathie selbst zu (Batinic/Appel 2008, S. 116ff.).
Der andere Ansatz adressiert das sensation seeking als wichtiges Motiv der Medienwahl und -nutzung. Sensationslust wird dabei als Persönlichkeitsmerkmal gesehen. Der amerikanische Psychologe Marvin Zuckerman hat in seinen langjährigen Forschungen zum sensation seeking vier Komponenten ausgemacht: die Suche nach dem Nervenkitzel (thrill and adventure seeking), nach Lebenserfahrungen, die über die bisherigen hinausgehen (experience seeking), die Suche nach ‚enthemmten‘ sozialen Stimuli (disinhibition seeking) und die Vermeidung von Langeweile (boredom susceptibility). Spannung wird positiv erlebt und führt zu einer positiven Bewertung des entsprechenden Filmes, wie Untersuchungen zur Wirkung von Filmen zeigen. Sensation seeker bevorzugen Action-, Abenteuer-, Horror- und Erotikfilme sowie im Musikbereich Hardrock (Batinic/Appel 2008, S. 160f. u. 118).
Im Kontext der affektiven Medienwirkungen spielt gerade bei fiktionalen Medienprodukten wie Filmen oder Fernsehserien das Mitfühlen und Mitfiebern der Rezipient:innen mit den Protagonist:innen oder, in der Terminologie der hero’s journey, mit den Helden der erzählten Geschichten eine wichtige Rolle. Die Rezipient:innen dieses Storytellings versetzen sich emphatisch in die Gedanken und Gefühle positiv konnotierter Akteur:innen, bangen mit ihnen mit, wenn sie in gefährliche Situationen geraten oder Schicksalsschläge erleiden. Über dieses emphatische Erleben können aber auch negative emotionale Verbindungen zu Protagonist:innen fiktionaler Storys entstehen (Trepte/Reinecke 2019, S. 92f.). Die von Rolf Zillmann entwickelte Affective-Disposition-Theorie sieht eine starke Wirkung von positiver und negativer Voreingenommenheit auf das rezeptive Erleben solcher Geschichten:
„Während wir mit geliebten Medienfiguren mitfiebern, empathisch auf sie reagieren und uns einen möglichst positiven Ausgang für sie wünschen, verhält es sich bei Charakteren, denen gegenüber wir negative affektive Dispositionen entwickelt haben, genau umgekehrt. Für Filmschurken empfinden wir in der Regel Verachtung und wünschen ihnen die gerechte Strafe“ (Trepte/Reinecke 2019, S. 94).
Emotionale Spannung und Erregung, die sich in der Rezeption von Spielfilmen, damit von fiktionalem Storytelling, aufbaut, kann von einer Szene in die nächste oder übernächste überschwappen, also intensiv nachwirken. Auf dieses Phänomen bezieht sich der Ansatz des excitation transfer. Demnach haben emotionale Reaktionen auf mediale Stimuli eine länger anhaltende, nachhaltigere Wirkung als kognitive. Dies bedingt, dass die in einem Storyteil aufgebaute emotionale Erregung die Wahrnehmung nachfolgender Sequenzen stark beeinflussen und damit die Rezeptionserfahrung dominant prägen kann. Kommt es, nach dem Aufbau eines großen Anspannungspotenzials in den vorangegangenen Storypassagen, zum Happy End, werden die positiven Emotionen, z. B. Euphorie und Erleichterung, noch intensiver wahrgenommen (Trepte/Reinecke 2019, S. 96).
Identifizierung mit Story-Figuren
Die intensive Auseinandersetzung mit Filmstory-Figuren kann zur Illusion einer direkten realen Interaktion mit diesen führen. Die Rezipient:innen glauben dann, die Protagonist:innen bestens zu kennen, was im TV-Bereich etwa bei Moderator:innen wie Günther Jauch oder Marietta Slomka nicht selten der Fall ist. Die Medienpsychologie spricht in diesem Zusammenhang von parasozialen Interaktionen (Als-ob-Interaktionen), die sich bei mehrfachen Begegnungen mit Medienfiguren zu parasozialen Beziehungen entwickeln können (Trepte/Reinecke 2019, S. 100–102). Die Identifikation mit einer Story-Figur geht darüber hinaus, in diesem Fall liegt keine Trennung zwischen Rezipient:in und Protagonist:in mehr vor.
„Vielmehr kommt es zu einem ‚Verschmelzen‘ der Perspektive der Rezipienten und des Mediencharakters, die Rezipienten tauchen also in die narrative Medienwelt ein, schlüpfen in die Rolle der Medienfigur und machen sich für einen begrenzten Zeitraum deren Eigenschaften und Gefühle zu eigen“ (Trepte/Reinecke 2019, S. 104).
Wie intensiv die Beschäftigung mit einem medialen Reiz, etwa dem fiktionalen Storytelling in einem Film, ausfällt und welche Relevanz Inhalte der darin vermittelten Botschaften haben, ist Gegenstand des Konzepts des InvolvementsInvolvement, das auch aus der Konsumentenforschung bekannt ist (Kroeber-Riel/Gröppel-Klein 2019). Das Präsenzerleben als medienpsychologisches Konzept hingegen bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung von Rezipient:innen, tatsächlich vor Ort in der erzählten, medial vermittelten Welt zu sein (Trepte/Reinecke 2019, S. 109–111).