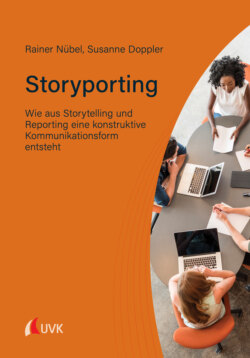Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 3
Vorwort
ОглавлениеGibt man den Begriff ‚Storytelling‘ bei Google ein, werden um die 100 Millionen Ergebnisse angezeigt. Die Methode der narrativen Darstellung und Vermittlung von Erfahrungswissen, Informationen, Themen, Ereignissen oder auch Produkten hat in Deutschland und international Hochkonjunktur, insbesondere im Bereich der Unternehmenskommunikation, speziell im Marketing, sowie in den sozialen Medien. Zahlreiche Fachbücher und Praxisratgeber empfehlen Storytelling, weil es Emotionen, Involvement, Identifizierung, recognition, Persuasion und schließlich Kaufinteresse stärker zu evozieren scheint als die nüchtern-sachliche, datenzentrierte oder auf Argumente setzende Darstellung (z. B. Müller 2014, S. 9–17).
In der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Narration und Storytelling wird häufig auf den anthropologischen Aspekt verwiesen, dass Menschen sich schon immer Geschichten erzählt haben, um Informationen auszutauschen, Erfahrungen und Traditionen weiterzugeben oder einfach um sich gegenseitig zu unterhalten (z. B. Müller 2020, S. 18ff.; Thier 2017, S. 3 u. 9.). Dass Menschen, soziale Gruppen und ganze Nationen Narrative haben und auch brauchen, um (Lebens-)Sinn und Identität zu generieren, gilt als unbestritten. Für den Soziologen Hartmut Rosa etwa sind soziale Gemeinschaften „Resonanzgemeinschaften“, weil sie „die gleichen Resonanzräume bewohnen“ (Rosa 2016, S. 267). Dies seien sie vor allem als „Narrationsgemeinschaften, die über ein gemeinsames, Resonanzen erzeugendes und steuerndes Geschichtenrepertoire verfügen“ (ebd.) Storytelling-Forscher Michael Müller ist der Überzeugung, große Massen erreiche man „mit Narrativen und Geschichten, die auf Resonanz stoßen“ (Müller 2020, S. 15).
Anschaulich und emotional erzählte Geschichten mit interessanten Protagonist:innen, starkem Spannungsbogen, einem Prozess der Veränderung und am Ende gelösten Konflikten gelten weithin als wirkungsvoller als die rein sachlich-logische Darstellung. Der Einsatz von Storytelling gerade im Unternehmenskontext wird daher inzwischen selbst zur Aufbereitung von Daten (Nussbaumer Knaflic 2015) und für Bereiche wie Controlling und Rechnungswesen empfohlen, die bisher eindeutig oder ausschließlich vom Reporting, der nüchternen Darstellung von Daten und Kennzahlen, dominiert waren (z. B. Langmann Consulting & Training o. J.). Storys, so wird häufig argumentiert, nehmen die Rezipierenden mit auf eine (Helden-)Reise in zunehmend komplexer gewordene Realitäten, aktivieren deren Selbsterfahrung und erzeugen Identifizierung und Akzeptanz. All dies kann gerade heute von großer Bedeutung sein, in dieser Zeit des tiefgreifenden Wandels, von dem sämtliche gesellschaftliche Funktionsbereiche, alle Berufsfelder und Menschen betroffen sind und der bei vielen Unsicherheit und auch Ängste auslöst. Als größter Treiber dieser Transformation gilt die Digitalisierung, doch es sind u. a. auch die weitergehende Globalisierung, demografische, politische, sozioökonomische und kulturelle Entwicklungen zu berücksichtigen sowie auch und besonders der Wandel der öffentlichen Kommunikation.
Gerade in diesem essenziellen Kontext tritt freilich ein großes Aber in den Fokus: Storytelling steht immer stärker unter dem Verdacht des Manipulativen. Im medialen Bereich ist es u. a. die Relotius-Affäre um erfundene bzw. gefälschte Reportagen, die das Misstrauen gegen das publizistisch-professionelle Erzählen verstärkt und das sowieso schon zunehmend gestörte Verhältnis zwischen Medien und Publikum (Weischenberg 2018; Wolf 2015) weiter beeinträchtigt hat. Dass mit Storytelling Menschen stark beeinflusst werden können, stellen seriöse Forschende nicht in Zweifel (z. B. Müller 2020; Thier 2017; Prinzing 2015). Doch häufig werden fast im selben Atemzug die Vorzüge und Chancen von Storytelling beschworen, häufig verbunden mit dem Hinweis auf das scheinbar größere Wirkungspotenzial von erzählten Geschichten. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend gezeigt, dass strategisch-manipulativ eingesetzte oder häufig auch bewusst verkürzte Narrative Bevölkerungen spalten, Radikalismus und demokratiefeindliche Tendenzen befördern können. Besonders evident wurde dies in der Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump, der mit rassistisch konnotierten Narrativen wie „Make America great again“ oder dem Narrativ eines gänzlich unbewiesenen Wahlbetrugs solche Spaltungswirkungen evoziert hat. Auch in Deutschland setzen populistische Gruppierungen verkürzte oder lügenhafte Narrative verstärkt und nicht selten wirkungsvoll für demokratiefeindliche Propagandazwecke ein.
Hinzu kommen Hatespeech-Narrative in sozialen Medien und die evidente Zunahme von Verschwörungsgeschichten, die laut einer 2021 erschienenen Studie im Kontext der Coronapandemie weiter forciert wurde (Schüler et al. 2021). Gleichzeitig führt die ausgeprägt narrative Performance-Kultur in sozialen Medien, mit immer neuen geposteten Erfolgs- oder Aufreger-Storys, zu einem „endlosen Aufmerksamkeits- und Valorisierungswettbewerb“ (Reckwitz 2018, S. 179), unter dem nicht wenige User:innen zunehmend leiden. Negative Erfahrungen, etwa des Scheiterns oder der Krise, werden nach der Analyse des Soziologen Andreas Reckwitz in der heutigen digitalen Affekt- bzw. Positivkultur unterdrückt oder vermieden. Einzigartig, singulär sein zu sollen in diesem Aufmerksamkeitswettbewerb generiert einen „Profilierungszwang, der zugleich ein Originalitäts-, Kreativitäts- und Erlebniszwang ist“ (Reckwitz 2018, S. 266).
Darüber hinaus ist die in nicht wenigen Fachbüchern und Praxisratgebern formulierte Euphorie, was die scheinbar deutlich größeren Wirkungspotenziale narrativer Darstellungsformen gegenüber nichtnarrativen angeht, nur bedingt angebracht und daher mit Vorsicht zu genießen. Dies lässt sich aus Metastudien ableiten, in denen jeweils eine größere Anzahl publizierter Studien zu kognitiven, emotionalen oder evaluativen und motivational-konativen Wirkungen des Storytellings analysiert wurden. Der Leipziger Kommunikationsforscher Felix Frey hat 2014 einen solchen systematischen Forschungsüberblick vorgelegt, in dem er 70 Studien aus 55 Publikationen analysiert hat (Frey 2014, S. 120–192). Der überwiegende Teil (75 Prozent) der Studien stammt aus den USA (ebd., S. 141). Die untersuchten Studien waren in den allermeisten Fällen (74 Prozent) in einem kommunikationswissenschaftlichen Anwendungskontext realisiert worden, u. a. in den Bereichen Werbung, Journalismus, politische Kommunikation und Gesundheitskommunikation. Studierende machten mit 70 Prozent in den Studien den überwiegenden Teil der Proband:innen aus (ebd.).
Im Gesamtergebnis stieß Frey zwar auf einige belastbare Studien, die Effekte narrativer Darstellungsmodi auf die (kurzfristige) Erinnerung und auch Einstellungen sowie für Wirkungen auf Intentionen belegen (Frey 2014, S. 165). Doch wenn, so führt Frey kritisch aus, eine bestimmte Tendenz feststellbar sei, lägen fast immer auch gegenteilige Befunde sowie Studien ohne statistisch abgesicherte Ergebnisse vor (ebd., S. 166). Tendenzielle Belege oder Hinweise, allerdings mit eingeschränkter Aussagekraft, fand er in folgenden Bereichen:
„Narrative Kommunikate scheinen im Vergleich zu nicht oder weniger narrativen mehr Aufmerksamkeit zu generieren, eher holistisch verarbeitet zu werden, die Vorstellungstätigkeit bei der Rezeption stärker anzuregen und (auf der Basis von objektiven Maßen wie Lesezeiten) verständlicher zu sein. Sie werden als lebhafter und realistischer eingeschätzt, steigern die Selbstwirksamkeitserwartung der Rezipienten bezüglich eines thematisierten Themas, werden tendenziell kurz- und mittelfristig besser erinnert und haben intensiveres Erleben spezifischer Emotionen während der Rezeption zur Folge als nicht narrative Botschaften“ (Frey 2014, S. 166).
Frey stellte aber auch negative Effekte narrativer Kommunikation fest: Demnach werden narrative Botschaften als weniger informativ wahrgenommen und mittelfristig schlechter bewertet als nichtnarrative (Frey 2014, S. 166f.). Keine Über- oder Unterlegenheit narrativer Kommunikation könne für die subjektiv wahrgenommene Verständlichkeit, für botschaftskonforme Überzeugungsänderungen und den kurzfristig erhobenen Wissenserwerb konstatiert werden. Denn: Signifikante Befunde in beide Richtungen hielten sich die Waage (ebd., S. 167). Der Kommunikationsforscher hält ein Mehr an methodisch hochwertigen Studien für notwendig, besonders wichtig seien jedoch stärker theoretisch-konzeptionell ausgerichtete Arbeiten (ebd., S. 171).
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Ettl-Huber et al. (2019) in einer Analyse von 62 wissenschaftlichen Beiträgen zur Wirkungsforschung von Storytelling, in denen 76 Einzelstudien durchgeführt worden waren. Demnach weisen 37 Beiträge methodische Mängel auf. So waren z. B. bei fast der Hälfte der 76 Einzelstudien ausschließlich Schüler:innen oder Studierende die Proband:innen, entsprechende Aussagen konnten also nur auf diese eine, junge Zielgruppe und nicht in Bezug auf die Gesamtbevölkerung getroffen werden (Ettl-Huber 2019, S. 38).
Die stärksten Effekte konnten laut dieser Metastudie bei Verständlichkeit, Überzeugungskraft/Handeln und Erinnerung bewiesen werden. Glaubwürdigkeit zeigt demnach neben einem starken Effekt auch drei mittlere Effekte (Ettl-Huber et al. 2019, S. 37). Dass die meisten starken Effekte für die Emotionalisierung festgestellt werden konnten, bedeute nicht, dass damit in Marketingkommunikation, PR und Journalismus bereits eine relevante Wirkung beschrieben werde. „Denn eine emotionalisierte LeserInnenschaft bedeutet noch kein kaufendes oder zustimmendes Publikum“ (ebd.). Ettl-Huber et al. weisen zudem auf zwei „eher ernüchternde Ergebnisse zur Wirkung von Storytelling“ (ebd., S. 38) hin. Erstens wurden unter den analysierten Beiträgen 28 kleine, 7 mittlere und 15 starke Effekte konstatiert – in der deutlichen Mehrzahl handelt es sich also um kleine Effekte (ebd.). Und: Ein bebilderter Beitrag oder Bewegtbildbeiträge „erzielen, zumindest was die Wirkungsdimension Interesse betrifft, die stärkere Wirkung als die beste Story“ (ebd.).
Ähnlich ernüchternd fallen zentrale Ergebnisse einer systematischen Untersuchung zu Wahrnehmungen und zur Wirkung von Nachhaltigkeitsgeschichten von 2017 bis 2020 an der Leuphana Universität Lüneburg aus. Die Nachhaltigkeitsstory hatte im Vergleich zu klassischen Berichten „weder eine positive Wirkung auf das situative Interesse noch auf die umweltschutzbezogenen und konsumbezogenen Handlungsabsichten der jungen Erwachsenen“ (Sundermann 2020).
All diese geschilderten Sachverhalte, Entwicklungen und Faktoren lassen die Entwicklung einer alternativen bzw. neuen Kommunikations- und Darstellungsform, in der die Stärken des Storytellings genutzt und die beschriebenen Risiken vermieden werden, sinnvoll und notwendig erscheinen. Darin liegen der Impetus und die Programmatik dieses Buches. Im Fokus steht dabei zentral die Frage: Wie können ein Kommunikationsprinzip sowie eine Methode zur Darstellung und Vermittlung von Erfahrungswissen, Sachverhalten oder auch Produkten aussehen, welche die Stärken und die sich ergebenden Chancen des Storytellings nutzen, die Schwächen ausgleichen sowie die Risiken reduzieren – und dabei den zentralen Herausforderungen der (digitalen) Transformation gerecht werden? Das Buch liefert dazu die Storyporting-Methode als eine Möglichkeit bzw. als einen zu diskutierenden Vorschlag: Seriöses Storytelling konvergiert mit evidenzbasiertem, ethikgeleitetem und zukunftsorientiertem Reporting, woraus eine Kommunikationsform entsteht, die u. a. subjektive Wahrnehmung und Analyse sowie Emotion und Kognition verbindet.
Ausgangspunkt und Grundlage für die Methodenentwicklung ist eine ausführliche literaturbasierte Bestandsaufnahme zum Einsatz des Storytellings in verschiedenen Bereichen, darunter Unternehmens- und Behördenkommunikation, Marketing, Events, klassische und soziale Medien, politische und Nachhaltigkeitskommunikation. Sie mündet in eine SWOT-Analyse (→ Kapitel 1). Wissend darum, dass der Begriff des Narrativs wie auch des Storytellings teilweise inflationär verwendet wird (Müller 2020, S. 25) und es sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kommunikationspraxis kein einheitliches Begriffsverständnis gibt (Prinzing 2015, S. 13), folgen wir dabei maßgeblich dem Diktum von Früh und Frey: Erzählen ist grundsätzlich eine „funktionale Kulturtechnik“ (Früh/Frey 2014, S. 9), die unter dem Oberbegriff ,Verständigung‘ oder ,Kommunikation‘ zusammenzufassen ist (ebd., S. 9f.).
„Narration ist also eine bestimmte Art der Verständigung bzw. Kommunikation. Je nach Gegenstand und Ziel der Verständigung haben sich deshalb diverse Varianten des Narrativen herausgebildet, bei denen die narrative Grundfunktion durch einzelne Spezifika zu prototypischen Definitionen diversifiziert wird“ (Früh/Frey 2014, S. 10).
Eine solche prototypische Definition, die uns sinnvoll auf verschiedene Einsatzfelder anwendbar erscheint, liegt darin, dass Storytelling eine Methode ist, um Informationen, Sachverhalte, Aussagen, Ereignisse und auch Erfahrungswissen erzählend, damit „dramaturgisch konstruiert“ (Prinzing 2015, S. 14), statt in nüchtern-darstellender bzw. nachrichtlicher Form zu vermitteln. Mitberücksichtigt wird das von Ettl-Huber erarbeitete und auf Erzähltextanalysen von Lahn und Meister basierende Storytelling-Elemente-Repertoire von Thema, Handlung, Figur, Zeit, Raum, Erzählinstanz, Rede und Stil (Ettl-Huber 2019, S. 28; Ettl-Huber 2014, S. 16; Lahn/Meister 2013, S. 204). Die narrative Grundstruktur lässt sich wiederum mit Müller, in Rückgriff auf die Poetik von Aristoteles, so fassen: Ausgangszustand – Transformation, durch ein Ereignis ausgelöst – Endzustand (Müller 2020, S. 23).
Aus der Bestandsaufnahme und der SWOT-Analyse zum Einsatz von Storytelling sowie dem anschließenden makroperspektivischen Blick auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische sowie kommunikative Strukturfaktoren und Entwicklungen wird im → Kapitel 2 Storyporting als Kommunikationsprinzip erwünschter Konvergenz abgeleitet – insbesondere vor dem Hintergrund stark polarisierender Tendenzen und des „kommunikativen Klimawandels“ (Pörksen/Schulz von Thun 2020, S. 16) in der heutigen digitalen Gesellschaft. Daraus wiederum wird in → Kapitel 3 Storyporting als dreistufige Kommunikations- und Darstellungsmethode entwickelt. An zahlreichen Anwendungsbereichen, neuen Tools und Formaten werden die konkreten Einsatzmöglichkeiten des Storyportings dargestellt, u. a. im Kontext von Zukunftscamps in Unternehmen/Organisationen und nachhaltiger Entwicklung, als Lerntool, neuem Talkshow-Format oder als szenisches Spiel von Transformationsprozessen (→ Kapitel 4). Schließlich geht es um Überlegungen dazu, wie Storyporting in der wissenschaftlichen Methodik verortet werden kann (→ Kapitel 5).
Da die Frage adäquater Kommunikation, gerade im zeitaktuellen Kontext der (digitalen) Transformation, von grundsätzlicher Relevanz ist, richtet sich dieses Buch an Lehrende, Studierende und Schüler:innen, aber insbesondere auch an Funktionsträger:innen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft, Medien, Kultur und Sport sowie an interessierte Bürger:innen. Wir wünschen allen Leser:innen eine möglichst anregende Lektüre, die zu einer regen Diskussion und auch kritischen Gegenrede motivieren mag.