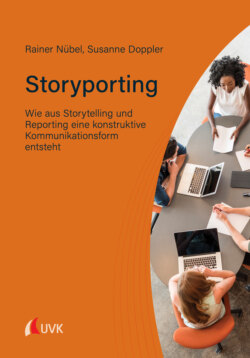Читать книгу Storyporting - Rainer Nübel - Страница 12
Оглавление1.3 Storytelling in der KonfliktberatungKonfliktberatung
Erzählte Geschichten, so zeigen die psychologischen Forschungen zum Fernseh- und Filmbereich, lösen bei Menschen sowohl kognitive als auch affektive Wirkungen differenzierter Art aus. Vor diesem Hintergrund wird fiktionales Storytelling auch in Kommunikationsprozessen von Konfliktklärung und Konfliktlösung eingesetzt. Ein Ansatz des Coachings oder der Therapie mithilfe von Storys adressiert dabei vier verschiedene Wirkungsebenen von Geschichten: die äußere Ebene des Sichtbaren, die sich über rationales Erfassen und logische Schlüsse erschließen lässt; die innere Ebene des Unsichtbaren, der Gefühle, Wünsche, Träume, Bedürfnisse, Ängste und Hoffnungen, die ganzheitliches Denken, bildhaftes Vorstellen, Intuition und Empathie fordert; die kollektive Ebene, also die jeweilige Kultur, in der Menschen aufwachsen, und deren Wertesysteme sowie die urmenschlichen Lebensthemen; die individuelle Ebene, die sämtliche angeborenen und erworbenen Eigenschaften, Merkmale, Gefühle und Bedürfnisse des Einzelnen umfasst. Komplikationen oder Konflikte entstehen demnach, wenn sich die Balance dieser Ebenen verliert, weil eine oder mehrere Ebenen dominieren (Milling 2020, S. 14–17).
Für die promovierte Mediatorin, Trainerin und Dozentin Hanna Milling, die das Storytelling in der Konfliktberatung analysiert hat, sind Geschichten bestens dazu geeignet, dass diese Ebenen erreicht und neue Verhaltensweisen sowie Handlungsmöglichkeiten generiert werden – indem Menschen selbst erlebte oder glaubhaft überlieferte Erfahrungen auf ihre aktuelle Situation übertragen.
„Durch ihre Sprachlichkeit auf der einen Seite und ihre Bildhaftigkeit auf der anderen sprechen Geschichten sowohl unseren Verstand an, unser rationales, logisches Denken – also die Ebene des Äußeren, Sichtbaren, Begreifbaren –, als auch unser Herz und unseren Bauch – also die tiefer liegende Ebene der Emotionen und Handlungsimpulse“ (Milling 2020, S. 22f.).
Konnex von Emotion und Ratio
Im Kontext solcher Ansätze wird häufig auf Ergebnisse und Erkenntnisse der aktuellen Gehirnforschung rekurriert. Bilder und Symbole aktivieren demnach stark das limbische System mit der Amygdala, wo die Emotionen angesiedelt sind. Dieses mittlere Gehirn, das zusammen mit dem Stammhirn, wo das vorbewusste Körpergedächtnis liegt, das subkortikale System bildet, reagiert deutlich schneller als das evolutionsbiologisch jüngere Großhirn (Neocortex), in dem das rational-kausale, abstrakte und logische Denken lokalisiert ist (Milling 2020, S. 25–27). Das limbische System, das zwischen ‚Denkhirn‘ und Stammhirn vermittelt, ist demnach durch bildhafte Geschichten besonders gut zu erreichen. Das Coaching in der Konfliktklärung und -lösung setzt darauf, dass Geschichten über den Konnex von Emotion und Ratio das Verhalten von Menschen positiv verändern können. Dabei haben Storys unterschiedliche Funktionen: Sie entspannen und unterhalten, fungieren als Spiegel eigener Wünsche oder Probleme, ermöglichen aber gleichzeitig auch Distanz zur eigenen Perspektive und Befindlichkeit, sie transformieren Abstraktes in anschauliche und lebendige Bilder, sie generieren Perspektivwechsel, regen die Fantasie an, bleiben im Gedächtnis und dienen als Modelle für Konfliktsituationen, aber auch für mögliche Lösungen (ebd., S. 3–49).
Milling verwendet in ihrer Arbeit gerne Weisheitsgeschichten, Märchen und Legenden. Ihre Praxisbeispiele zeigen, dass die Betroffenen von Konflikten, sei es im Privaten oder im Kontext eines Unternehmens, durch die fiktiven Texte häufig zunächst irritiert sind und diese dann aber als neue, andere Perspektive oder Handlungs- bzw. Verhaltensalternative wahrnehmen und schließlich auf ihre konkrete Situation, also auf ihre faktualen Konfliktgeschichten, beziehen. Daraus entwickelt sich im Erfolgsfall ein Lösungsansatz für die reale Konfliktgeschichte (ebd., S. 51ff.).
Wie Milling verfolgen heutzutage zahlreiche Coaches und Mediator:innen den Ansatz des Konstruktivismus.
„Wir konstruieren unsere Welt und damit unsere subjektive Wirklichkeit in und durch Geschichten (= Narrative). Wir erfinden unsere Identität, stricken unsere Biographie und geben Erlebtem und Erfahrenem Sinn, indem wir relevante Elemente des Erlebten auswählen und in einen sinnhaften Zusammenhang setzen“ (Milling 2020, S. 92).
Die individuellen Geschichten sind dabei mit den kollektiven Geschichten des soziokulturellen Umfelds verbunden. Milling legt ein Drei-Schritte-Modell für den narrativ-konstruktivistischen Umgang mit faktualen Konfliktgeschichten vor: (1) Die Konfliktgeschichten aus der individuellen Sicht der Konfliktparteien werden zunächst wertfrei nachvollzogen und als subjektive Realitäten anerkannt. (2) Start einer sensiblen Dekonstruktion der verengten Konfliktgeschichten. Dabei werden diese nicht als ‚falsche Geschichten‘ entlarvt. Vielmehr geht es darum, „das festgezurrte Gewebe der totalisierenden Konfliktbeschreibungen zu entzerren“ (Milling 2020, S. 94), dabei sichtbar zu machen, welche Elemente für die Geschichte ausgewählt und in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht wurden, und schließlich den Blick für weitere, bisher nicht berücksichtigte Elemente und Deutungsmöglichkeiten zu öffnen. (3) Die Konfliktparteien werden darin unterstützt, mit den entzerrten Strängen und Elementen der verschiedenen Konfliktgeschichten eine alternative, gemeinsame Geschichte zu generieren, in die unterschiedliche Sichtweisen sowie bislang unberücksichtigte Elemente und Deutungen integriert werden können (Milling 2020, S. 94f.).