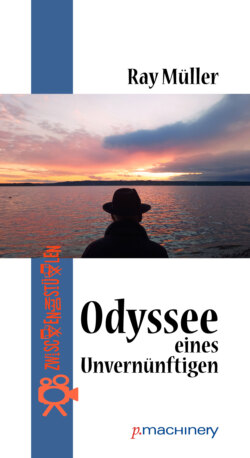Читать книгу Odyssee eines Unvernünftigen - Ray Müller - Страница 13
7
ОглавлениеWie manche Geschichte, begann auch diese mit einer Reise. Ich war mit zwei Freunden in Peru unterwegs. In Lima kauften wir ein Ticket für den damals höchsten Zug der Welt. Der Ort, wo er am Ende ankommen würde, war uns egal, es ging um die Fahrt. Sie beginnt auf Meereshöhe, dann kämpft sich die Bahn in Steilkurven langsam höher.
Auf halber Strecke gibt es eine kurze Pause, das Personal wechselt. Eine Schicht fährt immer von unten bis zur halben Höhe, die andere von dort bis zur Endstation. Den Höhenunterschied der ganzen Strecke kann man niemandem zumuten, auch nicht in Peru. Im Zug sitzt auch immer ein Arzt mit Sauerstoffgerät, für alle Fälle.
Es wird eine spektakuläre Fahrt. Am späten Nachmittag kommen wir an. Die Endstation heißt Cerro de Pasco. Wir erfahren, hier ist eine Mine. Die kleine Stadt liegt auf viertausenddreihundert Metern. Kaum sind wir ausgestiegen, spüren wir den eiskalten Wind. Noch nie waren wir in dieser Höhe, noch nie an einem so trostlosen Ort. Anfangs atmen wir schwer und gehen langsam. Hagere, ausgemergelte Gestalten begegnen uns, die Häuser der engen Gassen sind so bedrückend wie die Gesichter der Menschen. Nach kurzer Zeit haben meine Begleiter Probleme mit der dünnen Luft. Einer fährt mit dem Taxi wieder hinab ins Tal, der andere will nur noch ins Hotel und schlafen. Ich bin noch nicht müde und schlendere durch die Gassen. Ärmliche Häuser, ärmliche Menschen. Dem Elend ins Gesicht zu sehen, wenn man davon nicht betroffen ist, ist unangenehm. Nicht immer ist es leicht, damit umzugehen. Ich bin privilegiert, kann jederzeit wieder abreisen. Die Leute, denen ich begegne, können das nicht. Das sieht man ihnen an. Deshalb weiche ich ihrem Blick mitunter aus und lasse meinen über die Dächer wandern. Die mächtigen weißen Gipfel der Anden glänzen im letzten Licht des Tages. Ein kurzer Moment von Romantik, die man wohl nur als Besucher empfindet.
Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwindet, wird der Wind noch eisiger. Ich fange an zu zittern, trotz Anorak. Langsam habe ich das Bedürfnis, in mein Hotel zu flüchten. Doch vorher will ich mich aufwärmen. Beim nächsten Lokal bleibe ich stehen. Ich öffne die Tür. Der Raum ist halbdunkel und fast leer, nur zwei Indios sitzen im Eck und heben müde den Blick. Sie sehen einen Ausländer, der zur Theke geht und einen Pisco bestellt, den Standardschnaps des Landes. Was will der Mann hier?
Das frage ich mich auch. Eine zerfurchte Hand stellt ein Bierglas vor mich hin. Es ist klein, aber bis zum Rand gefüllt. Soll ich das etwa austrinken?
Drei Augenpaare beobachten mich. Ich probiere den ersten Schluck – nicht schlecht. Dann den zweiten. Immer noch haben die Männer ihren Blick auf mich gerichtet. Schafft der Ausländer das? Nun hat er keine Wahl mehr. Zwar brennt in seinem Magen ein höllisches Feuer, aber das sieht man nicht.
Ich stolpere zurück auf die Straße und suche mein Hotel, dessen Namen ich vergessen habe. Irgendwie gelingt es mir. Im Zimmer lasse ich mich sofort aufs Bett fallen. Dabei fällt mein Blick auf ein Magazin der Minengesellschaft. Ich blättere noch ein wenig darin. Das Heft gibt mir einen Einblick in die Geschichte des Ortes, an dem ich bin. Über Jahrhunderte ist die Mine von Cerro die ertragreichste des spanischen Imperiums gewesen, für den König in Madrid eine Goldgrube. Nur Eingeweihte wussten davon. Die Gold- und Silbervorkommen waren so reichlich, dass sich Cerro im neunzehnten Jahrhundert zur zweitgrößten Stadt Perus entwickelte. Es war der erste Ort, der 1830 von der Kolonialherrschaft befreit wurde. Die Eisenbahn wurde bereits 1903 gebaut, bald übernahmen amerikanische Konzerne die Mine. Nun ging es um Silber und Kupfer, später um Zinn und Blei. Alle Metalle wurden im Tagebau abgebaut. Die Umweltschäden waren enorm. Verseuchte Erde, verseuchtes Wasser, von Bleistaub durchsetzte Luft. Als die peruanische Bergbaugesellschaft die Mine in Besitz nahm, änderte sich wenig. Die Häuser hatten immer noch keine Heizung und die Lkws lieferten das Trinkwasser weiterhin zum Fünfundzwanzigfachen des Preises, den die Leute in Lima dafür zahlten.
Das alles wussten wir nicht, als wir in den Zug stiegen. Und jetzt? Was fange ich mit diesem Wissen an? Dieser Frage kann ich nicht mehr nachgehen. Das Heft gleitet mir aus den Händen, ich schlafe ein.
Mitten in der Nacht wache ich auf. Mein Herz rast, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich lege die Hand auf die Brust und erschrecke. Dieses Herz rast nicht, es rattert. In Höchstgeschwindigkeit. Ein Anflug von Panik steigt in mir hoch. Ein Herzinfarkt, in Cerro de Pasco? Es wäre ein Exitus an einem ungewöhnlichen Ort. Also nicht ohne Charme.
Doch nur kurz blitzt dieser Gedanke auf, dann habe ich keine Kraft mehr für Ironie. Regungslos liege ich da, weiß nicht, ob das meine letzte Stunde oder vielleicht schon die letzten Minuten sind. Die Zeit scheint sich quälend zu dehnen. Würde sie im nächsten Augenblick stehen bleiben, endgültig? Irgendwann erlöst mich der Schlaf.
Kaum bin ich am nächsten Morgen wach, wird mir bewusst, dass Alkohol in großer Höhe gefährlich sein kann. Vor allem für Leute, die daran nicht gewohnt sind. Mit einem Kopf, der mir das nun ständig einhämmert, gehe ich hinaus ins Freie. Noch einmal wandere ich durch die engen Gassen. Wieder blicke ich in hagere, ernste Gesichter von Menschen, denen man die Last ihres Lebens ansieht. Ich frage mich, wie unter welchen Bedingungen die Männer in den Stollen der Mine arbeiten. Eine Frage, die mich nicht mehr loslässt.
Nach einer Weile komme ich zu einem Straßenmarkt, wie es ihn in Südamerika überall gibt. Indiofrauen sitzen auf dem Boden, vor ihnen ein paar Kartoffeln oder ein wenig Gemüse. Ihre Gesichter sind mir vertraut. Solche Gesichter habe ich schon öfter gesehen, an anderen Orten, in anderen Bergdörfern. Oft scheinen die Augen dieser Frauen ins Leere zu blicken. Vielleicht drücken sie eine nie erfüllte Hoffnung aus, die sie dennoch jeden Tag den Göttern der Berge als Opfer darbringen. Aus ihrem stoischen Blick springt mich das Leid von Jahrhunderten an, das seit jeher stumm ertragen wird.
Den ganzen Tag über knien sie auf den steilen Terrassen ihrer Felder, wühlen mit den Fingern in der Erde oder sitzen mit ihrem breiten Gesäß auf den Plätzen irgendwelcher Orte, ein winziges Häufchen Tomaten vor sich, ein paar Blätter Koka, eine Zitrone. Überleben mit einem Minimum, überleben unter allen Bedingungen. Wie ihre Männer unten in der Mine.
Was ich in Cerro de Pasco sah, erschütterte mich tief. Ich spürte das Bedürfnis, dies in einem Film festzuhalten. Niemand in unserer behaglichen Wohlstandsgesellschaft kann sich ein so armseliges und mühsames Dasein vorstellen. Ein Film könnte das ändern. Er würde mir die Gelegenheit geben, mehr über diese Menschen zu erfahren und ihren täglichen Kampf ums Überleben zu dokumentieren. Das tat ich dann auch.
Für das Projekt fand ich später einen noch trostloseren Drehort: eine abgelegene Mine in Bolivien, die von der staatlichen Behörde als unrentabel aufgegeben wurde. Die Mineros aber waren geblieben. Sie hatten eine Kooperative gebildet und versuchten nun auf eigene Faust, das noch vorhandene Erz aus dem Berg zu holen. Der Ort lag völlig isoliert auf viertausendzweihundert Meter Höhe. Ein winziger Ort mit kleinen Häusern, die eher Hütten waren. Dort lebten die Frauen und Kinder. Tief unten im Berg klopften die Männer das Zinn aus den Wänden. Die Arbeitsbedingungen in den ungesicherten Stollen waren mörderisch, die Dreharbeiten waren es auch. Der Film gewann später Preise im In- und Ausland. Wen interessiert das heute?