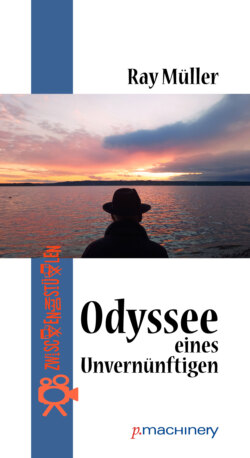Читать книгу Odyssee eines Unvernünftigen - Ray Müller - Страница 26
20
ОглавлениеWas ist der Unterschied zwischen Unbekümmertheit und Naivität? Welche Neugierde lässt einen neue Ufer erkunden, welche führt in Abgründe? Oft war es ein schmaler Grat, auf dem ich gewandert bin und ich hätte durchaus abstürzen können. Warum war X so unvernünftig? Schwierige Frage.
War Kolumbus unvernünftig, als er nach Westen ins Unbekannte segelte? Waren es die vielen Forscher weltweit, die aufbrachen, ohne zu wissen, was sie erwartet? Sie waren vom Drang erfüllt, neue Dinge zu entdecken. Das war X auch, ohne Wissenschaftler zu sein. Warum ihn dabei die dunkle Seite mancher Orte besonders fasziniert hat? Wer aus dem geordneten Alltag eines Wohlfahrtsstaats flieht, um andere Welten kennen zu lernen, will diese auch abseits der üblichen Pfade erkunden. Dieser Neugierde gab er gerne nach, zumal ihm das Gefühl der Angst fremd war.
Natürlich war ich in jungen Jahren mitunter naiv. Zum Beispiel bei meinem ersten Besuch in New York. Zu dieser Zeit waren viele Viertel der Stadt total verkommen und entsprechend verrufen. Mit der Subway zu fahren war verpönt, angeblich zu gefährlich. In den Kinos am Times Square liefen professionelle Pornofilme, Drogen gab es an jeder Ecke. Völlig tabu war Harlem. Natürlich musste ich da unbedingt hin.
Es wurde ein merkwürdiger Ausflug: Zuerst stieg ich in ein Taxi. Als ich das Fahrziel nannte, musterte mich der Fahrer ungläubig und schüttelte den Kopf. Da ich keine Anstalten machte auszusteigen, fuhr er schließlich los. Ich sah ihm an, was er dachte. Fucking tourist, fucking stupid. Schweigend fuhren wir durch die Stadt nach Norden. Ich konnte sehen, wie mich der Mann hinterm Steuer im Spiegel musterte, als sei er sich nicht sicher, ob ich ihm nicht gleich ein Messer an die Kehle halten würde.
Endlich blieb er so abrupt stehen, dass ich auf die Lehne der Vordersitze prallte. Vor uns: ein zerbeultes Schild mit der Aufschrift »Harlem«. Es stand neben einem heruntergekommenen Wohnblock, vor dem ein paar Jugendliche ein Feuer auf dem Gehsteig machten. Der Fahrer knurrte: »That’s it, get out.« Kaum stand ich auf der Straße, raste der Wagen davon.
Gut so, nun ging ich zu Fuß, wie geplant. Das war nicht immer einfach. Die Einfahrt zu den kleineren Straßen war meistens blockiert, überall standen ausgebrannte Autowracks quer zur Fahrbahn. Polizeiwagen konnten hier nicht mehr durchfahren und das sollten sie auch nicht. Ich fand das spannend, kletterte über die Hindernisse und sah mich um. Alles sah einigermaßen friedlich aus. Warum dieses Viertel so gefährlich sein sollte, wurde mir nicht klar. Die Schwarzen saßen auf dem Gehsteig, tranken Bier, auf der Straße spielten Kinder, aus riesigen Kofferradios dröhnte Musik. Alles war sehr ärmlich, aber es schien mir eine selbstbewusste Armut zu sein, ein stolzer Trotz gegenüber dem weißen Amerika der Millionäre. Als ich an den Leuten vorbeiging, hoben sie den Kopf, starrten mich verblüfft an, doch ich verspürte keine Feindseligkeit. Bis sie realisiert hatten, dass da ein junger Weißer vom Himmel gefallen war, der sich anscheinend verirrt hatte, war ich schon wieder weg. Also wanderte ich unbeschwert durch die Gegend. Alles war ärmlich und heruntergekommen, aber die Leute waren lebendig, sie sahen keineswegs deprimiert aus.
Am Abend unterhielt ich mich mit einem Schwarzen in der Hotelbar. Als ich ihm von meinem Ausflug erzählte, wollte er mir nicht glauben. Erst nachdem ich ihm auf dem Stadtplan die Route gezeigt und einige Details geschildert hatte, schwand sein Misstrauen. Mit großen Augen starrte er mich an. »Sie hatten Glück. Selbst ich, als Schwarzer, würde es nie wagen, dahin zu gehen. Okay, ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen.«
Ich schon, vor allem damals. Meist bin ich unbekümmert, das spüren die Leute. Auch die Hunde wissen, ob ein Mensch vor ihnen Angst hat, nur dann reagieren sie aggressiv. Natürlich ist das keine verlässliche Regel. Dennoch habe ich mich immer wieder prekären Situationen ausgesetzt. Für Menschen, die das Wort »Sicherheit« als Mantra pflegen, wären sie undenkbar gewesen.
Die nicht ganz harmlosen Nächte in Bogota hätte ich dann nie erlebt. Sie ergaben sich zufällig, aber nicht ganz. Bei meiner ersten Recherchereise nach Bolivien bin ich über Kolumbien geflogen. Ich wollte mir das Goldmuseum ansehen, in dem die Schätze der Inkas ausgestellt sind. Der Umweg hat sich gelohnt.
Nie wieder habe ich so viele und so kunstvoll gefertigte Objekte aus reinem Gold gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es solche gab. Die Vielzahl und Bandbreite der Arbeiten war erstaunlich. Ich konnte präkolumbianische Artefakte bewundern, Masken diverser Gottheiten, doppelköpfige Statuen und sogar ein Miniaturfloß. In der Mitte erhob sich eine mythische Gestalt, die alles überragte, umgeben von kleineren Figuren. Die ganze Skulptur, einschließlich der Holzplanken, auf dem die Personen standen, war aus purem Gold gefertigt. Kein Wunder, dass die spanischen Eroberer gierig über ein Land herfielen, das solche Schätze unbekümmert zur Schau stellte.
Später, als es dunkel wurde, bin ich ziellos durch die Straßen von Bogota gewandert. Wie immer wollte ich vor allem die Atmosphäre der Stadt erspüren. Der Drogenkrieg in Kolumbien machte damals Schlagzeilen, auch in Europa. Von Medellín aus herrschte der berüchtigte Escobar über das ganze Land. Mord war dort an der Tagesordnung.
Doch von all dem bekam ich wenig mit. Der einzige Nervenkitzel, den ich spürte, war selbst gemacht: Ich trug fünfzehntausend Dollar in bar auf dem Körper. Das Geld war Teil der Produktionsklasse. Nach der Ankunft wollte ich es eigentlich im Hotelsafe lassen, aber am Empfang lungerten ein paar schräge Gestalten herum, die jede meiner Bewegungen registrierten. Würde ich hier einen Umschlag abgeben, war der auch sicher? Ich hatte Zweifel, das Hotel war eher bescheiden. Also nahm ich das Päckchen wieder an mich und ging damit hoch ins Zimmer. Mit dieser Aktion wollte ich einen Köder auslegen. Würden die Typen den Raum durchsuchen, wenn ich weg war, würden sie nichts finden, denn ich hatte ja alles bei mir.
Besonders nervös war ich nicht, denn auch nachts in den Kneipen konnte niemand ahnen, dass dieser schlichte Tourist, der sich in einer Bar ein Bier gönnte, eine Goldgrube auf zwei Beinen war. Sogar nach Medellín fuhr ich später noch. Nur aus Neugierde? Schwer zu sagen. Meist habe ich meinem Instinkt vertraut, der mich nie in die Irre geführt hat.
Funktioniert dieser Instinkt auch hier, im wohlgeordneten Bayern? Wovor könnte er mich schützen? Wahrscheinlich nur vor mir selbst. Ich gehe schneller. In einer deutschen Stadt wird ein Flaneur schnell zum Passanten, er passt sich der allgemeinen Eile an.
Immerhin hatte mein Ausflug nach Kolumbien ein konkretes Ergebnis. Ich bekam den Auftrag, ein Drehbuch über Escobar zu schreiben, es sollte ein großer Spielfilm werden. Leider eines der Projekte, die nie realisiert wurden. Wie so viele.
Dieser Gedanke hebt meine Stimmung nicht. Ich mustere die an mir vorbeihastenden Gesichter. In welchem mentalen Labyrinth sind sie unterwegs? Froh sieht keiner aus.
An der nächsten Ampel kommt mir ein Rollstuhlfahrer entgegen. Sein Kopf ist zur Seite geneigt, der Mund halb offen, die Lippen sind verzerrt. Hat auch er Gedanken, die ihn quälen? Gründe dafür hätte er, mehr als ich. Viel mehr. Als er an mir vorbeirollt, leuchtet ein Lächeln auf seinem Gesicht. Ich spüre einen Hauch von Neid und schäme mich dafür.
Manchmal frage ich mich, ob ich vor mir selbst fliehe. Oder will ich die vertraute Umgebung nur verlassen, um mich dem Reiz des Unbekannten auszusetzen, der mich immer wieder inspiriert?