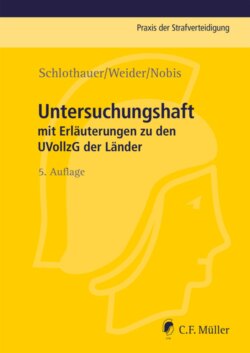Читать книгу Untersuchungshaft - Reinhold Schlothauer - Страница 68
На сайте Литреса книга снята с продажи.
e) Belehrungspflichten bei vorläufiger Festnahme
Оглавление138
Mit der Einführung des Verweises in § 127 Abs. 4 auf die §§ 114a-c und deren Neugestaltung durch das Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts vom 29.7.2009[13] sowie durch die weiteren Ergänzungen des Gesetzes zur Stärkung der Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren vom 2.7.2013[14] ist nun eine erhebliche Erweiterung und Vorverlagerung der Belehrungspflichten auf den Zeitpunkt der Festnahme sowie deren Dokumentation normiert. Die gesetzlichen Änderungen sollten angesichts der Vorverlagerung der Belehrungspflichten auf den Zeitpunkt des quasi ersten Kontakts zwischen Ermittlungsbeamten und Beschuldigten nicht nur zur Beendigung der früher oft schwer zu klärenden Frage, ob der Beschuldigte z.B. vor informatorischen Vorgesprächen ordnungsgemäß belehrt wurde, sondern angesichts der gleichzeitig eingeführten Dokumentationspflichten auch zu erheblichen Beweiserleichterungen bei entsprechenden Verstößen führen.
Der Gesetzgeber will mit der Vorschrift des § 114b i.V.m. § 127 Abs. 4 sicherstellen, dass der Festgenommene unverzüglich nach der Festnahme über seine Rechte belehrt wird und damit die Lücke in der bisherigen StPO schließen, die eine entsprechende Belehrung bei der Festnahme nicht vorsah.[15]
139
§ 114a verpflichtet die festnehmenden Beamten, den Festgenommenen „bei der Verhaftung“ schriftlich oder mündlich (ggf. in Übersetzung) über die Gründe der Festnahme und die erhobenen Beschuldigungen zu unterrichten. § 114b Abs. 1 schreibt ferner die „unverzügliche“ schriftliche Belehrung ggf. in Übersetzung über die in § 114b Abs. 2 aufgeführten Rechte vor. Wenn die schriftliche Belehrung „erkennbar“ nicht ausreichend ist oder sie aus welchen Gründen auch immer nicht erfolgen kann, hat sie mündlich ggf. in Übersetzung zu erfolgen (vgl. dazu auch unten Rn. 144). Die Belehrung und deren Umstände sind zudem umfassend zu dokumentieren (vgl. dazu unten Rn. 148).
140
Danach ist der vorläufig Festgenommene nicht nur über die Gründe der Festnahme ggf. unter Übersetzung zu informieren, sondern er ist auch unverzüglich schriftlich ggf. in übersetzter Form über die in § 114b Abs. 2 nunmehr umfangreich aufgeführten Rechte zu belehren.[16] Ist eine unverzügliche schriftliche Belehrung unmittelbar am Ort der Verhaftung noch nicht möglich, weil ein Belehrungsformular nicht zur Hand ist, hat die Unterrichtung zunächst mündlich zu erfolgen und ist später schriftlich nachzuholen. Damit darf aber nicht bis zur Verbringung auf die Polizeidienststelle gewartet werden. Ebenso ist ggf. eine (ergänzende) mündliche Belehrung notwendig, wenn der Beschuldigte Analphabet ist oder sonst erkennbar ist, dass er die schriftliche Belehrung nicht verstanden hat.[17]
141
Hervorzuheben ist, dass der Festgenommene nicht nur über sein Schweigerecht,das Recht auf Anwaltskonsultation und das Antragsrecht zur Erhebung entlastender Beweise, sondern nunmehr auch über eine Vielzahl weiterer, als die in § 136 Abs. 1 enthaltenen Rechte zu belehren ist. So ist er darüber zu belehren, dass
| • | er unverzüglich, spätestens am Tag nach seiner Ergreifung dem Gericht vorzuführen ist, das ihn zu vernehmen und über seine weitere Inhaftierung zu entscheiden hat (§ 114b Abs. 2 Nr. 1), |
| • | er nach Maßgabe der §§ 140, 141 die Bestellung eines Pflichtverteidigers beanspruchen kann (§ 114b Abs. 2 Nr. 4a), |
| • | er das Recht auf eine Untersuchung durch einen Arzt seiner Wahl hat (§ 114b Abs. 2 Nr 5), |
| • | er,sofern der Zweck der Inhaftierung nicht gefährdet wird, Anspruch auf Verständigung eines Angehörigen oder einer Person seines Vertrauens hat (§ 114b Abs. 2 Nr. 6), |
| • | dass der Verteidiger gem. § 147 ein Akteneinsichtsrecht hat und er selbst, soweit er keinen Verteidiger hat, gem. § 147 Abs. 7 Auskünfte und Abschriften aus der Akte beantragen kann (§§ 114b Abs. 2, 114b Abs. 2 S. 2); |
| • | der Beschuldigte ist zudem bereits zu diesem Zeitpunkt über die einschlägigen Rechtsbehelfe für den Fall der Anordnung von Untersuchungshaft zu belehren (§ 114b Abs. 2 Nr. 8); |
| • | der der deutschen Sprache nicht mächtige Festgenommene ist ferner in einer ihm verständlichen Sprache darauf hinzuweisen, dass er im gesamten Verfahren die unentgeltliche Zuziehung eines Dolmetschers verlangen kann(§ 114b Abs. 2 S. 3). |
142
Und schließlich ist in Umsetzung von Art. 36 Abs. 1 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen (WÜK) in innerdeutsches Recht ein ausländischer Staatsangehöriger zu belehren, dass er die Benachrichtigung der konsularischen Vertretung seines Heimatlandes verlangen und dieser Mitteilungen zukommen lassen kann (§ 114b Abs. 2 S. 3).
Die Belehrung über das Recht auf Anwaltskonsultation hat auch den Hinweis auf den Anwaltsnotdienst und die obligatorische Pflichtverteidigerbestellung nach Vollzug der Untersuchungshaft nach §§ 140 Abs. 1 Nr. 4, 141 Abs. 3 S. 4 zu umfassen (vgl. dazu näher unten Rn. 255 ff.).
143
Der Gesetzesbefehl zur sofortigen Unterrichtung über Festnahmegründe und Tatvorwurf sowie zur umfangreichen verständlichen Belehrung hat zur Folge, dass der vorläufig Festgenommene quasi im Zeitpunkt der Erklärung der vorläufigen Festnahme zu informieren und zu belehren ist. Ein Zuwarten bis zur Verbringung auf das Polizeirevier oder gar bis zur Vernehmung ist ausgeschlossen. Das Fehlen eines schriftlichen Belehrungsformulars bei der vorläufigen Festnahme setzt die Belehrungspflicht nicht außer Kraft, da § 114b Abs. 1 S. 2 für diesen Fall die mündliche Belehrung anordnet. Nur dann, wenn z.B. ein der deutschen Sprache nicht Mächtiger vorläufig festgenommen wird und ein Belehrungsformular in einer ihm verständlichen Sprache und ein Dolmetscher nicht zur Verfügung stehen, darf mit der Belehrung zugewartet werden. In diesem Fall ist jedoch entweder unverzüglich ein Belehrungsformular in Übersetzung zu beschaffen und auszuhändigen oder ein Dolmetscher hinzuzuziehen, der die Belehrung in mündlicher Form übersetzt.
144
Die Pflicht, den Beschuldigten für ihn verständlich über seine Rechte zu belehren, darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass ihm wortlos ein Belehrungsformular ausgehändigt wird, ohne ihm ausreichend Zeit zu geben, dieses auch zu lesen und zu verstehen.[18] Die bloße Übergabe eines Belehrungsformulars kann auch dann nicht ausreichend sein, wenn der Beschuldigte etwa wegen seiner Fesselung nach der Festnahme das Formular schon tatsächlich noch nicht einmal lesen kann.
Für diese und gleichgelagerte Fälle gilt § 114b Abs. 1 S. 2, der eine mündliche Belehrung vorschreibt, wenn die schriftliche Belehrung „erkennbar“ nicht ausreichend ist. Auch wenn also ein schriftliches Belehrungsformular zur Verfügung steht, hat in diesen Fällen wegen des Erfordernisses der „unverzüglichen“ Belehrung eine mündliche Unterrichtung über die Rechte nach § 114b Abs. 2 zu erfolgen.
Da sich der Beschuldigte im Falle der Festnahme in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und ihm in der Regel kaum ausreichend Zeit zur Verfügung steht, das umfangreiche Formular in Ruhe so gründlich zu lesen, dass er dessen Inhalt auch erfassen kann, ist es erforderlich, den Beschuldigten stets auch dann mündlich über die Rechte nach § 114b Abs. 2 zu belehren, wenn ihm der „letter of rights“ ausgehändigt wird.[19] Zweck der Belehrungsvorschrift des § 114b Abs. 2 ist es gerade, den Beschuldigten in die Lage zu versetzen, von seinen Rechten Gebrauch zu machen.[20] Dies kann er nur, wenn er die Belehrung inhaltlich erfasst hat. Um dies sicherzustellen, ist neben der Aushändigung des Belehrungsformulars die mündliche Belehrung erforderlich.
Im Falle der mündlichen Belehrung muss diese so beschaffen sein, dass der Beschuldigte in die Lage versetzt wird, seine Rechte auch zu verstehen.[21] Eine mündliche Belehrung darf sich nicht in dem bloßen Vorlesen des schriftlichen Textes erschöpfen. Es muss gewährleistet sein, dass der Beschuldigte das ihm Eröffnete auch inhaltlich begreift. Auch das „Herunterrattern“ des Textes eines auswendig gelernten Belehrungsformulars genügt diesen Anforderungen nicht. § 114b will gerade sicherstellen, dass der Beschuldigte seine Rechte kennt, damit er seine Verteidigung und sein weiteres Vorgehen darauf einrichten kann.
145
Das Unterbleiben der unverzüglichen und verständlichen Belehrung nach der vorläufigen Festnahme hat weitreichende Konsequenzen. Denn das Fehlen der Belehrung über das Schweigerechtund das Recht auf Anwaltskonsultation hat grundsätzlich ein Verwertungsverbot für alle Äußerungen des Beschuldigten zur Folge, die ohne Belehrung erfolgten. Erforderlich ist dann eine qualifizierte Belehrung in den nachfolgenden Vernehmungen sowie ein rechtzeitiger Widerspruch des Verteidigers in der Hauptverhandlung. Erfasst werden von dem Verwertungsverbot insbes. Spontanäußerungen nach der Festnahme oder Angaben in (beiläufigen) Gesprächen mit Polizeibeamten, etwa im Polizeifahrzeug auf dem Weg zur Dienststelle.[22] Die früher oft schwer zu klärende Frage, ob der Beschuldigte z.B. vor informatorischen Vorgesprächen ordnungsgemäß belehrt wurde, dürfte damit beantwortet sein. Denn wenn die Belehrung „unverzüglich“ und damit praktisch im Zusammenhang mit der Erklärung der Festnahme zu erfolgen hat, ist sie naturgemäß jeglichen Gesprächen vorgelagert.
146
Auch Verstöße gegen die weiteren Belehrungsvorschriften können zu einem Verwertungsverbot und einem revisiblen Verfahrensverstoß führen.[23] Denn Sinn und Zweck der nun ebenso strengen wie differenzierten Vorgaben des Gesetzgebers ist ein umfassender Schutz des vorläufig festgenommenen Beschuldigten.[24] Zwar stehen diese einem Verstoß gegen die Belehrung über die Aussagefreiheit oder das Recht der Verteidigerkonsultation nicht gleich, sie können aber im Einzelfall in Abwägung der Interessen des Beschuldigten mit dem Strafverfolgungsinteresse des Staates ein Verwertungsverbot begründen, wenn dem Beschuldigten durch die fehlende Belehrung Nachteile entstanden sind.[25]
Dies gilt insbes. auch für einen Verstoß gegen die in § 114b Abs. 2 S. 3 normierte Pflicht zur Belehrung eines ausländischen Staatsangehörigen, dass er die Benachrichtigung der konsularischen Vertretung seines Heimatlandes verlangen und dieser Mitteilungen zukommen lassen kann. Ein Verstoß gegen diese Belehrungspflicht hatte nach der Rechtsprechung des 3. und 5. Senats des BGH zur alten Rechtslage in keinem Fall ein Verwertungsverbot zur Folge.[26] Das BVerfG hat die Entscheidungen des 5. Senates allerdings jeweils aufgehoben.[27] Der deshalb zuletzt berufene 4. Senat hat nunmehr anerkannt, dass ein Verstoß gegen die Belehrungspflicht zu einem Verwertungsverbot führen könne und im Einzelfall zu entscheiden sei, ob das Urteil darauf beruhe.[28] Nachdem das Gesetz in § 114b Abs. 2 S. 3 nunmehr die Belehrung zwingend vorschreibt, spricht vieles für die Annahme eines Verwertungsverbotes. Der nach § 119 Abs. 4 Nr. 19 in der Regel nicht überwachte Kontakt zur konsularischen Vertretung kann unmittelbar die Verteidigungsmöglichkeiten des Beschuldigten betreffen. Dieser kann ein vehementes Interesse daran haben, mit einem Mitarbeiter des Konsulats den gegen ihn erhobenen Vorwurf zu besprechen, nicht zuletzt deswegen, um einen kompetenten Verteidiger zu finden, mit dem er in seiner Muttersprache kommunizieren kann und der ggf. auch über besondere Kenntnisse in Auslieferungsfragen und Problemen der Überstellung zur Strafvollstreckung im Heimatland verfügt. Da dies unmittelbar die Verteidigung betrifft, wird nunmehr nach Einführung der Belehrungspflicht nach § 114b Abs. 2 S. 3 bei Unterbleiben der gesetzlich vorgeschriebenen Belehrung ein Verwertungsverbot regelmäßig anzunehmen sein.
147
Der Verteidiger wird durch Aktenlektüre und eine Befragung seines Mandanten zu ermitteln haben, ob den Belehrungs- und Dokumentationspflichten des § 114b Abs. 2 in vollem Umfang Rechnung getragen wurde. Er wird Einzelheiten nach Zeitpunkt und Art und Umfang der Belehrung zu erfragen haben. Gem. dem § 168b Abs. 3 ist die Belehrung zu dokumentieren und nach § 114b Abs. 1 S. 3 soll der Beschuldigte schriftlich bestätigen, dass die Belehrung erfolgte. Falls vorgetragen wird, der Beschuldigte habe die Unterschrift verweigert, ist gem. § 114b Abs. 1 S. 3 auch dieser Umstand zu dokumentieren. Ferner wird der Verteidiger in der Besprechung mit dem Mandanten zu klären haben, ob die Belehrung im Hinblick auf ein mögliches Verwertungsverbot unverzüglich erfolgte. Soweit für die Belehrung ein Formular („letter of rights“) verwendet wurde, wird zu prüfen sein, ob der Mandant (auch zeitlich) in der Lage war, diese (umfangreiche) schriftliche Belehrung zu erfassen. Denn § 114b Abs. 1 S. 2 schreibt eine mündliche Belehrung vor, wenn die schriftliche Belehrung „erkennbar“ nicht ausreichend ist, was im Hinblick auf den Umfang des Belehrungstextes fast immer der Fall sein dürfte. Dabei darf sich die mündliche Belehrung nicht in dem bloßen Vorlesen des schriftlichen Textes erschöpfen. § 114b will sicherstellen, dass der Beschuldigte seine Rechte kennt und inhaltlich erfasst, damit er seine Verteidigung und sein weiteres Vorgehen darauf einrichten kann. Die Frage einer mündlichen Belehrung ist deswegen von nicht unerheblicher Bedeutung, weil im Falle erkennbar nicht ausreichender schriftlicher Belehrung das Fehlen einer für den Beschuldigten verständlichen mündlichen Belehrung der gänzlich unterbliebenen Belehrung gleichzustellen ist, so dass auch in diesem Fall ein Verwertungsverbot anzunehmen ist.
148
Der früher oft schwierige Nachweis einer fehlerhaften Belehrung durch ein fast stereotypes Vertrauen der Gerichte in die Redlichkeit der zur Belehrung verpflichteten Ermittlungsbeamten ist durch die Gesetzesänderungen und einem sich abzeichnenden Wandel der höchstricherlichen Rechtsprechung nunmehr wesentlich erleichtert. Nach der Änderung des § 168b durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte des Beschuldigten vom 2.7.2013[29] sind nunmehr auch die Belehrungen durch die Polizei gem. dem neu eingeführten § 168b Abs. 3 umfassend zu dokumentieren.[30] § 168b Abs. 3 ist auch auf die Belehrungen gem. § 114b anzuwenden, denn ausweislich der Gesetzesbegründung[31] dienen die Änderungen des § 168b ausdrücklich der Umsetzung des Art. 8 der Richtlinie 2012/13/EU, die dort eine schriftliche Dokumentation jeglicher Belehrungen des Beschuldigten fordert.[32] Nach dem Wortlaut des § 168b Abs. 3 ist die Belehrung zu dokumentieren, das ist qualitativ mehr als nur aktenkundig zu machen.[33] Aus dieser Pflicht folgt, dass nicht nur das „Ob“ der Belehrung niederzulegen ist, sondern auch möglichst genau, wann, von wem und wie der Beschuldigte belehrt wurde.[34] Diese Dokumentationspflichten sind mitnichten reine Ordnungsvorschriften, sondern dienen der Möglichkeit, Ermittlungsmaßnahmen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.[35] Die Dokumentation steht deshalb nicht zur Disposition der Ermittlungsbehörden, sondern soll sicherstellen, dass den Fachgerichten ein zuverlässiger Sachverhalt zur Rechtmäßigkeitskontrolle zur Verfügung steht.[36] Dementsprechend hat das BVerfG[37] nunmehr entschieden, dass ein Verstoß gegen gesetzliche Dokumentationspflichten zu einer Beweislastumkehr zugunsten des Beschuldigten führt. Zwar sei grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn nicht zu beseitigende Zweifel nach einer im Freibeweisverfahren durchgeführten Aufklärung von Verfahrenstatsachen zulasten des Angeklagten gingen. Diese Nichtanwendung des Zweifelssatzes habe aber dort ihre Grenze, wo die Unaufklärbarkeit des Sachverhaltes und dadurch entstehende Zweifel ihre Ursache in einem Verstoß gegen die Dokumentationspflicht finde.[38] Die Gerichte sind deshalb verpflichtet, bei substantiiertem Vortrag die Einhaltung der Belehrungspflichten nachzuweisen.[39]