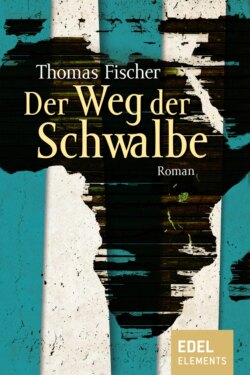Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Die Sonne stand fast im Zenit. Sein Schatten war auf einen schmalen schwarzen Rand um ihn herum geschrumpft, kaum ein paar Zentimeter breit. Auf der mit Schlaglöchern übersäten Straße, die an Bonaventures ehemaligem Heim vorbei durch das Dorf führte, rumpelte ein alter Laster entlang, ölig-schwarze Wolken aushustend und turmhoch beladen. Einige junge Männer standen am Rande der Pritsche und hielten sich so gut es eben ging an der wackeligen Konstruktion fest, die die Ladefläche einnahm.
Bonaventure löste den Blick aus dem fernen Nichts, in das er gestarrt hatte, und sah an sich herunter. Er trug ein helles Hemd mit verschlissenen Aufschlägen, eine dunkle Hose aus schwerem Stoff, die ihm mindestens zwei Größen zu klein war, und schwarze Schuhe, in denen seine Zehen jetzt schon schmerzten.
Es musste gegen vier Uhr morgens gewesen sein, als sich die Dorfbewohner auf der Straße versammelt hatte. Es war ein heilloses Durcheinander. Immer noch bebte der Boden in unregelmäßigen Abständen, auch wenn die einzelnen Erschütterungen schwächer zu werden schienen. Frauen und Männer suchten in der Menge verzweifelt nach geliebten Menschen, weinende Kinder klammerten sich an die Beine ihrer Mütter, und mitten in dem ganzen Chaos standen Bonaventure und Greta, ihre Kinder eng um sich geschart, und sahen fassungslos zu, wie die mächtigen tektonischen Kräfte des ostafrikanischen Grabenbruchs ihr Leben zerstörten.
Nur wenige Sekunden, nachdem sie das Haus verlassen hatten, war die Veranda eingestürzt. Ihr war kurz darauf der gesamte Dachstuhl mit den Außenwänden gefolgt. Ein paar Mauern, um ihr verbindendes Element gebracht, hatten sich noch ein Weilchen ihrem Schicksal entgegengestemmt, doch schließlich hatten auch sie der Wucht der Erdstöße nichts mehr entgegenzusetzen.
Irgendwann, über den Hügeln kündigte sich bereits der Morgen mit einem rosafarbenen Schimmer an, war aus dem Menschengewirr plötzlich Jean-Marie aufgetaucht. Das Beben schien vorüber, schon seit mindestens einer halben Stunde hatte sich die Erde nicht mehr aufgebäumt. Bonaventures jüngerer Bruder schloss ihn mit Freudentränen in die Arme – dabei musste er sich fast auf die Zehenspitzen stellen – und flüsterte ihm ins Ohr: „Ich bin so froh, dass ihr unverletzt geblieben seid. Ich bin so froh.“
Jean-Maries Haus hatte das Beben fast schadlos überstanden. Nur der kleine Schuppen, der nachträglich auf seiner Rückseite angebaut worden war, war zusammengefallen. Mit dem ersten Tageslicht wagte sich Jean-Marie kurz in sein Heim – gerade lange genug, um für seinen Bruder und dessen Frau etwas zum Anziehen zusammenzusuchen. Dann begann er, Mauern und Dach sorgfältig von außen auf Schäden zu inspizieren, während Monia, seine Frau, sich um ihren Schwager und dessen Familie kümmerte, die verloren am Rande einer kleinen Kaffeeplantage auf der Böschung kauerten, die Kinder immer noch nur mit den Hemden und Unterhosen bekleidet, die sie im Bett getragen hatten.
„Es wird alles gut“, sagte Monia und strich der kleinen Belize, die sich schutzsuchend an ihre Mutter klammerte, sanft über die krausen Haare, „es wird alles wieder gut, du wirst schon sehen.“
Immerhin hatte Belize vor einiger Zeit aufgehört zu weinen, doch in ihren großen Augen stand noch immer die Furcht geschrieben.
„Wann können wir wieder nach Hause gehen?“, fragte Aléxine, Belizes große Schwester. Mit ihren gerade einmal neun Jahren besuchte sie schon die vierte Klasse der Grundschule im Dorf.
„Das wird noch ein Weilchen dauern, meine Kleine“, antwortete Monia und sah ihre Nichte liebevoll an, die den Kopf trotzig in den Nacken gelegt hatte, als wolle sie allein den Naturgewalten die kleine Stirn bieten und die Ereignisse der Nacht ungeschehen machen.
„Wie lange?“, fragte Aléxine.
Greta zog ihre Tochter, die neben ihr hockte, näher zu sich.
„Du hast doch gesehen, was passiert ist, mein Schatz, oder?“
Aléxine antwortete nicht, doch irgendwann nickte sie. Sie war weiß Gott nicht die Einzige in diesen frühen Morgenstunden im Dorf, die unter Schock stand. Auch ihrem großen Bruder Montfort standen die Schrecken der letzten Stunden noch ins Gesicht geschrieben, auch wenn er sichtlich darum bemüht war, sich nichts davon anmerken zu lassen.
„Ihr kommt jetzt erst einmal zu uns“, sagte Monia. „Wir müssen uns alle ein wenig erholen, dann sehen wir, wie es weitergeht.“
Bonaventure, der ein wenig abseits saß und ins Nichts gestarrt hatte, drehte den Kopf zu seiner Schwägerin und sah ihr in die Augen. Er hatte als Einziger nicht geweint, doch in seinem Blick lag eine Leere, die Monia Angst machte.
Wie es weitergeht?, schien er zu sagen, obwohl seine Lippen sich nicht bewegten. Es geht nicht weiter. Nichts geht weiter. Nicht hier.
Plötzlich unterbrach Aléxine die Stille, während ihr Tränen die Wangen herunterkullerten. „Ich habe meinen Ball im Haus gelassen.“
Sie sah zu ihrem Vater hinüber, und in ihrem Gesicht lag eine so tiefe Verzweiflung, dass es Monia fast das Herz brach. Der knallrote Ball war Aléxines kostbarster Besitz, seit Pfarrer Bernard ihn ihr vor einigen Monaten geschenkt hatte.
„Kannst du ihn wieder ausgraben, Papa?“
Bonaventure kostete es sichtlich Überwindung, sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Er zwang sich, seiner Tochter zuzulächeln.
„Natürlich werde ich ihn ausgraben, mein Engel.“
Ein Hauch von Hoffnung schlich sich in Aléxines Augen. „Sicher?“
„Ganz sicher.“
„Das ist gut“, sagte sie, wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und zog geräuschvoll die Nase hoch.
Ja, das ist es, dachte Monia und beobachtete Bonaventure aus dem Augenwinkel, wie er aufstand, zu seiner Tochter ging, sich neben ihr auf die Böschung setzte, den Arm um sie legte und beruhigend auf sie einsprach. Dein Vater ist stark, Aléxine. Deine Eltern sind stark. Sie werden dich nicht im Stich lassen. Sie werden alles für dich und deine Geschwister geben. Und dein Onkel und ich sind ja auch noch da.
Und fast gelang es Monia, während die Sonne ihre ersten flachen Strahlen über die Hügel auf das gebeutelte Dorf und seine verstörten Bewohner warf, so etwas wie eine vage Zuversicht zu spüren.
Jean-Marie und Monia wären beinahe kinderlos geblieben. Als Monia ihre erste Fehlgeburt erlitt, hatten sie es noch den schwierigen Umständen zugeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war die Krankenstation im Dorf nicht besetzt gewesen, und als Monias Wehen gut sechs Wochen zu früh einsetzten und weder Greta noch die alte Hebamme des Dorfes ihr helfen konnten, hatten Jean-Marie, Bonaventure und zwei Freunde die stöhnende, halb bewusstlose Frau auf eine hastig zusammengezimmerte Trage gelegt, eine Decke über sie gebreitet und sich auf den langen Weg zum Krankenhaus in der Stadt gemacht. Drei Stunden gingen sie mitten in der Nacht die Straße hinab, bis ihre Beine zitterten und sie ihre Arme nicht mehr spürten. Im Morgengrauen schließlich nahm sie ein Pritschenwagen mit, auf dessen Fahrertür in großen schwarzen Lettern die Initialen der Vereinten Nationen prangten. Zehn Kilometer lang hielt Jean-Marie auf der Ladefläche die Hand seiner Frau, während ihm Tränen über das Gesicht liefen und Bonaventure, dessen Frau bereits drei gesunde Kinder zur Welt gebracht hatte, stumm danebensaß. Der Arzt in der Klinik konnte nur noch den Tod des kleinen Wesens feststellen, das Monia unterwegs unter der Decke geboren hatte und das immer noch durch die Nabelschnur mit der Frau, die seine Mutter hätte werden sollen, verbunden war.
Vier weitere Fehlgeburten folgten dem tragischen Ereignis jener Nacht, und mit jedem Rückschlag schwand auch die Hoffnung des Ehepaares, doch noch zu – wenn auch spätem – Elternglück zu finden. Bis schließlich Blessing kam und überlebte.
Dabei hatte es anfangs wieder nicht gut ausgesehen. Auch Blessing war eine Frühgeburt – doch sie war auch eine Kämpferin, wie das Personal der Krankenstation, das dieses Mal ordnungsgemäß seinen Dienst verrichtete, Monia und Jean-Marie eifrig versicherte. Als sie ihre winzige Tochter schließlich nach Wochen des Hoffens und Bangens mit nach Hause nehmen durften, als Monia ihr zum ersten Mal in den heimischen vier Wänden die Brust gab und Blessing, die damals noch nicht getauft und daher noch ohne Namen war, eingewickelt in ein Tuch in den Armen ihrer Mutter einschlief, war ihr Glück vollkommen gewesen.
Blessing blieb ein Einzelkind. Ihre Geburt war wie eine seltsame Blume, die mitten in der Trockenzeit aus der rissigen roten Erde wuchs und Hitze und Dürre zum Trotz ihre leuchtenden Blütenblätter entfaltete. Jean-Marie und Monia liebten Blessing abgöttisch, doch manchmal überfiel sie auch eine tiefe Traurigkeit darüber, dass ihre Gebete um weiteren Nachwuchs ungehört zu bleiben schienen. Sie konnten nicht ahnen, dass ihr Wunsch nach einem Haus voller Leben auf gänzlich andere Art und Weise Erfüllung finden sollte, als sie es sich ersehnt hatten.