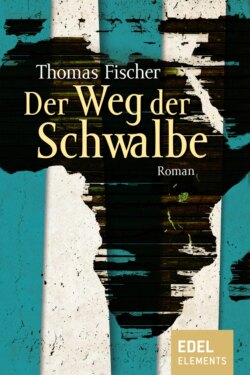Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление15
Das Oasis hatte sich weitgehend geleert. Nur noch wenige vereinzelte Gäste saßen in dem Innenhof, der nun von einigen grellweißen Neonröhren mehr schlecht als recht erleuchtet wurde. Motten und andere Insekten flatterten wie ferngesteuert um die Leuchtkörper, stießen dagegen und taumelten einen Moment, nur um dann den nächsten sinnlosen Anflug zu starten. Es war angenehm kühl geworden. Ein Kellner brachte eine Kerze und stellte sie zu den zwei halb vollen Flaschen auf den Tisch vor den beiden Freunden. Während Célestin sein Bier nach Art des langjährigen Städters eiskalt trank, hatte sich Bonaventure seine Flaschen direkt aus der Kiste geben lassen. Nie in seinem Leben hatte es dort, wo er zu Hause war, Strom gegeben, geschweige denn einen Kühlschrank, und allzu frostige Getränke bereiteten ihm unangenehme Magenprobleme.
Bereits am Telefon, als er Célestin darum gebeten hatte, einen Tag sein Gast sein zu dürfen, hatte Bonaventure seinem Freund von seinem Vorhaben erzählt. Über Einzelheiten hatten sie jedoch noch nicht gesprochen, und so zog Bonaventure nun eine Karte aus der Tasche, faltete sie auf und legte sie in den Schein der Kerze auf dem Tisch. Célestin beugte sich darüber. Bonaventure legte den Zeigefinger auf den Ort, wo sie sich befanden, und ließ ihn dann langsam auf einer Linie nach oben wandern, die fast einer Geraden in nördlicher Richtung entsprach.
„Ich werde hier im Norden über eure Landesgrenze gehen. Das Gute ist, dass ich dafür auch kein Visum benötige, das heißt, auf den nächsten knapp tausend Kilometern dürfte ich zumindest in bürokratischer Hinsicht keine Probleme bekommen.“
„Und dann?“ Célestin sah von der Karte auf und blickte Bonaventure an.
„Dann werde ich mir jemanden suchen müssen, der mich über die nächste Grenze bringt.“
„Und dann?“ Célestin wandte den Blick nicht von seinem Freund ab. Die Neonröhren spiegelten sich als kleine helle Punkte in seinen Augen.
„Werde ich versuchen, mich ein Stück in westliche Richtung durchzuschlagen.“
„Das ist aber nicht die kürzeste Route.“
„Ich weiß.“
„Und die sicherste schon gar nicht. Wenn man da überhaupt von ‚sicher‘ sprechen kann.“
Bonaventure antwortete nicht und wirkte auf einmal verlegen.
„Warum dann also der Umweg?“
Bonaventure zögerte einen Moment, als suche er nach den richtigen Worten. „Weil … weil ich nicht gut Englisch spreche, deshalb“, kam es schließlich leise und verdruckst. Er verschränkte die Hände und sah unsicher zu Boden. „Ich kann es zwar einigermaßen verstehen, aber mit dem Sprechen hapert es dann doch ziemlich.“
Célestin lachte lauf auf. „Du nimmst also die frankophone Route, was?“ Er legte Bonaventure die Hand auf den Unterarm. „Kann ich nur allzu gut verstehen. Von meinem bisschen Schulenglisch ist auch nicht mehr viel übrig.“ Er nahm einen Schluck aus seiner Bierflasche. „Falls das überhaupt Englisch war, was uns der Lehrer damals beigebracht hat“, setzte er sinnierend hinzu.
Sie schwiegen einen Moment und hingen ihren Gedanken nach. Schließlich unterbrach Célestin die Stille.
„Bist du dir sicher mit dem, was du da vorhast, mein Freund?“, fragte er, und seine Stimme war auf einmal sehr ernst.
Bonaventures Blick verlor sich in der Schwärze der Nacht, seine Hände ruhten auf den Knien. „Ich habe keine andere Wahl“, sagte er schließlich leise.
„Warum nicht?“ Wieder blitzten Célestins Augen im künstlichen Licht.
„Weil ich meine Familie nicht mehr versorgen kann.“ Bonaventure sah seinen alten Freund jetzt an. „Weißt du, wie sich das anfühlt? Wenn man auf Almosen von anderen angewiesen ist, um seine Kinder ernähren zu können? Wenn man nicht die geringste Ahnung hat, wie es weitergehen soll?“
„Na ja, so ganz unbekannt ist mir das nicht.“ Célestin starrte auf die Finger seiner rechten Hand, mit denen er einen Kronkorken hin und her drehte. „Du kannst mir glauben, dass ich es auch nicht leicht hatte nach meiner Flucht aus der Armee.“
„Ja, aber du warst damals nur für dich verantwortlich. Ich hingegen bin Familienvater“, fügte Bonaventure hinzu, wobei er das letzte Wort besonders betonte. „Und ich werde die Menschen, die mir anvertraut sind und die ich liebe, nicht im Stich lassen. Auch wenn das heißt, dass ich zunächst einmal gehen muss.“
Célestin sah von dem Kronkorken auf. „Noch kannst du umkehren.“
Bonaventure schüttelte den Kopf. „Nein, dafür ist es jetzt zu spät.“
„Unsinn, du bist gerade mal dreihundertfünfzig Kilometer von zu Hause weg! Morgen kannst du dich wieder in den Bus setzen, und wenn alles gut geht, bist du abends schon wieder bei Greta und den Kindern.“ Célestin sprach jetzt eindringlich, fast beschwörend auf Bonaventure ein. „Ich habe ein bisschen Geld auf der Bank liegen. Ich könnte dir etwas davon leihen, sodass ihr euch zumindest für die nächsten paar Monate keine Sorgen machen müsstet. Du kannst es mir dann zurückzahlen, wenn du wieder Arbeit gefunden hast. Wann auch immer das ist.“
Wieder schüttelte Bonaventure den Kopf. „Ich danke dir für dein Angebot. Du bist ein wahrer Freund, und ich weiß es sehr zu schätzen, wirklich. Aber glaub mir, es ist zu spät für mich, jetzt noch einen Rückzieher zu machen.“ Er sah Célestin direkt in die Augen. „Jean-Marie hat sein Haus an einen reichen Geschäftsmann verpfändet, damit ich genug Geld für die Reise habe. Ich kann nicht mehr zurück, Célestin. In spätestens drei Jahren will der Unternehmer sein Geld mit Zinsen zurückhaben. Und ich werde dafür sorgen, dass er es bekommt.“
Célestin versuchte den Blick des Mannes zu halten, mit dem er jahrelang die Stube in der Kaserne geteilt hatte. Der trotz ihres harten Jobs und der vielen furchtbaren Dinge, die sie zu sehen bekommen hatten, immer so ruhig und auf Ausgleich bedacht gewesen war. Der nie etwas Unüberlegtes getan hatte. Und in dessen sanften Augen nun plötzlich etwas lag, das Célestin nicht zu deuten vermochte, das aber jeden Widerspruch in ihm ersticken ließ.
„Also gut“, murmelte er und rieb sich mit beiden Händen den Hinterkopf. „Also gut.“