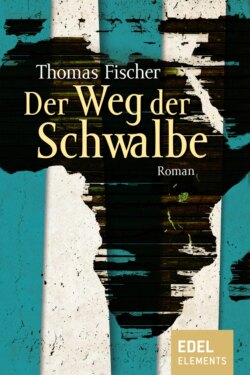Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Eine Eidechse kroch mit schnellen, ruckartigen Bewegungen auf ein Stück freiliegendes Fundament, das erstmals seit den Bauarbeiten vor sechzehn Jahren wieder von der Sonne gewärmt wurde. Dabei wandte sie ständig den Kopf von Seite zu Seite und züngelte durch die Luft. Als sie sich schließlich vergewissert hatte, dass ihr auf ihrem Rastplatz keine Gefahr drohte, schien sie sich zu entspannen und verharrte regungslos auf dem heißen Zement.
Zwei Meter weiter fühlte sich Bonaventure wie gelähmt. Er wusste, dass er nun etwas tun musste – irgendetwas! Doch was das sein konnte, davon hatte er nicht die leiseste Vorstellung. Ein dünnes Rinnsal Schweiß lief ihm den Hals hinunter und versickerte unter seinem Hemdkragen.
Greta und die Kinder waren bei Jean-Marie geblieben. Nach einer gründlichen Untersuchung hatte sein Bruder sein Haus für sicher erklärt und alle hineingebeten. Dort hatten sie zu acht im dunklen Wohnzimmer gesessen, das sich von Bonaventures nur dadurch unterschied, dass es noch ein wenig kleiner war. An einem normalen Tag hätten sich um diese Zeit die großen Kinder auf den Weg zur Schule gemacht, während sich die kleinen vor dem Haus mit Murmeln oder Spielzeugautos aus Pappe und Draht vergnügt hätten. Die Frauen hätten das Haus ausgefegt und wären dann mit großen Kanistern zum Fluss hinabgestiegen – leichtfüßig mit den leeren Gefäßen auf dem Weg bergab und langsam und bedächtig, ihre schwere Last mit einem stützenden Arm auf dem Kopf balancierend, auf dem steilen Anstieg zurück. Jean-Marie hätte, wie es seine Gewohnheit war, schon seit einer Stunde in seinem Büro gesessen, an dessen Tür auf einem verblichenen Stück Karton „Büro des Schuldirektors – bitte vor dem Eintreten anklopfen“ stand. Und Bonaventure hätte den Gartenzaun ausgebessert oder eine undichte Stelle am Dach repariert und dabei darauf gewartet, dass sein Handy endlich wieder einmal klingelte. Doch dieser Tag war nicht normal.
Jean-Marie musste seine Entscheidung getroffen haben, ohne seine Frau zuvor gefragt zu haben, und als er Bonaventure angesehen hatte, waren seine Augen ruhig und seine Stimme fest gewesen.
„Ihr bleibt bei uns“, hatte Jean-Marie gesagt und keinen Widerspruch geduldet.
Falls Monia von dieser Ankündigung überrascht gewesen war, hatte sie es sich nicht anmerken lassen. Die fünfjährige Blessing hatte begeistert in die Hände geklatscht, sich die kleine Belize geschnappt und war mit ihr nach draußen verschwunden. Danach war es sehr still in Jean-Maries Wohnzimmer gewesen.
Bonaventure spürte, wie seine Knie protestierten, als er schließlich seine Lähmung überwand und sich erhob. Ein dumpfer Schmerz pochte in seiner linken Kniekehle und zog in den Oberschenkel hinauf – wie jedes Mal, wenn er längere Zeit verharrt hatte und sich dann wieder bewegte. Unwillkürlich griff er mit der Hand an sein Bein. Selbst durch den Stoff seiner Hose hindurch konnte er die lange Narbe fühlen, die ihm immer wieder zu schaffen machte.
Er hatte keine Ahnung, wie lange Montfort schon am Rande des Grundstücks gestanden und ihn beobachtet hatte, doch jetzt setzte sein Sohn sich in Bewegung und ging auf ihn zu.
„Wir bauen das Haus wieder auf.“ Montforts Blick war entschlossen, das Kinn hatte er leicht nach vorne gereckt. Der Sechzehnjährige war fast eine Kopie seines Vaters in jungen Jahren: hoch aufgeschossen, schmal und zäh, von einer ruhigen Eleganz.
Bonaventure sah ihn an. Der unerschütterliche Optimismus der Jugend. Nichts, kein Unglück und schon gar kein Erdbeben konnte ihn ins Wanken bringen.
„Ich werde dir helfen. Jeden Tag nach der Schule komme ich sofort hierher. Und am Wochenende arbeite ich den ganzen Tag. Außerdem kann ich Gustave und François fragen, ob sie uns helfen. Ihr Haus ist ganz geblieben. Ich bin mir sicher …“
„Montfort.“ Bonaventure blickte seinem Sohn in die Augen. „Wir haben kein Geld“, sagte er leise.
„Ja, jetzt gerade. Aber es kommen sicher bald wieder bessere Zeiten! Der neue Bischof …“
„Der neue Bischof hat schon einen Fahrer“, unterbrach Bonaventure seinen Sohn erneut. „Er will mich nicht.“
„Und der Gouverneur? Erst neulich habe ich gesehen, wie sein Chauffeur sturzbetrunken in einer Bar saß, während der Gouverneur in einer Besprechung war. Ganz sicher braucht ein wichtiger Mann wie er, der ständig unterwegs ist, einen verlässlicheren Fahrer.“
„Sein Sekretär hat mich nicht einmal zu ihm vorgelassen.“
„Was ist mit dem Mann aus Westafrika? Der als Ingenieur für das deutsche Hilfswerk im Nachbardorf arbeitet?“
„Der ist seit zwei Wochen nicht mehr im Land.“
Montfort zögerte kurz. „Na gut, aber es gibt noch genug andere Leute, die einen Chauffeur brauchen. Wir können in die Hauptstadt fahren, zu den Botschaften gehen, zu den Hilfsorganisationen, irgendjemand wird sicher Verwendung für dich haben.“
Bonaventure legte den Kopf in den Nacken, als stünde irgendwo am tiefblauen Himmel die Lösung des Problems.
„Ich war schon überall. Ich habe in den letzten Wochen mit allen gesprochen, für die ich einmal gearbeitet habe. Ich war bei Kollegen und Freunden, habe meine Handynummer in unzähligen Vorzimmern hinterlassen, sogar in meiner alten Kaserne habe ich vorgesprochen. Nichts. Keiner will mich.“
Er lächelte traurig.
„Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht denken sie, dass ich zu alt bin. Vielleicht glauben sie, ich komme mit den modernen Autos nicht mehr klar. Ich habe keine Ahnung. Tatsache ist, dass ich seit vier Monaten niemanden mehr gefahren habe. Und dass mich seitdem auch keiner mehr angerufen hat.“
Montforts Augen irrten unruhig hin und her, als wolle er nicht glauben, was er da hörte, als müsse es eine Lösung geben, auf die sie nur noch nicht gekommen waren.
Auf einmal war von der Straße lautes Stimmengewirr zu vernehmen. Ein kleines Grüppchen von Menschen, die zuvor friedlich und geduldig mit ihrem Gepäck am Straßenrand gewartet hatten, stritt nun erbittert um die vielleicht zwei oder drei Plätze, die in dem gerade angekommenen Minibus noch frei waren. Es wurde geschubst und gedrängelt, Hände streckten sich mit zerknitterten Geldscheinen Richtung Fahrertür, während die Reisenden in der drangvollen Enge des Businneren dem hektischen Treiben vor den weit geöffneten Fenstern stoisch zusahen. Eine alte, zahnlose Frau mit einem Buckel und von Gicht gekrümmten Händen war die Erste, die einen der begehrten Plätze ergatterte. Ganz offensichtlich hatte sie sich nicht zum ersten Mal in ihrem Leben gegen eine scheinbare Übermacht durchsetzen müssen. Während sie sich gebückt in den Bus quetschte, zurrte der Busfahrer ihr Gepäck, einen schäbigen gelben Kanister und einen alten Koffer, auf dem Dach des Gefährts fest.
Bonaventure und Montfort sahen sich an. Vielleicht gab es doch noch einen Ausweg.