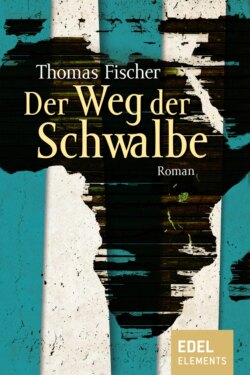Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7
Seit vier Tagen war Greta nun bereits fast ununterbrochen im Einsatz. Sie hatte Matratzen geschleppt, Wasser gebracht, Infusionen gelegt, Wunden ausgewaschen, Verbände gewickelt – und immer wieder versucht, der Verzweiflung derer, die alles verloren hatten, etwas entgegenzusetzen. Letzteres war am schwersten, denn auch wenn sie und ihre Familie körperlich unversehrt geblieben waren, war es ihr jedes Mal, wenn sie einem der Erdbebenopfer Mut zusprach, als blicke sie in einen Spiegel.
Greta war Krankenschwester; zumindest war das der Beruf, den sie erlernt und ausgeübt hatte, bis Bonaventure in ihr Leben getreten war. Das hieß, von Treten konnte eigentlich keine Rede sein; Humpeln wäre wohl der treffendere Begriff.
Die Krankenstation in ihrem Dorf war gebaut worden, als Greta gerade elf Jahre alt war und noch die Grundschule besuchte. Nach fünf Monaten Bauzeit wurde der schlichte Ziegelbau vom Bischof feierlich seiner Bestimmung übergeben. Das ganze Dorf war an jenem Sonntag auf den Beinen und verfolgte, größtenteils mit respektvollem Abstand, die Zeremonie, zu der neben dem Bischof sämtliche Würdenträger der Umgebung und sogar zwei weiße Frauen aus der Hauptstadt gekommen waren. Als schließlich am nächsten Tag das Personal in der Station seine Arbeit aufnahm, stand Greta gemeinsam mit einigen anderen Kindern, kaum dass die Schule vorbei war, auf Zehenspitzen an den Fenstern und verfolgte gebannt, was sich im Inneren des Gebäudes Geheimnisvolles tat.
Der erste Leiter der Krankenstation war, wie auch später alle seine Nachfolger, kein Arzt. Es gab kaum studierte Mediziner im Land und die wenigen, die einen Abschluss an der Universität gemacht hatten, blieben meist in den Städten, weil sich dort mehr Geld verdienen ließ als an einem entfernten Außenposten des jungen Gesundheitswesens wie in Gretas Dorf. Höchstens fünfundzwanzig Jahre alt, hatte der Mann erst wenige Monate, bevor er die Leitung der Krankenstation übernahm, seine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten an einer speziellen Schule im Norden des Landes abgeschlossen. Gemeinsam mit ihm traten zwei Krankenschwestern ihren Dienst an, und auch wenn das Trio bereits nach zwei Jahren mit Schimpf und Schande aus dem Dorf gejagt wurde, nachdem herausgekommen war, dass es einen regen und äußerst einträglichen Handel mit Medikamenten betrieben hatte, war es um Greta doch längst geschehen gewesen: Für sie war klar, dass sie – koste es, was es wolle – eines Tages auch solch einen makellosen weißen Kittel tragen würde wie die beiden diebischen Schwestern und ihr betrügerischer Vorgesetzter.
Gretas Eltern waren von dem Ansinnen ihrer Tochter wenig begeistert. Wäre es nach ihnen gegangen, hätte Greta jung geheiratet, am besten den Sohn eines wohlhabenden und einflussreichen Bauern; an geeigneten Kandidaten mangelte es jedenfalls nicht. Wie die meisten Menschen ihres Landstrichs lebte auch Gretas Familie selbst fast ausschließlich von dem, was ihr Boden hervorbrachte, und die Erkenntnis, dass ihre Tochter die Sicherheit, die ihrer Ansicht nach mit einem fruchtbaren Stück Land und seinen Bananenpalmen, Maniokpflanzen, Maisstauden und Bohnenranken einherging, einer vermeintlich fixen Idee zu opfern bereit war, machte ihren Eltern schwer zu schaffen. Zahlreiche heftige Streitigkeiten entzündeten sich an den verschiedenen Lebensentwürfen von Eltern und Tochter, und mehr als einmal flüchtete Greta vor den Zornesausbrüchen des Vaters mit tränennassen Augen in den Busch, wo sie sich viele Stunden lang versteckte.
Doch schließlich setzte Greta sich durch, und mit siebzehn Jahren begann sie die Ausbildung zur Krankenschwester am Krankenhaus der Provinzhauptstadt – eben jenem Ort, den ihr künftiger Mann gemeinsam mit seinem Bruder und dessen hochschwangerer Frau viele Jahre später nicht mehr rechtzeitig erreichen sollte, um das Leben eines ungeborenen Kindes zu retten.
Die drei Jahre ihrer Ausbildung waren eine erfüllte, aber auch eine harte Zeit. Greta hatte nicht geahnt, wie viele Krankheiten die Welt zu bieten hatte, doch sie lernte schnell. In den Betten lagen Malariakranke mit heißen Gesichtern und kaltem Schweiß auf der Stirn; ständig musste sie die Wäsche der Typhuspatienten wechseln, die oft ihren Stuhl nicht mehr halten konnten. Ähnlich erging es denen, deren Innereien von Würmern befallen waren, und ein Choleraausbruch sorgte in ihrem zweiten Jahr dafür, dass der Krankenhausbetrieb unter dem Ansturm der Infizierten zusammenbrach. Und immer wieder die, über deren Krankheit in den Dörfern niemand sprechen wollte – ganz so, als könne das bloße Aussprechen des Namens schon eine Infektion bedeuten –, und die, wenn sie im Krankenhaus ankamen, längst dem Tod geweiht waren; zumeist genauso wie ihre Frauen und Kinder, denen sie das Virus weitergegeben hatten.
Oft konnte sich Greta nach dem Ende ihrer Schicht kaum noch auf den Beinen halten. Doch die vielen Menschen, denen bei allem Elend geholfen werden konnte, waren ihr Antrieb genug, die Zähne zusammenzubeißen und weiterzumachen.
Als sie schließlich in ihr Dorf zurückkehrte und dort in der Krankenstation ihren Dienst aufnahm, war sie zwanzig Jahre alt. Ihre Eltern hatten sich mittlerweile damit abgefunden, dass ihre zweitjüngste Tochter keine Bäuerin werden würde; gelegentlich schien es sogar, als seien sie ein bisschen stolz auf Greta und die Arbeit, die sie für die Menschen im Dorf und den umliegenden Hügeln verrichtete. Doch dass sie immer noch ledig war und – viel schlimmer – zudem jeden Kandidaten vehement ablehnte, den ihre Eltern ihr hoffnungsvoll präsentierten, bereitete ihnen große Sorgen.
Eines Tages – Greta hatte gerade ihre Schicht begonnen und war dabei, einer älteren Frau eine Infusion zu legen – polterte es an der Tür. Als sie sich umdrehte, sah sie drei junge Militärs aus dem Regen über die Schwelle treten. Im Jahr zuvor war der Bürgerkrieg ausgebrochen, und Soldaten gehörten wie selbstverständlich zum Bild, das der Alltag jener Zeit bot. Der große, schlanke Mann in der Mitte wurde von den beiden anderen gestützt und bot einen bemitleidenswerten Anblick. Seine Uniform war auf dem Rücken mit einer Kruste aus rotbrauner Erde überzogen. Seine Nase war unförmig geschwollen, aus einer Wunde in seinem Gesicht lief Blut über Wangen und Kinn, und er schien nicht in der Lage, mit dem rechten Bein aufzutreten.
Wie seine Begleiter erzählten, waren sie auf der Durchreise zu ihrem Stützpunkt gewesen, als sie unweit des Dorfes Probleme mit ihrem Jeep bekommen hatten. Der Fahrer – der Mann mit dem malträtierten Kopf und Bein – hatte das Fahrzeug aufgebockt und war darunter gekrochen, um herauszufinden, wo das Problem lag. Dann, als er der Länge nach unter dem Jeep lag, musste der Wagenheber auf der feuchten Piste weggerutscht sein, jedenfalls war das Auto heruntergekracht. Dabei hatte ihn die Antriebswelle im Gesicht getroffen; noch schlimmer aber, das sah Greta gleich, war es um seinen Fuß bestellt, der vom rechten Hinterrad des Jeeps erwischt worden war.
Bonaventure blieb eine Woche in der Krankenstation. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sein Fuß zwar gebrochen, aber Gelenke und Bänder wie durch ein Wunder heil geblieben waren, und während seine Nase langsam abschwoll und die Wunde an seinem Kopf zu verheilen begann, stellte Greta fest, dass sie bislang unbekannte, aber durchaus äußerst angenehme Gefühle für den zurückhaltenden, hochgewachsenen Soldaten entwickelte, der so ganz anders war als die Männer, die sie bis dahin kennengelernt hatte. Mit seinen vierundzwanzig Jahren war Bonaventure vier Jahre älter als sie, doch er hatte nichts von der selbstverliebten Aufdringlichkeit, die vielen Männern seines Alters eigen war. Wenn er sprach, tat er dies mit leiser und sanfter Stimme; überhaupt schien er lieber zuzuhören, als selbst zu reden. Sein Blick war ruhig und offen, fast immer sah er seinem Gesprächspartner in die Augen, und stets schien der Anflug eines Lächelns seine Lippen zu umspielen. Nie beklagte er sich, wenn der Leiter der Krankenstation seinen Fuß untersuchte oder wenn Greta oder eine ihrer Kolleginnen seine Wunde mit Jod versorgten, obwohl er beträchtliche Schmerzen haben musste. Und das ganz sicher nicht zum ersten Mal in seinem Leben, wie Greta und dem Arzt sofort aufgefallen war, als sie Bonaventure nach seiner Ankunft in der Krankenstation aus seiner tarnfarbenen Hose geschnitten hatten. Denn in seiner linken Kniekehle kündete eine lange dicke Narbe von einer schlecht verheilten Verletzung, die noch nicht lange zurückliegen konnte. In dem einen Jahr, das sie nun als Krankenschwester in der kleinen Station diente, hatte Greta genug Kriegsversehrte gesehen, um zu wissen, wie eine Wunde aussah, die ein Buschmesser geschlagen hatte. Und tatsächlich schien sein Bein Bonaventure immer noch Probleme zu bereiten; nicht nur einmal beobachtete Greta ihn dabei, wie er gedankenverloren die Sehnen abtastete, die der geschliffene Stahl durchtrennt haben musste.
Bonaventure stammte aus einem Dorf im Süden des Landes, doch unmittelbar nach dem Ende seiner Schulzeit hatte er achtzehnjährig seine Heimat verlassen, war zum Militär gegangen und dort Fahrer geworden. Hätte er damals gewusst, dass sein Land nur vier Jahre später in Hass und Gewalt versinken und er sich schon bald im Epizentrum des Wahnsinns wiederfinden würde – er hätte seine Entscheidung wohl noch einmal überdacht.
Seine Vorgesetzten hatten rasch Bonaventures Zuverlässigkeit erkannt, und bald war er ständig im ganzen Land unterwegs, chauffierte Offiziere und Generäle und durfte einmal sogar die Eskorte des Präsidenten anführen. Es war eine steile Karriere für einen jungen Mann aus bitterarmen Verhältnissen, doch Bonaventure kokettierte niemals damit. Ganz im Gegenteil erschien er Greta gerade in seiner stillen Art klüger und aufmerksamer, als es Männer seines Alters für gewöhnlich waren.
Nachdem Bonaventure aus der Krankenstation entlassen worden war und er einige Monate später wieder seine Arbeit hatte aufnehmen können, besuchte er Greta, wann immer ihn seine Fahrten in die Nähe des Dorfes führten. Auch ihm war die junge Krankenschwester nicht entgangen, die sich so fürsorglich um ihn gekümmert hatte und deren Hand immer einen Wimpernschlag länger auf seinem Gesicht geruht hatte, wenn sie seine Wunde reinigte, als es nötig gewesen wäre. Es gelang ihm, seine Vorgesetzten von den Vorzügen der kleinen Bar am Ortsrand zu überzeugen, die sie bald regelmäßig auf dem Heimweg zu ihrem Stützpunkt aufsuchten, um sich den Feierabend mit dem einen oder anderen Schluck Bananenwein zu versüßen. Bonaventure gab das die Gelegenheit, Greta in der Station zu besuchen oder – wenn ihre Schicht schon vorüber war – einen Spaziergang mit ihr durch das Dorf zu machen, während zahlreiche kleine Feuerstellen der milden Abendluft ihren vertrauten rauchigen Duft verliehen.
Greta wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und verscheuchte eine aufdringliche Mücke, die trotz der Netze vor den Fenstern ihren Weg in die Krankenstation gefunden hatte. Kurz nachdem Jean-Marie in der Morgenröte nach dem Erdbeben beschlossen hatte, sie und ihre Familie bei sich aufzunehmen, war ein kleiner Junge im Haus ihres Schwagers aufgetaucht. Obed, der Leiter der Krankenstation und ein entfernter Cousin von Greta, hatte ihn mit der Botschaft geschickt, dass Greta dringend gebraucht würde, um bei der Versorgung der zahlreichen Verletzten zu helfen, die sich im Wartezimmer und den beiden kleinen Bettenzimmern der Station drängten. Er und seine drei Krankenschwestern konnten den Ansturm ohne weitere Unterstützung nicht mehr bewältigen, und daher hatte es nahegelegen, Greta um Hilfe zu bitten, auch wenn sie seit Jahren nicht mehr in ihrem erlernten Beruf gearbeitet hatte. Denn nach der Geburt ihres dritten Kindes hatte Greta ihre Arbeit als Krankenschwester endgültig aufgegeben, um sich ganz den Kindern und der Arbeit in ihrem Garten widmen zu können. Obwohl Bonaventure gut verdient hatte, hatten sie das kleine Feld neben ihrem Haus gebraucht, um über die Runden zu kommen. Ein Leben ganz ohne Arbeit auf den Feldern, das war nur etwas für die wohlhabenden Leute in der Stadt – oder für die Ärmsten, die in den endlos scheinenden Hüttenkolonien der Slums nicht einmal über das winzigste Stück Land verfügten, um darauf wenigstens ein paar Maisstauden oder eine Bananenpalme zu pflanzen.
Nun jedoch musste die Gartenarbeit warten. Vom ständigen Herabbücken zu den Verletzten schmerzte Gretas Rücken allerdings längst genauso, als hätte sie den ganzen Tag bei der Ernte auf dem Feld verbracht. Sie war gerade dabei, Obed beim Richten eines gebrochenen Unterschenkels zu helfen – der junge Mann auf der Liege zwischen ihnen biss tapfer die Zähne zusammen, die Schmerzmittel waren ihnen bereits vor einem Tag ausgegangen –, als sie durch das Fenster Bonaventure im letzten Licht des Tages den Pfad zur Krankenstation kommen sah. Schon von Weitem bemerkte sie, dass ihr Mann mutlos und erschöpft wirkte. Er ging langsam, wie gegen einen großen Widerstand, und leicht vornübergebeugt, so als trage er eine schwere unsichtbare Last. Den Blick hatte er zu Boden gerichtet.
Als er schließlich in der Tür zum Behandlungszimmer stand, wusste Greta sofort, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Obed sah vom Bein des jungen Mannes auf. Auch er war von den Anstrengungen der vergangenen zwei Tage gezeichnet.
„Bonaventure! Sei mir gegrüßt. Es ist ein Segen, dass deine Frau uns hier hilft; ohne sie müssten wir viele Leute unbehandelt wieder nach Hause schicken.“ Seine Miene verdüsterte sich. „Wenn sie noch ein Zuhause haben“, fügte er hinzu.
„Guten Abend, Obed“, erwiderte der große Mann und lächelte; traurig, wie es Obed schien. „Guten Abend, mein Schatz“, sagte er und sah Greta an. „Das Wartezimmer ist fast leer, es sieht so aus, als hättet ihr das Schlimmste hinter euch.“
Obed lachte grimmig auf.
„Du hast die Krankenzimmer nicht gesehen. Alle Betten sind doppelt belegt, selbst auf dem Fußboden dazwischen mussten wir Decken breiten, um alle unterbringen zu können.“
Er richtete den Blick wieder auf die Bahre vor sich. Der Mann mit dem gebrochenen Bein stöhnte auf, als Obed mit einer raschen ruckartigen Bewegung seine Knochen wieder in die richtige Position brachte.
„Aber diese Nacht werden wir auch ohne deine Frau klarkommen. Geht nach Hause, ihr seht beide so aus, als könntet ihr etwas Ruhe gebrauchen.“