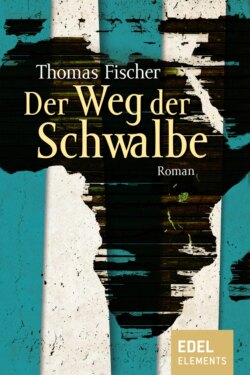Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление9
Kurz darauf saßen sie mit Jean-Marie und Monia vor deren Haus und tranken Bananenwein. Das Heim des Schuldirektors und seiner Frau blickte nach Westen, wie es auch Gretas und Bonaventures Haus getan hatte, und als er seinen Blick über die nachtschwarzen Hügel am Horizont schweifen ließ, war es Bonaventure für einen Moment, als säßen sie auf ihrer eigenen Veranda. Als hätte es die vergangenen zwei Tage gar nicht gegeben; als wäre sein Leben nicht gänzlich aus den Fugen geraten.
Die Kinder waren bereits zu Bett gegangen. Sie hatten ihnen im kleinen Wohnzimmer aus den Sofakissen ein Matratzenlager geschaffen, auf dem sie nun dicht an dicht schliefen; nur Montfort war noch irgendwo bei einem Freund und würde erst später nach Hause kommen. Bonaventure und Greta hatten die winzige Kammer bezogen, in der bisher Blessing geschlafen hatte. Der Kleinen hatte es nicht das Geringste ausgemacht umzuziehen, im Gegenteil; zu verlockend und aufregend war die Aussicht gewesen, mit ihren Cousinen das Zimmer teilen zu dürfen. Sicherlich, Montfort mochte sie auch, doch mit seinen sechzehn Jahren und seinem schmalen Oberlippenbärtchen gehörte er für sie schon zur Welt der Erwachsenen. Ganz anders verhielt es sich da mit der kleinen Belize, die ihr auch tagsüber auf Schritt und Tritt folgte – und natürlich mit Aléxine.
Aléxine war als drittes Kind von Bonaventure und Greta zur Welt gekommen, während der Bürgerkrieg das Land noch fest in seinem Griff hielt; sechs Jahre nach Montfort, dem Erstgeborenen, und drei Jahre nach Lily, die nur zehn Monate später, kurz vor ihrem vierten Geburtstag, an Kinderlähmung gestorben war. Während Montfort eher nach seinem Vater kam, hatte Aléxine schon als kleines Kind ihren eigenen Kopf – und es ebenso wie ihre Mutter verstanden, ihn gegen alle Widerstände durchzusetzen; koste es, was es wolle.
Als Aléxine gut fünf Jahre alt war, hatte ein neuer Geistlicher seinen Dienst in der Dorfgemeinde angetreten. Pfarrer Bernard war ein junger Mann aus dem Osten des Landes, dessen Ordination erst wenige Monate zurücklag; das Dorf war seine erste Station als Gemeindehirte. Wie viele frischgebackene Priester war er voller Idealismus und Tatendrang. Schnell wurde klar, dass er mit dem verknöcherten Katholizismus seiner Vorgänger und der damit einhergehenden großen Distanz zwischen Kirchenmännern und Laien nichts zu schaffen haben wollte. In einer ersten Amtshandlung ließ Bernard die Hecke entfernen, die das Pfarrhaus bislang vor allzu neugierigen Blicken in das Privatleben der örtlichen Angestellten der katholischen Kirche geschützt hatte. Außerdem hielt er dreimal in der Woche Sprechstunde in seinem Büro. Dann stand seine Tür allen offen – und nicht nur denen, die seelsorgerischen Beistand brauchten oder die um einen Termin für eine Taufe oder eine Hochzeit anfragten. Pfarrer Bernard half beim Ausfüllen von Formularen und beriet bei Ehekrisen. Er schlichtete Erbschaftsstreitigkeiten und kümmerte sich um die, die vor dem Krieg in die Nachbarländer geflohen waren und nun Schwierigkeiten hatten, in der alten Heimat wieder Fuß zu fassen. Wer nicht lesen und schreiben konnte, und das waren viele, fand in ihm einen bereitwilligen Sekretär, und man erzählte sich sogar, dass er denen, die Not litten, gelegentlich unter der Hand ein Scheinchen aus dem Kollektenbeutel zusteckte.
Aléxine verehrte Pfarrer Bernard vom ersten Augenblick an. Mit seinem Amtsantritt wurde der sonntägliche Kirchgang mit der Familie für sie vom Pflichttermin zum herbeigesehnten Ereignis. Auch wenn sie, klein wie sie war, nur wenig von seinen Predigten verstand, hing sie an seinen Lippen, wenn er vom barmherzigen Samariter erzählte oder von Noah und dessen Arche – wie hatte er nur so viele Tiere auf ein Schiff bekommen? Aléxine wurde ganz schwindlig bei dem Gedanken, auch nur von den Geschöpfen, die rund ums Dorf in den Hügeln lebten, jeweils ein Paar auf einem Boot zu versammeln. Die Lieder, die die Gemeinde, begleitet von einigen Trommlern und einer altersschwachen Heimorgel, voller Inbrunst sang und von denen sie einige auch schon vor Pfarrer Bernard gemocht hatte, klangen plötzlich ganz neu in ihren Ohren: wundersam, voller Freude und geheimnisvoll zugleich.
Besonders angetan hatten es Aléxine aber die Messdiener. Wie sie da mit ihren Kerzen so würdig und Weihrauch schwenkend zum Altar schritten, um dann neben Pfarrer Bernard vor der Gemeinde stehen zu dürfen, schien ihr die Erfüllung des größten Traumes.
Und so kam es, dass Greta in der Osternacht des gleichen Jahres dem neben ihr sitzenden Bonaventure in der Kirche zuzischte: „Wo ist Aléxine? Gerade war sie noch da.“
Im Mittelgang zwischen den schlichten Holzbänken, auf denen die Gläubigen dicht gedrängt im Dunkeln saßen, trug eine Prozession die große Osterkerze, die zuvor an einem gewaltigen Feuer auf dem Vorplatz angezündet worden war, in die Kirche. Angeführt wurde der Festzug von Pfarrer Bernard und vier weiteren Priestern in vollem Ornat, die zum wichtigsten Fest im Kirchenjahr in das Dorf zu Besuch gekommen waren. Ihnen folgten in respektvollem Abstand und mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen zehn Seminaristen: junge Männer aus dem Dorf und der Umgebung, die in der Provinzhauptstadt für das Priesteramt studierten. Und ganz am Ende des Aufmarschs, unbemerkt von den feierlich einherschreitenden Kirchenmännern, wohl aber registriert von der Gemeinde, marschierte mit stolzgeschwellter Brust Aléxine. Sie hatte sich aus einem Betttuch einen Umhang gebastelt, der wohl einem Talar ähneln sollte – wie sie es zur Kirche geschmuggelt hatte, blieb ihr Geheimnis –, und in ihren kleinen Händen hielt sie einen brennenden Kerzenstumpf. In der Kirche schwoll ein Gemurmel an, das immer lauter wurde, doch erst als die Prozession den Altarraum erreicht und sich der Gemeinde zugewandt hatte, wurde sie ihrer kleinen Nachhut gewahr. Den Seminaristen und den vier Priestern stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Auch Pfarrer Bernard verrutschte für einen Moment die Miene. Nur einen Sekundenbruchteil später aber hatte er sich wieder gefangen, erhob die Hände, in denen er immer noch die Osterkerze hielt, und das Raunen in den Kirchenbänken verstummte.
Würdevoll bedeutete er Aléxine, zu ihm zu treten. Der schien erst in diesem Moment die Tragweite ihres Tuns klar zu werden, und sie bebte am ganzen Körper, als sie sich dem Mann in seinem prachtvollen weißen Gewand näherte, ängstlich darauf bedacht, dass kein Luftstoß ihr kleines Licht, das sie zweifellos aus den Vorräten ihrer Mutter geklaut hatte, zum Erlöschen brächte. Als sie schließlich die unterste Stufe des Altarraums erreicht hatte, blieb sie stehen. Und dann tat Pfarrer Bernard das, wovon die Menschen des Dorfes und der Hügel darum noch Jahre später sprechen sollten und was ihm beinahe die Exkommunikation eingebracht hätte. Er ging gemessenen Schritts zu einem der Seminaristen und drückte dem verdutzten jungen Mann ohne ein Wort die kolossale Osterkerze in die Hand. Dann wandte er sich wieder Aléxine zu und beugte sich zu ihr hinunter.
„Hast du dein Licht auch an dem Feuer draußen entzündet?“, fragte er freundlich.
Aléxine nickte verschüchtert, ohne ihre weit aufgerissenen Augen von Pfarrer Bernards Gesicht abzuwenden. Darauf nahm der dem Mädchen den brennenden Stumpf aus den zitternden Händen, stellte ihn feierlich in den Leuchter, der neben dem Altar bereitstand, und drehte sich zur Gemeinde.
„Christus, das Licht“, deklamierte er mit voller Stimme, ganz wie es die Liturgie der Osternacht vorsah.
„Dank sei Gott“, schallte es gehorsam, wenn auch etwas schwachbrüstig aus dem Kirchenschiff zurück. Der Seminarist, der verloren mit der nun nutzlosen Osterkerze vor dem Altar stand, bemühte sich um ein möglichst weihevolles Gesicht. Und Greta, die das Geschehen ungläubig und mit weit aufgerissenen Augen verfolgt hatte, musste sich an Bonaventure festhalten, als ein kleiner Schwindel sie zu überwältigen drohte.
Vier Jahre nach den Geschehnissen jener Osternacht schlief Aléxine mit ihrer Schwester und ihrer Cousine tief und fest im Wohnzimmer ihres Onkels. Draußen auf der Veranda, wo die vier Erwachsenen saßen, legte Jean-Marie den Strohhalm, mit dem er gerade einen Schluck Bananenwein genommen hatte, auf das Tablett neben der Kalebasse, nicht ohne ihn vorher geräuschvoll leer zu saugen, wie es die Sitte verlangte.
„Also gut“, sagte er, „es sieht so aus, als könntest du auf unbestimmte Zeit nicht mehr fahren. Dann wirst du eben eine andere Arbeit finden und dein Haus wieder aufbauen.“
Jean-Maries Worte klangen ein wenig zu forsch, als könne kein Zweifel daran bestehen, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Bonaventure bei seiner Suche erfolgreich sein würde.
Bonaventure sah seinen Bruder an. „Und so lange wohnen wir bei dir? Und wer bezahlt, was wir zum Leben brauchen?“ Er schüttelte den Kopf. „Du weißt genau, dass das nicht möglich ist. Wir dürfen dir nicht zur Last fallen.“
Jean-Marie lachte auf, zu laut. „Was redest du da, Bruder, ich bin Schuldirektor! Ich bin vielleicht nicht reich, aber ich verdiene genug. Ihr bleibt bei uns, bis du Arbeit hast und euer Haus wieder steht.“
„Ich weiß, was du verdienst“, erwiderte Bonaventure. Und, nach einer kurzen Pause: „Und du weißt selber, dass das nie und nimmer für zwei Familien reicht.“
Er blickte hinaus in die Schwärze der Nacht. Für einen Moment war nur das Zirpen der Grillen zu hören.
„Selbst wenn ich irgendeine Arbeit finde, wird sie nicht so gut bezahlt sein wie das Fahren. Es wird niemals ausreichen, um ein neues Haus zu bauen.“
„Aber vielleicht wird es genug sein, um Jean-Marie und Monia jeden Monat ein wenig Geld zu geben, solange wir bei ihnen leben“, warf Greta ein.
„Und wie bezahlen wir das Schulgeld für die Kinder?“
„Ich bin mir sicher, dass Jean-Marie da etwas machen kann“, schaltete Monia sich ein. „Ein Direktor wird seine Nichte und seinen Neffen nicht der Schule verweisen.“
„Ja, macht euch darüber keine Sorgen“, sagte Jean-Marie, „Montfort und Aléxine werden bleiben. Ihr könnt ihr Schulgeld später nachzahlen.“
„Doch es würde Gerede im Dorf geben“, sagte Bonaventure. „Wie viele Kinder musstest du schon abweisen, seitdem du Direktor bist, weil ihre Eltern das Geld nicht aufbringen konnten? Hundert? Zweihundert? Fünfhundert? Und bei deinen Verwandten gelten plötzlich andere Regeln?“ Die Kerze, die die Veranda schwach erleuchtete, flackerte in einem leichten Windhauch, der von den Hügeln herunterwehte, und warf tanzende Schatten auf Bonaventures schmales Gesicht. „Nein, Jean-Marie, das kannst du nicht tun.“
„Ich werde es aber tun“, erwiderte der kleine Mann entschlossen. „Sollen die Leute sagen, was sie wollen. Das hier ist eine Ausnahmesituation, Bonaventure. Die, die ich wieder nach Hause geschickt habe, hatten nicht gerade bei einem Erdbeben ihr Haus verloren.“
Bonaventure lächelte traurig.
„Nein, sie waren einfach nur zu arm. Auch ohne Erdbeben.“
„Schluss jetzt!“ Jean-Marie stand plötzlich auf und der Stuhl, auf dem er gesessen hatte, wäre beinahe umgekippt. Selbst im Stehen war er nur gut einen Kopf größer als sein Bruder, der ihm bewegungslos gegenübersaß.
„Das ist eine schwierige Situation. Für dich und für uns alle. Aber wir kommen da wieder raus. Und auf dem Weg dorthin werden wir noch vieles tun müssen, was wir niemals tun wollten.“ Er nahm seine Kappe vom Tisch, die er stets trug, wenn er das Haus verließ, und setzte sie auf. „Ich habe noch im Büro zu tun, die Schularbeiten korrigieren sich nicht von alleine.“
Ohne sich zu verabschieden, entschwand Jean-Marie in die Dunkelheit.