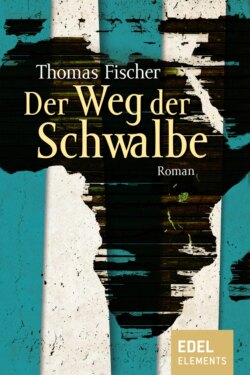Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление11
Der Raum hatte sich in den vergangenen fünfzehn Jahren fast nicht verändert. Auch jetzt, da sich ein scheinbar endloser hellblauer Himmel hoch über den Hügeln wölbte und die Sonne Dorf und Felder in ein klares Licht tauchte, war im Zwielicht des Direktorenzimmers kaum etwas von dem verheißungsvollen Vormittag zu sehen. Einzig ein verstaubtes Kopiergerät, das allerdings auch schon lange nicht mehr funktionierte, ergänzte nun die spartanische Einrichtung.
Jean-Marie seufzte und klappte das Schulheft zu, das vor ihm auf dem Tisch lag. Er sah den jungen Mann, der ihm gegenübersaß und nervös am Saum seines fadenscheinigen weiten Hemdes herumnestelte, über den Rand seiner Lesebrille an.
„Es ist fast April, Gustave. In vier Monaten geht das Schuljahr zu Ende.“
„Ich weiß“, murmelte sein Schüler mit niedergeschlagenen Augen.
„Ich möchte ehrlich zu dir sein. Wenn ich mir deine Noten so ansehe, wird es mit deiner Versetzung nichts werden.“
Schweigen.
„Allein im letzten Monat hast du achtmal gefehlt. Gustave, du bist ein intelligenter Bursche, aber wenn du nicht regelmäßig in den Unterricht kommst, hilft dir deine Begabung allein auch nicht mehr weiter.“
Der Angeklagte hob den Kopf und sah aus dem Fenster, das offen stand. Eine leichte Brise ließ die Vorhänge ein wenig flattern. Draußen auf dem Schulhof wimmelte es von Schülerinnen und Schülern; vor wenigen Minuten war die große Pause angebrochen. Einige standen in kleinen Grüppchen zusammen und diskutierten eifrig, hin und wieder warf einer den Kopf in den Nacken und lachte schallend, gefolgt von dem unvermeidlichen klatschenden Händedruck mit dem Urheber der Heiterkeit. Andere hatten sich unter den Vordächern der Klassenzimmer niedergelassen und genossen die wenigen unterrichtsfreien Minuten in Stille.
„Es ist nicht meine Schuld, dass ich so oft gefehlt habe, Herr Direktor“, sagte Gustave leise, ohne den Blick von dem bunten Treiben abzuwenden.
„Das weiß ich“, erwiderte Jean-Marie. Bereits dreimal hatte er die Eltern des Achtzehnjährigen in den vergangenen Jahren zu sich einbestellt. Es war immer wieder die gleiche Diskussion – mit ihnen wie mit so vielen anderen.
Wir brauchen unseren Sohn auf den Feldern, Herr Direktor. Wie sollen wir sonst die Familie ernähren?
Unsere Tochter muss auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen, Herr Direktor, während wir den Acker bestellen.
Wir können es uns nicht leisten, einen Hirten für unsere Kühe zu beschäftigen, Herr Direktor.
Bis zur Zisterne sind es drei Kilometer, Herr Direktor. Irgendwie müssen wir ja an sauberes Wasser kommen.
Jean-Marie kannte all diese Argumente nur zu gut, und er hatte Verständnis für sie. Und doch blieb es eine Tatsache, dass sich das Abitur nicht von alleine machte. Mit dem kleinen Internat, das die Oberstufe beherbergte, bot die Schule weit und breit die besten Bedingungen, um das Reifezeugnis zu erlangen. Doch was half das, wenn Schüler wie Gustave abends regelmäßig den langen Weg durch die Hügel nehmen mussten, um am nächsten Tag den Eltern bei was auch immer zu helfen, anstatt sich im Internat auf den Unterricht vorzubereiten und danach mit den anderen die Nacht im großen Schlafsaal zu verbringen?
Es war eine schwierige Situation für den kleinen Mann mit der großen Verantwortung, und manchmal brach es Jean-Marie schier das Herz, wenn er wieder einmal mit ansehen musste, wie sich für einen begabten jungen Menschen die Tür zu einem besseren Leben möglicherweise für immer schloss, weil seine Familie Tag für Tag um ihre Existenz kämpfen musste.
„Und trotzdem liegt es jetzt an dir, Gustave. Du musst dich deinen Eltern gegenüber durchsetzen. Ich habe schon so oft erfolglos mit ihnen gesprochen.“
Jean-Marie lehnte sich nach vorne und sah seinen Schüler mit eindringlichem Blick an.
„Diese Chance kommt nur einmal. Wenn du sie verpasst, wirst du niemals selber Lehrer werden oder gar an der Universität studieren. Hast du das verstanden?“
Gustave nickte schwach. Jean-Marie fühlte sich elend, auch wenn er sich nichts davon anmerken ließ. Ihm war nur zu bewusst, in welche Konflikte er den jungen Mann stieß – stoßen musste.
„Und außerdem gibt es immer noch die Wochenenden. Da wirst du ja wohl Zeit zum Lernen finden.“
Der Schüler hatte den Blick jetzt wieder zu Boden gerichtet.
„Oder etwa nicht?“
Zum ersten Mal während des ganzen Gesprächs hob Gustave den Kopf und sah seinem Direktor in die Augen – trotzig, wie es Jean-Marie schien. Die Antwort erwischte ihn völlig unvorbereitet.
„Am Wochenende helfe ich Montfort und seinem Vater auf ihrer Baustelle.“
Jean-Marie, sonst selten um Worte verlegen, starrte seinen Schüler an, den Mund leicht geöffnet, als hätte er gerade zu einer großen Antwort ansetzen wollen, die dann aber auf halbem Weg stecken geblieben war.
Natürlich wusste Gustave, dass Montforts Vater Jean-Maries Bruder war; jeder im Dorf kannte jeden, ebenso wie die teils äußerst komplizierten Verwandtschaftsverhältnisse, auch wenn dies zweifellos ein ziemlich einfacher Fall war. Natürlich wusste Gustave auch, dass Bonaventure und seine Familie bei Jean-Marie wohnten, seit das Beben in jener Nacht vor zwei Monaten ihr Haus dem Erdboden gleichgemacht hatte.
„Es wird nicht mehr lange dauern. Wir haben schon fast die Hälfte der Fundamente freigelegt. Außerdem sortieren wir die Trümmerteile. Vielleicht kann Bonaventure das eine oder andere davon für das neue Haus wiederverwenden.“
Jean-Marie hörte kaum, was Gustave sagte, und sah mit leerem Blick durch ihn hindurch. Genau wie Bonaventure war ihm völlig klar, dass die Arbeit in der Ruine ein fruchtloses Unterfangen ohne jede Aussicht auf Erfolg war. Sein Bruder hatte seit einem halben Jahr keine Arbeit mehr in seinem Beruf gefunden, die letzten kärglichen Ersparnisse waren längst aufgebraucht. An einen Neubau war nicht im Entferntesten zu denken. Die mühselige Plackerei in den Trümmern mochte Bonaventure das Gefühl geben, zumindest irgendetwas zu tun, sich seinem Schicksal entgegenzustemmen, nicht kampflos aufzugeben. Doch es war ein Kampf, dessen Ausgang schon längst feststand.
„… wie zum Beispiel die Dachbleche. Mindestens zehn von ihnen sind noch fast völlig in Ordnung und müssen nur wieder zurechtgebogen werden, dann können wir sie …“
„Es ist gut, Gustave“, sagte Jean-Marie und schüttelte leicht den Kopf, wie um sich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen.
„Geh jetzt raus zu den anderen. Wir sprechen ein anderes Mal weiter.“
Als der junge Mann den Raum verlassen hatte, nahm Jean-Marie seine Brille ab, rieb sich die Augen und verbarg sein Gesicht in seinen Händen.
Er würde mit Bonaventure reden müssen. Nicht nur über Gustave und die sinnlose Arbeit für ein Haus, das nie gebaut werden würde. Auch darüber, wie es nun weitergehen sollte mit ihrer beider Familien. Bonaventure hatte natürlich recht gehabt, wie sich auch Jean-Marie mittlerweile zähneknirschend eingestehen musste: Sein schmaler Verdienst war nicht genug, um vier Erwachsene und ebenso viele Kinder durchzubringen. Nicht einmal im Ansatz. Die schlechte Ernte tat ihr Übriges zu einer Situation, die von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer hoffnungsloser erschien. Schon jetzt reichte es nur noch zu zwei Mahlzeiten am Tag, und das auch nur, weil die Erwachsenen nach einem kleinen Teller Bohnen und Reis vorgaben, satt zu sein, und die Töpfe zu den Kindern schoben. Und was würde kommen, wenn die kümmerlichen Erträge der eigenen Gärten in einigen Wochen endgültig aufgebraucht waren? Wenn der Markt, der einmal pro Woche am Rande des Dorfes stattfand, ihre einzige Lebensmittelquelle sein würde, sie aber die Preise, die nach der Missernte in astronomische Höhen geschossen waren, nicht würden bezahlen können? Wie würden sie den Hunger ertragen, der von da an ihr ständiger Begleiter sein würde? Wann würden die ersten Mangelerscheinungen auftreten? Wer würde als Erster krank werden?
Dieses Mal musste Jean-Marie die Dinge nicht erst hinterfragen, um in Schwierigkeiten zu geraten. Er steckte, sie alle steckten schon mitten darin.
Jean-Marie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es knallte. Ein paar Schüler, die draußen nahe am Fenster seines Büros standen, zuckten zusammen und blickten erschrocken zu ihrem Direktor, der sich mit krummem Rücken von seinem Stuhl erhoben hatte, die Hände auf den Tisch gestützt.
„So weit darf es nicht kommen“, zischte Jean-Marie zwischen zusammengebissenen Zähnen, ohne sich seiner Beobachter gewahr zu sein, „so weit darf es nicht kommen, und so weit wird es nicht kommen.“
Doch was er dagegen tun konnte, davon hatte Jean-Marie nicht die geringste Ahnung.