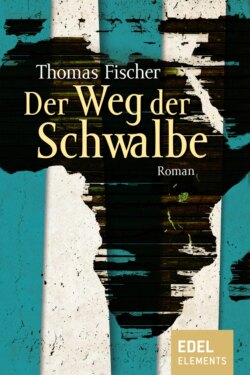Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление17
Am nächsten Morgen rumpelten sie in Célestins altem verbeultem Auto durch die Straßen der Stadt, die sich über zahlreiche Hügel in alle Richtungen endlos auszubreiten schien. Die Sonne stand bereits recht hoch am östlichen Himmel, und die Straßen dampften von einem Regenguss, der wohl in der Nacht herabgegangen sein musste – einem späten Nachzügler der Regenzeit. Bonaventure war erst einmal hier gewesen; vor vielen Jahren mit einer Delegation des Militärs. Seitdem hatte sich viel verändert. Die Stadt war eleganter geworden. Überall waren Zeichen langsam aufkeimenden Wohlstands zu sehen, wenn man denn Augen hatte, sie zu sehen. Célestin bemerkte, dass sein Freund die ganze Zeit unverwandt aus dem Fenster blickte. Er grinste und nickte in Richtung einiger Hochhäuser, die in ein paar Kilometern Entfernung über der Stadt aufragten.
„Schon verrückt, was sich hier getan hat, was? Seit sechzehn Jahren lebe ich jetzt hier, und ich kann es manchmal selbst nicht glauben.“ Er überholte ein Fahrradtaxi, auf dessen zum Passagiersitz umfunktionierten Gepäckträger eine Frau saß, die mit der linken Hand ein großes Bündel auf dem Kopf abstützte, während sie sich mit der rechten am Sattel des Fahrers vor ihr festhielt. „Die Zeiten haben sich wahrlich geändert. Heute musst du nicht mehr ständig die Hand auf dem Geldbeutel halten, damit er dir nicht geklaut wird.“ Célestin lachte kurz auf, bevor er plötzlich ernst wurde. „Aber wo es Gewinner gibt, sind auch die Verlierer nicht weit, wie es so schön heißt. Nicht alle haben vom Boom der letzten Jahre profitiert.“
Sie hatten jetzt das Stadtzentrum hinter sich gelassen und fuhren auf einer steil abfallenden Straße auf ein Tal zu, in dem sich unzählige kleine, schäbige Häuser eng aneinanderdrängten. Hier und da bildeten Palmen grüne Farbtupfer im eintönigen Meer der rostigen Wellblechdächer, unter denen es allmählich unangenehm warm werden würde. Waren die Straßen bislang in ausnehmend gutem Zustand gewesen, so wurde der Asphalt nun von holperiger harter Erde abgelöst, als Célestin von der Hauptstraße abbog und langsam – um die Stoßdämpfer zu schonen – immer tiefer in das Armenviertel hineinfuhr. Der Geruch von Rauch und Fäkalien zog durch die heruntergekurbelten Fenster in das Auto. Kinder in zerlumpten Kleidern standen am Rande der Fahrbahn und sahen dem Fahrzeug hinterher. In Gräben, die vor den Häusern am Straßenrand verliefen, stand braunes Wasser, gelegentlich glänzte eine Öllache auf der schmutzigen Flüssigkeit.
Bonaventure, dem Célestin nichts über das Ziel ihres Ausflugs hatte sagen wollen, hatte im Gewirr der Häuser und Hütten längst die Orientierung verloren, als Célestin das Auto schließlich vor einer Bretterbude zum Halten brachte. Sie war zur Straßenseite hin geöffnet; auf einer schiefen Theke stand ein altes Telefon, ein handgemaltes Schild daneben warb für „Philippes Telefon- und Büroservice“. Im Halbdunkel der Bude hinter dem Tresen konnte Bonaventure einen Tisch ausmachen, auf dem ein alter Computer und ein urtümlicher Drucker standen. Ein Mann, der auf einem Stuhl davor gesessen hatte, erhob sich nun, als Célestin und Bonaventure aus dem Auto stiegen und die Türen hinter sich zufallen ließen.
Als der Mann aus der Tür an der Seite des Schuppens in das helle Licht des Vormittags trat, zuckte Bonaventure unwillkürlich zusammen. Wo einst sein linkes Auge gewesen war, zog sich eine offenbar langsam und schlecht verheilte Narbe über sein Gesicht. Sie begann kurz unterhalb des Wangenknochens, setzte sich quer über das Lid fort, spaltete die Braue darüber in zwei Hälften und endete auf seiner Stirn. Als er nun auf die zwei Freunde zuging, bemerkte Bonaventure, dass er außerdem leicht humpelte.
„Willkommen, willkommen!“, rief der Mann, bei dem es sich um Philippe handeln musste. „Wir kriegen hier nicht oft Besuch von den Schönen und Reichen!“, lachte er und begrüßte Célestin in der traditionellen Manier mit reichlich Händeschütteln und einer angedeuteten Umarmung. „Aber im Gegensatz zu vielen anderen hier“ – er deutete in einem Halbkreis auf die Häuser und Hütten um sie herum – „habe ich wenigstens ein Telefon, sodass ihr mir euren Besuch ankündigen konntet. Sie sind also Bonaventure“, sagte er und streckte ihm seine Hand entgegen. Philippes Händedruck war fest und verbindlich und ließ so gar nichts von seinen körperlichen Gebrechen erahnen. „Seien Sie herzlich willkommen!“ Dann steckte er die Finger der rechten Hand in den Mund und stieß einen gellenden Pfiff aus. Sofort kam aus einer benachbarten Hütte ein junger Mann angelaufen. „Hey, Bosco, ich habe Besuch. Kümmere dich eine Weile um das Büro, ja?“ Der Angesprochene verschwand in dem Holzschuppen, während Philippe seine Gäste mit einladenden Gesten zu dem Haus dirigierte, das ein paar Meter hinter dem Schuppen stand. Es war zwar sehr klein, aber in deutlich besserem Zustand als fast alle, an denen sie auf ihrem Weg durch das Viertel vorbeigekommen waren. Aus einem der Fenster drang das Lachen von Kindern. Sie gingen um das Haus herum und fanden sich in einem winzigen Garten wieder. Die Blätter einer Bananenpalme raschelten im leichten Wind. Maisstauden begrenzten den grünen Flecken Erde an seinem hinteren Ende. Davor war eine Ziege an einen Pflock angebunden, der im Rasen steckte. Das Tier hob den Kopf und meckerte, als die drei Männer sich näherten. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür an der Rückseite des Hauses und eine Frau kam heraus, in jeder Hand einen Stuhl. „Danke, Josephine“, sagte Philippe und nahm ihr die Stühle ab, während sie Célestin herzlich begrüßte und sich anschließend Bonaventure als Philippes Frau vorstellte. Dann verschwand sie wieder im Haus, um kurz darauf mit einem dritten Sitzmöbel zurückzukehren.
Als die Männer schließlich saßen, stieß Philippe einen zufriedenen Seufzer aus.
„Wie geht es dir, mein Freund?“, fragte ihn Célestin.
„Ach, es könnte schlechter sein. Die Familie ist gesund, und das Geschäft läuft auch einigermaßen. Es gibt genug Leute hier, die meiner Dienste bedürfen. Nur die Kaufkraft lässt in dieser Umgebung etwas zu wünschen übrig.“ Er zwinkerte Bonaventure mit seinem gesunden Auge zu. „Wie sagt man doch so schön? Unter den Blinden ist der Einäugige König. Scheint auch für die Armen zu gelten.“ Er lachte schallend und schlug die Hände ineinander. „Und wie läuft es bei dir, Célestin?“
„Ich kann nicht klagen. Nur meine Tochter macht mir etwas Sorgen. Sie ist jetzt sechzehn, und wir scheinen seit einiger Zeit nicht mehr dieselbe Sprache zu sprechen.“
„Ja, mir graut auch schon davor, wenn meine Kinder in dieses Alter kommen. Zum Glück ist das noch ein paar Jahre hin.“ Philippe runzelte die Stirn und wandte sich jetzt an Bonaventure. „Und wie es Ihnen geht, brauche ich wohl nicht zu fragen. Sonst säßen Sie ja nicht hier.“
Bonaventure sah ihn fragend an.
„Ich habe ihm erzählt, was dir passiert ist und was du vorhast“, warf Célestin ein.
„Ich kann Sie bestens verstehen, glauben Sie mir“, fuhr Philippe nun ernsthaft fort, während er Bonaventure mit seinem einen Auge fixierte. „Und genau deshalb möchte ich Ihnen sagen, dass Sie im Begriff sind, einen großen Fehler zu machen.“
Bonaventure, dem allmählich dämmerte, was der Hintergrund ihres Besuchs bei Philippe sein musste, versuchte dem einäugigen Blick ihres Gastgebers standzuhalten, der an Intensität immer weiter zuzunehmen schien.
„Sie haben es selbst einmal versucht“, sagte er schließlich.
„Ja“, erwiderte Philippe, „das habe ich. Und ich habe teuer dafür bezahlt. Damit meine ich nicht nur Geld“, setzte er hinzu, legte einen Finger auf das Wundmal in seinem Gesicht und deutete dann auf sein Bein. „Und das sind nur die Narben, die für jedermann sichtbar sind.“
Während die Sonne langsam dem Zenit entgegenstieg und es im Garten immer wärmer wurde, erzählte Philippe Bonaventure seine Geschichte.
Philippe war neunzehn Jahre alt gewesen, als er seine Eltern, seine beiden Brüder und seine kleine Schwester verlor. Mit ihnen starben mehr als zweihundert Menschen in der brennenden Kirche, deren Tore die Völkermörder fest verriegelt hatten. Philippe hatte sich im allgemeinen Durcheinander vor dem Massaker in den Busch retten können, wo er sich mehrere Wochen versteckte, halb irre vor Trauer, Angst und Hunger. Als ihn schließlich eine Gruppe von Rebellen fand, deren Truppen den Genozid beendet hatten, war er so schwach und ausgemergelt, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Eine entfernte Tante nahm ihn bei sich auf und päppelte ihn so gut es ging wieder hoch. Doch die Frau war arm und hatte bereits sechs eigene Kinder. Philippe war klar, dass er schon bald auf eigenen Füßen würde stehen müssen.
Wie so viele andere auch, die in der Zeit des Wahnsinns alles verloren hatten, versuchte er sein Glück in der Hauptstadt, und zunächst fand er es auch. Aus Mitleid beschäftigte ein Automechaniker den traumatisierten jungen Mann als Laufburschen in seiner Werkstatt, beförderte ihn einige Monate später zum Hilfsmechaniker, und schließlich bot er Philippe, der sich als überaus geschickt erwiesen hatte, sogar eine Lehrstelle an. Der nahm dankend an, und drei Jahre später hatte er seine Ausbildung abgeschlossen. Er lernte Josephine kennen, heiratete sie, und in den folgenden Jahren bekam das Paar zwei Töchter und einen Sohn. Philippe, dem sein kinderloser Chef mittlerweile in Aussicht gestellt hatte, seinen Betrieb eines Tages von ihm zu übernehmen, führte ein zufriedenes Leben.
Bis in einer heißen Julinacht die Werkstatt bis auf ihre Grundmauern abbrannte. Was das Feuer ausgelöst hatte, fand man nie heraus. Hartnäckig hielten sich jedoch Gerüchte, dass Philippes Chef der Konkurrenz in der Stadt zu erfolgreich geworden war. Was immer auch geschehen sein mochte – Philippe jedenfalls verlor nicht nur seine Arbeitsstelle, sondern auch die Aussicht auf eine weitgehend sorgenfreie Zukunft. Und so ging er eines Tages zur Bank, hob fast sein gesamtes Erspartes ab, das er in den vergangenen Jahren vor allem für die Ausbildung seiner Kinder zurückgelegt hatte, und machte sich auf den Weg nach Europa.
Von dem Geld war längst nichts mehr übrig, als seine Reise – und beinahe auch sein Leben – einige Monate und viele tausend Kilometer später in einem Polizeirevier am Rande der Wüste ihr Ende fand. Da ihm die durch und durch korrupten örtlichen Grenzbeamten allerdings partout nicht glauben wollten, dass sein Geldbeutel so ausgetrocknet war wie der Landstrich, in dem sie sich befanden, schlugen sie stundenlang mit Stöcken und Gürteln immer wieder auf Philippe ein, bis er sich nicht mehr rührte. In dieser Nacht verlor Philippe sein Auge; außerdem brachen seine Peiniger ihm sein rechtes Fußgelenk und den Oberschenkel.
Wie er am nächsten Morgen vor den Toren der Hilfsorganisation gelandet war, wusste er nicht. Vermutlich hatten ihn andere Flüchtlinge dort gefunden, wo auch immer ihn seine Folterknechte zum Sterben zurückgelassen hatten, und ihn dann zu den internationalen Helfern gebracht. Auch wenn sie nichts mehr für Philippes Auge tun konnten, gelang es deren Ärzten doch zumindest, ihn vor einem Leben im Rollstuhl oder auf Krücken zu bewahren. Dass er einige Zeit später dann im Rahmen eines Rückführungsprogramms zum ersten Mal in seinem Leben ein Flugzeug besteigen durfte, das ihn zurück in seine Heimat brachte, war Philippes großes Glück. Unzählige andere Flüchtlinge, denen es ähnlich ergangen war wie ihm, waren in den Wüstenstädten gestrandet, ohne Aussicht, sie jemals wieder zu verlassen.
Nach seiner Rückkehr hatte die nun völlig mittellose Familie ihr Haus aufgeben müssen und war in das Armenviertel gezogen. Sechs Jahre waren seither vergangen, in denen Philippe hart gearbeitet hatte, um sich und den Seinen eine neue Existenz aufzubauen.
„Das hier ist mein drittes Leben“, sagte Philippe jetzt. „Ich danke Gott von ganzem Herzen, dass er es so gut mit mir gemeint hat. Normalerweise lägen meine Knochen jetzt irgendwo tief im Wüstensand vergraben. Doch ich bin immer noch da.“ Er musterte Bonaventure mit seinem gesunden Auge. „Gehen Sie nicht, Bonaventure. Sie haben keine Ahnung, was Sie erwartet.“
Bonaventure, der sich während Philippes Erzählung kaum gerührt hatte, sah seinen Gastgeber nur schweigend an.
Nein, das habe ich nicht. Aber ich weiß, was mich und meine Familie erwartet, wenn ich es nicht versuche.
Und davor hatte Bonaventure mehr Angst als vor allem anderen.