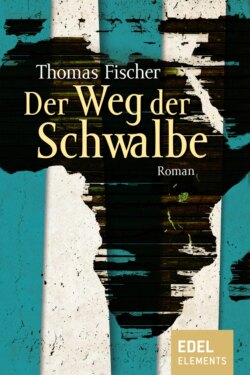Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
Seit fünf Stunden war Bonaventure nun schon in der Hauptstadt unterwegs. Die Mittagshitze hing wie eine Glocke unbarmherzig über den vorwiegend flachen, schmutzig-weiß getünchten Gebäuden. Im Schatten der Vordächer boten Händler ihre Waren feil: Bananen, Erdnüsse, gekochte Eier, gebrauchte Kleider und Schuhe, getrockneten Fisch, Avocados, Fleischspieße, frittierte Teigbällchen, lebende Hühner, protzige Billiguhren aus Fernost … Obwohl Bonaventure als Fahrer oft in der Hauptstadt gewesen war, faszinierte ihn ihr schier unerschöpfliches Angebot immer wieder aufs Neue. Und die Menschen – so viele Menschen! An jedem anderen Tag, in seinem anderen, früheren Leben, wäre er in den Trubel eingetaucht, hätte sich treiben lassen, hier und dort zum Spaß ein wenig gefeilscht und am Ende vielleicht ein paar Meter Stoff für Greta erstanden, aus denen sie sich ein hübsches neues Kleid schneidern konnte. Doch heute war alles anders, denn Bonaventure hatte kein Haus mehr und auch der Vormittag war gänzlich anders verlaufen, als er es sich erhofft hatte.
Er bog um eine Straßenecke und wäre fast von einem Taxi angefahren worden, das einem Schlagloch im Asphalt von gut einem Meter Durchmesser ausgewichen war. Der Fahrer hupte, als hätte gerade nicht er, sondern Bonaventure einen unerwarteten Schlenker gemacht, und rief ihm empört etwas Unverständliches aus dem geöffneten Fenster zu. Bonaventure sah dem Auto nachdenklich hinterher. Je mehr Menschen vom Land in die Stadt zogen in der Hoffnung, damit auch ihrer Armut zu entfliehen, desto voller und chaotischer wurde es hier. Das Taxi fädelte sich mit einem gewagten Manöver in den dichten Verkehr auf der Hauptstraße ein, die Bonaventure gerade verlassen hatte. Auf der anderen Straßenseite standen große Reklametafeln. Eine von ihnen warb für das Bier, das Bonaventures Vater so verachtet hatte, eine weitere für eine Bank, die weltweite Geldtransfers binnen weniger Minuten anpries, und eine dritte für eine europäische Fluglinie, die seit einigen Monaten dreimal in der Woche die Hauptstadt anflog. Ein junges Pärchen strahlte um die Wette in die Kamera, hinter ihnen waren ein Flugzeug und die Silhouette einer europäischen Großstadt zu sehen. „Pünktlich zum Frühstück dort – über Nacht nach Europa!“ lautete der Slogan, der in knallgelben Lettern unter dem Pärchen prangte. Bonaventure blinzelte ein wenig gegen die gleißende Mittagssonne. Die Häuser der Stadt auf dem Plakat waren so ganz anders als fast alles, was er aus seinem Land kannte. Sie waren riesengroß, hatten gewaltige Fensterfassaden und schienen in hervorragendem Zustand zu sein. Wer auch immer dort lebte, musste eine Menge Geld haben. Aber das hatten schließlich alle Europäer, wie Bonaventure wusste. Zwar gab es bei ihm im Dorf keinen Fernseher, doch sein altes Radio lieferte ihm seit vielen Jahren treu und zuverlässig Informationen aus der großen weiten Welt.
Eine Gruppe Straßenkinder kam Bonaventure entgegen, ihre zerrissenen T-Shirts und Hosen hatten längst die eigentümlich farblose Tönung des Drecks und Staubs angenommen, in dem sie lebten. Nur einen Augenblick später hatten sie sich um ihn geschart.
„Monsieur, wir haben Hunger, haben Sie ein bisschen Geld für uns?“
Bonaventure, jäh aus seinen Gedanken gerissen, griff reflexartig in seine Hosentasche – nur um festzustellen, dass sie leer war. Früher, in dem Leben, als er noch Arbeit gehabt hatte, hatte er stets ein paar kleine Scheine bei sich getragen, um bettelnden Kindern wie diesen ihr hartes Leben zumindest für einen kurzen Moment etwas zu erleichtern.
„Es tut mir leid“, sagte er jetzt und vermied es, ihnen in die Augen zu sehen. „Ich habe selber nichts.“
Die ganze Wahrheit war das nicht. In der Innentasche seines abgetragenen Jacketts steckten noch ein paar Banknoten; gut die Hälfte von dem, was Jean-Marie ihm gegeben hatte, um die Fahrt mit dem Minibus in die Stadt bezahlen und sich ein einfaches Mittagessen leisten zu können.
Die Kinder hefteten sich an seine Fersen. „Bitte, Monsieur, wir haben seit Tagen nichts mehr gegessen!“ Sie streckten ihm geöffnete Handflächen entgegen und zupften an seiner Hose. „Bitte, Monsieur, bitte, nur ein kleines bisschen.“
Bonaventure merkte, dass eine der kleinen, verlumpten Gestalten Mühe hatte, mit den anderen mitzuhalten. Das Mädchen hielt einen Stock in der Hand, auf den es sich bei jedem Schritt stützte. Sein rechtes Bein endete etwa zehn Zentimeter über dem Boden in einem unförmigen Stumpf. Auch sieben Jahre nach seinem offiziellen Ende waren der Krieg und seine fürchterlichen Verbrechen allgegenwärtig. Es waren Erwachsene, die kämpften und mordeten – doch es waren die Kinder, die die Narben des Wahnsinns ein Leben lang tragen mussten.
Bonaventure blieb stehen und griff in sein Jackett. Das Mittagessen würde heute noch bescheidener ausfallen als sonst.
Gut eine Viertelstunde später saß er in Monsieur Gérards winzigem, stickigem Büro unweit des zentralen Marktes. Monsieur Gérard war bereits der vierte Busunternehmer, bei dem er heute vorsprach. Bisher hatte er nur Absagen erhalten. Eigentlich hatte Bonaventure es stets abgelehnt, als Minibus-Fahrer zu arbeiten, und Greta hatte ihn in dieser Haltung bestärkt. Denn nicht nur waren die meisten Fahrzeuge in äußerst schlechtem Zustand; damit sich das Geschäft lohnte, mussten die Fahrer ihre maroden Gefährte zudem stets so voll beladen, wie es nur irgend ging, und außerdem rasen, was das Zeug hielt: Wer die meisten Fahrten mit den meisten Fahrgästen machte, verdiente das meiste Geld. Nicht wenige bezahlten diese Hatz nach ein paar Scheinen mehr in der Hosentasche mit ihrer Gesundheit oder gar mit ihrem Leben. Bonaventure kannte die Gefahren, die die kurvigen, teils stark ausgesetzten Straßen in den Hügeln mit sich brachten, nur allzu gut. Einmal war auch er selbst mit seinem Militärjeep nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, als er plötzlich einer Ziegenherde mitten auf der Fahrbahn hatte ausweichen müssen und seine Räder erst wenige Zentimeter vor dem Abgrund zum Stehen gekommen waren.
Doch jetzt war er nicht mehr in der Position, wählerisch zu sein. Er hatte eine Familie zu ernähren, Schulgeld für die Kinder zu bezahlen und zu allem Überfluss auch noch ein neues Haus zu bauen.
Monsieur Gérard tupfte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Wie fast alle Geschäftsleute in der Hauptstadt kannte er Bonaventure und die meisten seiner Kollegen seit Jahren. Als Fahrer einflussreicher Menschen waren sie fast so bekannt wie ihre Patrone selbst, schließlich begleiteten sie sie bei all ihren Unternehmungen. Während ihre Chefs in irgendwelchen Hinterzimmern verschwanden, um wichtige Dinge zu besprechen, warteten Bonaventure und die anderen Chauffeure im Schatten der Häuser auf die Rückkehr ihrer Dienstherren, tauschten Neuigkeiten aus, ruhten sich ein wenig aus oder polierten ihren vierrädrigen Arbeitsplatz auf Hochglanz. Es war ein privilegierter Job: Kaum jemand kam so viel im Land herum, und verdienen ließ sich auch recht gut. Wenn man Arbeit hatte.
Monsieur Gérard war ein dicker Mann. Seine Leibesfülle kündete von dem Wohlstand, den ihm sein Unternehmen gebracht hatte. Man munkelte, dass dazu auch gewisse nächtliche Fahrten mit zweifelhafter Ladung im Auftrag mindestens ebenso zweifelhafter Kunden gehörten, aber das waren bislang nur Gerüchte. Eine polizeiliche Untersuchung vor einigen Jahren jedenfalls hatte keine Beweise für Monsieur Gérards Verstrickung in illegale Aktivitäten gebracht.
Er drehte einen silberfarbenen Kugelschreiber zwischen seinen fleischigen Fingern. „Nun, Bonaventure, lassen Sie mich ehrlich mit Ihnen sein: Ich kann momentan keinen neuen Fahrer gebrauchen.“
Bonaventure spürte, wie der Funke Hoffnung, der ihn in Monsieur Gérards Büro begleitet hatte, wieder zu verlöschen drohte.
„Aber Monsieur Gérard, Sie haben doch eben erst drei neue Busse gekauft. Gervais hat mir davon erzählt. Sie stehen noch im Lager der Zollstation, er selbst hat ihre Papiere auf seinem Schreibtisch.“
Monsieur Gérard seufzte und tupfte sich erneut Schweiß von Stirn und Nacken. „Das ist wohl richtig. Aber Sie wissen ja, wie das ist mit dieser Importware aus Europa. Nur Probleme! Erst wartet man eine halbe Ewigkeit, bis der ganze Papierkram erledigt ist, und dann stellt sich heraus, dass der eine Bus ein neues Radlager braucht, der andere eine neue Antriebswelle – nichts als Ärger.“
„Ich könnte Ihnen dabei helfen, die Busse zu reparieren. Ich könnte das sogar umsonst tun, und wenn sie dann wieder fahrbereit sind …“
„Ich habe bereits eine Werkstatt beauftragt, die Busse in Augenschein zu nehmen, sobald sie durch den Zoll sind.“
„Gut, aber dann brauchen Sie immer noch neue Fahrer, wenn die Busse einsatzbereit sind.“ Bonaventure senkte den Blick. „Bitte verzeihen Sie mir, dass ich so aufdringlich bin“, setzte er mit leiser Stimme hinzu, „aber ich brauche dringend Arbeit.“ Er schluckte. „Es ist in letzter Zeit nicht so gut gelaufen für meine Familie und mich.“
Monsieur Gérard sah ihn prüfend an. „Ich habe schon Fahrer eingestellt. Sie warten nur darauf, dass es endlich losgehen kann.“
„Aber Monsieur Gérard, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen widerspreche.“ Bonaventure fühlte Verzweiflung in sich aufsteigen. „Als ich heute früh am Busbahnhof war, sprachen viele Fahrer von Ihren neuen Bussen, doch keiner wusste etwas davon, dass Sie bereits Personal gefunden haben.“
Schweigen.
Der Stuhl ächzte, als sich Monsieur Gérard in ihm zurücklehnte. Die Augen hielt er dabei unverwandt auf Bonaventure gerichtet.
„Wissen Sie eigentlich, wie man über Sie redet?“, beendete der massige Mann plötzlich die Stille.
Bonaventure zuckte innerlich zusammen. Konnte es sich so schnell herumgesprochen haben, was ihm und seiner Familie erst vor wenigen Tagen widerfahren war? Dass sie kein Haus mehr hatten? Dass sie Almosen von Jean-Marie annehmen mussten? Dass er nicht in der Lage war, für seine Kinder und seine Frau zu sorgen?
„Nicht wenige sagen, Sie seien selbst ein Rebell.“
Bonaventure verschlug es die Sprache. Er starrte Monsieur Gérard ungläubig an. Was hatte der dicke Geschäftsmann da gerade gesagt? Er musste sich verhört haben.
„Wie lange haben Sie den Bischof gefahren, bevor er abgesetzt wurde? Vier Jahre? Fünf Jahre?“
Bonaventure rang um Fassung. „Drei. Es waren drei Jahre. Und der Bischof …“
„War kein Rebell, nein. Zumindest nicht offensichtlich. Aber er sympathisierte mit gewissen Leuten, die der Regierung ein Dorn im Auge waren. Irgendwann ist das Rom wohl zu Ohren gekommen.“
Monsieur Gérard beugte sich über den Tisch und legte die Unterarme auf die Platte. Dann hob er den Kopf und sah Bonaventure direkt in die Augen, die Stirn in Falten gelegt. „Sie waren sein Fahrer. Sie haben mehr Zeit mit ihm verbracht als viele Männer mit ihren Frauen. Sie können mir nicht weismachen, dass Ihnen das alles egal war, oder gar, dass Sie nichts davon wussten.“
„Monsieur Gérard, ich weiß nur, dass der Bischof ein guter Mann war. Wenn er nicht in allem mit der Regierung übereinstimmte, dann deshalb, weil er das Beste für sein Land wollte.“
Der dicke Unternehmer setzte sich auf und machte eine Handbewegung, als wolle er lästige Fliegen vom Tisch verscheuchen. „So funktioniert Politik aber nicht. Der Bischof gehörte zu den falschen Leuten, und Sie gehörten zum Bischof.“ Seine Stimme sank um eine gefühlte Oktave. „Und dann ist da auch noch die Sache mit Ihrem Bruder.“ Monsieur Gérard machte eine abwehrende Geste, als wolle er einem möglichen Einwand Bonaventures zuvorkommen. „Es ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber die Leute haben ein gutes Gedächtnis. Ich auch. Niemand wird Ihnen hier Arbeit geben, Bonaventure, weil sich niemand bei den Herren im Parlamentsgebäude verdächtig machen will. Und auch ich habe nicht vor, in den Ruf zu kommen, unglückliche Verbindungen zu pflegen.“
Er seufzte, als müsse er eine schwere Entscheidung fällen.
„Es tut mir leid, aber ich kann nichts für Sie tun.“
Bonaventure starrte den Mann, der sein Arbeitgeber hatte werden sollen, mit weit aufgerissenen Augen an.
„Monsieur Gérard“, setzte er noch einmal verzweifelt an, „ich war nur sein Fahrer. Ich habe seinen Jeep gefahren, mehr nicht“, fügte er leise hinzu, und als er es sagte, fühlte er sich wie ein Verräter. „Und mein Bruder …“
Doch der Busunternehmer hatte sich bereits erhoben und streckte ihm die Hand zum Abschied entgegen.
„Viel Glück da draußen, Bonaventure. Sie werden es brauchen.“