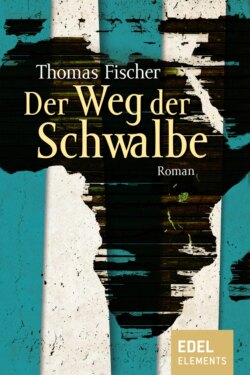Читать книгу Der Weg der Schwalbe - Thomas Fischer - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление10
Die nächsten Wochen verliefen ohne weitere Zwischenfälle. Bonaventure fuhr noch zweimal in die Hauptstadt – einmal davon, ohne bezahlen zu müssen, da ehemalige Militärkameraden ihn in ihrem olivgrünen Jeep mitnahmen –, doch stets kehrte er schweigsam und in sich gekehrt zurück. Die übrige Zeit verbrachte er in der Ruine seines Hauses und versuchte, aus dem Schutt zu retten, was zu retten war. Nach der Schule stieß Montfort zu ihm, bisweilen in Begleitung seines Freunde Gustave, und gemeinsam machten sie sich in den wenigen Stunden, die ihnen bis zum Sonnenuntergang blieben, daran, die Trümmer beiseite zu räumen und den Bauplatz nach und nach wieder freizulegen. Es war eine Knochenarbeit. Oft schufteten sie mit nacktem Oberkörper, bis ihnen der Schweiß in Strömen herablief und ihre Rücken schmerzten, doch wenigstens hatte Bonaventure so das Gefühl, dass sich etwas bewegte – auch wenn er nicht wusste, wie es danach weitergehen sollte.
Greta verbrachte ihre Tage zwischen dem Garten, der nach wie vor ein kümmerliches Bild bot, und der Krankenstation, wobei sie in Letzterer glücklicherweise immer weniger benötigt wurde, je mehr Zeit seit den Erdstößen vergangen war. Meistens hatte sie die kleine Belize dabei, und Greta achtete stets darauf, dass das Kind den Patienten mit ansteckenden Krankheiten nicht zu nahe kam.
Die Bilanz des Bebens war verheerend für das ganze Dorf, nicht nur für Greta und Bonaventure. Neben den vielen Verletzten waren auch zwei Tote zu beklagen: ein Säugling, der von herabstürzenden Dachbalken im Schlaf erschlagen worden war, und ein alter Mann, dessen Herz die Schrecken jener Nacht wohl nicht mehr hatte ertragen können und einfach stehen geblieben war. Das Haus des Witwers hatte die Naturkatastrophe unbeschadet überstanden, und seine Kinder fanden ihn in seinem Sessel sitzend, die Augen weit geöffnet und ein kleines hölzernes Kruzifix in der dürren, leblosen Hand. Die acht eingestürzten Häuser hatten insgesamt zweiundfünfzig Menschen zu Obdachlosen gemacht. Manche, wie Greta und Bonaventure, kamen bei Familienmitgliedern unter; die weniger Glücklichen errichteten aus Trümmerteilen, alten Säcken und dem, was die Natur um das Dorf hergab, notdürftige Unterkünfte, in denen sie dem Wind und der Kühle der Nacht fast schutzlos ausgeliefert waren. Die Hilfe, die die Regierung versprochen hatte, war nie gekommen. Und jetzt, fast drei Wochen nachdem der ostafrikanische Grabenbruch so unbarmherzig daran erinnert hatte, dass der Kontinent im Begriff war, sich zu spalten, rechnete auch niemand im Dorf mehr damit, dass Unterstützung aus der Hauptstadt eintreffen würde. Immerhin hatte eine europäische Hilfsorganisation einige Medikamente und Verbandmaterial zur Verfügung gestellt, sodass die Krankenstation keine Verletzten hatte abweisen müssen.
Doch darüber hinaus waren sie auf sich allein gestellt, wieder einmal; wie unser ganzes Leben lang, dachte Bonaventure und sog die Luft zwischen zusammengebissenen Zähnen ein, während er einen großen, scharfkantigen Zementbrocken in Etappen an den Rand des Trümmerfeldes wuchtete. Es war früher Nachmittag, und Montfort war noch nicht aus der Schule zurückgekehrt. Was würden sie jetzt tun, wenn sie Jean-Marie und Monia nicht hätten? Die ihnen Obdach und Kleider gaben, die sie so selbstverständlich in ihrer Mitte aufgenommen hatten, als sie fast alles verloren hatten. Würden sie auch in einem behelfsmäßigen Unterstand hausen, in dem ihnen die Feuchtigkeit der Nacht in die Glieder kroch, in dem sie ihre Matten mit Schnecken und Tausendfüßlern teilten und ihr weniges Hab und Gut offen für jedermann dalag, sobald sie ihn verließen? Würden sie krank werden, ohne sich eine Behandlung leisten zu können? Würden die Kinder die Schule abbrechen müssen, um als Tagelöhner auf fremden Feldern oder Baustellen mit zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen? Würde sich Montfort, wie so viele andere junge Männer, gar als Soldat verdingen müssen, um als Teil einer afrikanischen Schutztruppe in irgendeinem fremden Land sein Leben aufs Spiel zu setzen, da sie nur noch so zu dem bisschen Geld kommen konnten, das sie zum Leben brauchten? Und würde er, Bonaventure, der Ehemann, der Vater, das alles mit ansehen können, ohne verrückt zu werden?
Er stieß den Atem aus, während er den Zementbrocken an seinem Bestimmungsort zu Boden fallen ließ, richtete sich auf und streckte das Kreuz durch. Als er wieder in den Schutt stieg, fiel sein Blick auf etwas Rotes, das unter einigen Mauerfragmenten eingeklemmt war. Er beugte sich herunter und zog daran. Nur widerwillig gab die Ruine das Fundstück frei, doch schließlich lag ein schlaffer Fetzen in seiner Hand. Aléxines Ball.
Kannst du ihn wieder ausgraben, Papa?
Natürlich werde ich ihn ausgraben, mein Engel.
Sicher?
Ganz sicher.
Bonaventure hatte versucht, stark zu sein. Für seine Kinder, für seine Frau und für sich selbst. Doch jetzt spürte er, wie alle Kraft ihn verließ, wie seine Beine nachgaben und er auf die Knie fiel. Er stützte sich mit den Händen in den Staub, die rechte hielt immer noch den ehemals kostbarsten Besitz seiner Tochter umklammert, während sein ganzer Körper zitterte, und Bonaventure weinte, bis keine Träne mehr kam. Irgendwann, als er so trocken und ausgedörrt war wie der Boden unter ihm, ließ er sich erschöpft zur Seite fallen, ohne zu wissen, wie er je wieder die Kraft finden sollte aufzustehen.
Sicherlich, sie hatten ein Dach über dem Kopf, und vorerst reichten Jean-Maries Gehalt und die Erträge aus den Gärten der beiden Familien gerade noch aus, um sie zu ernähren. Doch lange würde es so nicht weitergehen können, dessen war sich Bonaventure deutlicher bewusst als je zuvor, auch wenn Jean-Marie nach wie vor energisch und bestimmt über jeden seiner Versuche hinwegging, die Probleme anzusprechen, die hinter dem Horizont unausweichlich auf sie warteten.
„Wenn es dir so schwerfällt, unsere Hilfe anzunehmen, dann solltest du dich vielleicht wieder einmal daran erinnern, dass wir ohne dich gar nicht in der Lage dazu wären“, hatte Jean-Marie ihm vor einigen Tagen gesagt – und in der Tat hatte sein Bruder mit dieser etwas verwirrenden Formulierung wohl recht.
Es war im Jahr nach Montforts Geburt gewesen, als Jean-Marie mit gerade einmal fünfundzwanzig Jahren sein Studium der Geschichte an der Universität in der Hauptstadt abgeschlossen hatte. Möglich gemacht hatten das seine außergewöhnlich guten Noten in der Schule. Wer wie Jean-Marie landesweit zu den Jahrgangsbesten unter den Abiturienten gehörte, wurde automatisch an der einzigen staatlichen Hochschule des Landes zugelassen, durfte umsonst im Studentenwohnheim leben und erhielt zudem noch ein kleines Taschengeld aus der Staatskasse. So konnte es geschehen, dass sich einem jungen Menschen Türen in ein neues, privilegierteres Leben auftaten, auch wenn er aus einfachsten Verhältnissen stammte wie Jean-Marie und sein Bruder. Ihre Eltern, obgleich selbst des Lesens und Schreibens nicht mächtig, hatten früh begriffen, dass Jean-Marie alle Anlagen mitbrachte, um sein Geld einmal mit einer Tätigkeit zu verdienen, die nicht unvermeidlich einen krummen Rücken, Schwielen an den Händen und ständige skeptische Blicke gen Himmel und auf das Wetter, das sich dort zusammenbraute oder auch nicht, mit sich brachte. Daher hatten sie alles dafür getan, dem kleinen schmächtigen Kind eine gute Schulbildung zu ermöglichen, auch wenn sie dafür seine Hilfe auf den Feldern und beim Wasserholen entbehren mussten, und Jean-Marie hatte sie nicht enttäuscht.
Doch Jean-Maries unbestreitbar hohe Intelligenz brachte auch eine ebenso unbestreitbare Tendenz dazu mit, sich zuverlässig immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen. Grund dafür war seine Neigung, nichts einfach als gegeben hinzunehmen, sondern alles zu hinterfragen. Das galt für die Befähigung der Professoren, die ihn an der Universität unterrichteten, ebenso wie für die Motivation seiner Kommilitonen (wollten sie lernen, um später einmal ihren Mitmenschen zu dienen und ihr Land voranzubringen, oder wollten sie lernen, um sich später einmal die Taschen vollzustopfen?). Er zweifelte an der Reinheit des Bananenweins, den er und seine Freunde sich ab und zu am Wochenende in einer der zahlreichen Kaschemmen der Hauptstadt gönnten. Die Preise, die die Fahrer der Fahrradtaxen anschließend für den Transport eines ausnehmend betrunkenen jungen Mannes von der Kaschemme zum Wohnheim nahmen, stellte er genauso infrage wie die Reinheit der Gefühle jener jungen Damen, die selbigen ausnehmend betrunkenen jungen Mann gelegentlich in das Wohnheim begleiteten. Und doch hätte all dies Zweifeln Jean-Marie wohl nur den Ruf eines zwar ausgemachten und ziemlich nervtötenden, aber letztlich harmlosen Querulanten eingetragen, hätte er nicht irgendwann damit begonnen, sein Land im Allgemeinen und dessen politische Vertreter im Besonderen infrage zu stellen.
Ein Jahr, nachdem er sein Studium aufgenommen hatte, entbrannte der Bürgerkrieg. Die Kluft, die sich schon zuvor durch die Bevölkerung gezogen hatte – ein Riss noch tiefer und bedrohlicher als der ostafrikanische Grabenbruch –, vergrößerte sich ins scheinbar Unüberbrückbare, und nun entlud sich mit Macht die über Jahrzehnte aufgebaute Spannung. Überall kam es zu Morden und Massakern, Angst und Verzweiflung legten sich wie ein dunkler Schatten über das Leben der Menschen. Abendliche Ausgangssperren wurden verhängt. Entlang der Überlandstraßen reihte sich ein Kontrollposten des Militärs an den anderen. Maschinenpistolen und anderes Mordwerkzeug aus den überseeischen Arsenalen des Kalten Krieges, nach dessen Ende nun in Europa nutzlos geworden, überschwemmten das Land. Wo das Geld dafür nicht reichte, wurden Buschmesser von bäuerlichen Werkzeugen zu todbringenden Waffen umfunktioniert. Wann immer das Morden die Hauptstadt erreichte, versteckten sich die Menschen in ihren Hütten und Häusern und beteten darum, vom Schlimmsten verschont zu bleiben. Zwar ging der Alltag irgendwie weiter, doch jeder Gang zum Markt, jede Fahrt mit dem Minibus durch die Hügel, jeder sonntägliche Gottesdienstbesuch wurde zum Vabanquespiel.
Jean-Marie ängstigte sich nur wenig um sich selbst, doch er wurde fast verrückt vor Sorge um seine Familie, vor allem seinen Bruder, der als Fahrer für die Armee unentwegt in den Epizentren des Wahnsinns unterwegs war, der sich ihres Landes bemächtigt hatte. In Jean-Maries Augen war der Krieg mehr als ein spät eingelöstes Erbe der Kolonialzeit; er sah in ihm die faule Frucht einer Politik, die auf Korruption, Günstlingswirtschaft und Lügen fußte.
Im dritten Jahr des Krieges, zwölf Monate nachdem Bonaventure humpelnd und mit grotesk geschwollener Nase die Krankenstation betreten und das Herz der jungen Krankenschwester dort gewonnen hatte, trat Jean-Marie mit dreiundzwanzig Jahren einer Organisation bei, die sich „Liga der Unbestechlichen“ nannte und ihre Reihen hauptsächlich aus Studenten rekrutierte. Sie war wenig mehr als ein Debattierklub; Substanzielleres als die eine oder andere halbherzige Flugblattaktion und den äußerst kurzlebigen Versuch, einen Radiosender aus dem Untergrund zu betreiben (er scheiterte früh am Fehlen eines Mikrofons sowie jeglicher sonstiger Technik), brachte die Liga der Unbestechlichen nicht zustande. Doch es reichte, um sich den Zorn der Regierenden zuzuziehen, und so landete die Liga schnell auf der Liste der verbotenen Organisationen.
Eines Abends, Jean-Marie und die beiden Kommilitonen, mit denen er das Zimmer teilte, waren gerade dabei, zu Bett zu gehen, klopfte es an der Tür. Noch bevor einer von ihnen aufstehen konnte, um nachzusehen, wer zu dieser späten Zeit störte, traten drei Männer unaufgefordert ein. Einer von ihnen trug einen eleganten Anzug, die beiden anderen, die sich im Hintergrund hielten, verbargen ihre Augen trotz der nächtlichen Stunde hinter dunklen Sonnenbrillen.
Der Mann im Anzug sah sich im Schein der alten Neonröhre, die das Zimmer mehr schlecht als recht erleuchtete, für einen Augenblick um. Dann lächelte er ein Lächeln, das schneeweiße Zähne sehen ließ, seine Augen aber nicht erreichte.
„Wer von Ihnen ist Jean-Marie?“
Der Angesprochene musste nicht lange nachdenken, mit wem er es hier zu tun hatte. Seine Zimmergenossen gehörten nicht zur Liga der Unbestechlichen, und Jean-Marie wusste, dass er sie aus dieser Sache heraushalten musste. Er setzte sich in seinem Bett auf, und obwohl er all seinen Mut zusammennahm, bebte seine Stimme, als er sagte: „Das bin ich.“
Der Anzugträger machte eine einladende Geste mit seiner rechten Hand.
„Folgen Sie uns bitte. Sofort.“
Draußen vor dem Wohnheim wartete ein Jeep mit abgeblendeten Scheinwerfern. Die beiden Männer mit den Sonnenbrillen schoben Jean-Marie, immer noch nur mit einer Unterhose und einem alten T-Shirt bekleidet, auf den Rücksitz und nahmen ihn in ihre Mitte. Der Anzugträger setzte sich auf den Beifahrersitz und bedeutete dem Chauffeur loszufahren. Der Jeep setzte sich in Bewegung.
Die kaum beleuchteten Straßen der Hauptstadt waren menschenleer, wieder einmal war eine Ausgangssperre in Kraft. Über eine vierspurige Umgehungsstraße fuhren sie stadtauswärts. Alle Kontrollposten, an denen sie vorbeikamen, salutierten, sobald sie den Jeep erkannten, und ließen sie ungehindert weiterfahren. Sie durchquerten die Slums mit ihren armseligen Hütten, die, je weiter sie aus der Stadt kamen, nach und nach von Kasernen und Lagerhäusern und schließlich von Feldern abgelöst wurden. Irgendwann, Jean-Marie erschien es wie eine Ewigkeit, bog der Jeep scharf nach rechts auf eine unbefestigte Piste ab. Das Fahrzeug holperte durch Schlaglöcher, draußen zeichneten sich mächtige Bäume schwarz vor dem Sternenhimmel ab, und das Zirpen der Zikaden war durch den schmalen Schlitz zu hören, den die Fenster heruntergerollt waren.
Als sie schließlich an eine Brücke kamen, die über einen schmalen Flusslauf führte, hielt der Jeep. Wortlos öffneten die Männer die Türen, zerrten Jean-Marie heraus und schubsten ihn die Böschung zum Wasser hinunter. Schilf säumte den Rand des Baches, der leise gluckerte und zahlreiche Findlinge an seinem Ufer umspülte. Jean-Maries Atem ging schnell und er zitterte, obwohl die Nacht warm war. Er drehte sich um und versuchte, seine Entführer in der Dunkelheit auszumachen. Dabei bemerkte er, dass die Männer mit den Sonnenbrillen diese abgenommen hatten. Dafür hielt einer von ihnen jetzt eine Kalaschnikow in der Hand.
Der Anzugträger war einige Meter von Jean-Marie entfernt oben am Rande der Böschung stehen geblieben. Von einem Lächeln war nun nichts mehr zu sehen, als er auf ihn heruntersah und das Wort an ihn richtete.
„Du hältst dich also für besonders schlau, was?“
Jean-Marie spürte, wie es ihm warm an der Innenseite seines Beins herablief. Noch nie hatte er solche Angst gehabt.
„Man sollte dich zu dem ganzen anderen Pack ins Gefängnis sperren. Wenn das bloß nicht so eine fürchterliche Platzverschwendung wäre“, zischte der Anzugträger und stieg langsamen Schrittes zu Jean-Marie herab, gefolgt von seinen Männern. „Deshalb haben wir uns etwas anderes für dich ausgedacht. Dreh dich um!“
Jean-Maries Beine drohten unter ihm nachzugeben, als er sich langsam umwandte. Tränen liefen ihm übers Gesicht, während er sich fragte, ob er die Salve noch hören würde, die seinem Leben in wenigen Augenblicken ein Ende setzen würde.
Dann explodierte Schmerz wie ein weißer Feuerball hinter seinen Augen. Er fiel vornüber und landete mit dem Gesicht im Wasser. Benommen hörte er die Männer lachen, dann das Zuschlagen der Autotüren und schließlich, wie der Jeep sich entfernte. Als das Motorengeräusch in der Finsternis verklungen war, drehte er sich stöhnend zur Seite und betastete vorsichtig seinen Hinterkopf, den der hölzerne Kolben der Maschinenpistole getroffen hatte. Er fühlte etwas Feuchtes, wusste aber nicht, ob es Blut oder nur Wasser war. Langsam richtete er sich auf, doch ihm wurde schwindelig, und er setzte sich wieder in den Schlamm. Sie hatten ihn nicht getötet! Aber warum hatten sie ihn hierhergebracht? Mit der rechten Hand stützte er sich auf einen der großen Steine am Ufer. Der Stein war weich und nachgiebig unter seiner Hand. Jean-Marie sah an seinem Arm herunter. Ein halb verwestes Gesicht schaute aus milchigen Augen zu ihm herauf. Er schrie auf und riss seine Hand weg, als hätte er sich an glühenden Kohlen verbrannt. Sein Herz hämmerte, während seine Augen über das Ufer rasten. Es war übersät von dunklen runden Erhebungen – und unter ihnen war kein einziger Stein.
Wie genau er zurück in die Stadt gekommen war, wusste Jean-Marie später nicht mehr zu sagen. Die Warnung aber hatte er sehr wohl verstanden, und die Liga der Unbestechlichen kam nie wieder zusammen.
Als Jean-Marie zwei Jahre später – immer noch in den Wirren des Bürgerkrieges – sein Examen bestand, haftete der Makel seiner illegalen politischen Aktivitäten wie eine Klette an ihm. So sehr er sich auch bemühte, jede seiner Bewerbungen um eine Lehrerstelle wurde zurückgewiesen. Auch wenn er es nie beweisen konnte, hatte sein Engagement in der Liga offensichtlich Eingang in seine Akte beim Erziehungsministerium gefunden, sodass jede Schule, der er sich anbot, automatisch davon erfuhr und ihn folglich ablehnte. Niemand wollte es sich mit den Mächtigen verderben – eine Lektion, die auch sein Bruder fünfzehn Jahre später in dem stickigen Büro eines übergewichtigen Busunternehmers lernen sollte.
Einige Monate später besuchte Jean-Marie Bonaventure und dessen kleine Familie in ihrem Dorf, um endlich seinen Neffen Montfort kennenzulernen, der kurz zuvor zur Welt gekommen war. Zu dieser Zeit verdiente er sich sein Geld mehr schlecht als recht mit dem Verfassen von Briefen für Landsleute, die nie eine Schule von innen gesehen hatten. Es war weiß Gott nicht viel, reichte aber aus, um ihn am Leben zu erhalten. Bonaventure und Greta hatten zwei Jahre zuvor geheiratet, der kleine Montfort war gerade einmal zwölf Monate alt.
Sie saßen im Schatten auf der Veranda des Hauses, das Bonaventure und Greta kurz nach ihrer Hochzeit gebaut hatten, der ganze Stolz des jungen Ehepaares, und aßen Ubugali. Mit den Händen rissen sie kleine Stücke des festen, glatten Getreidebreis ab und tunkten sie in eine Schale mit gekochten Bohnen. Montfort schlummerte in einem kleinen Korb, der neben ihnen stand, und bewegte ab und zu die Ärmchen im Schlaf. Zu jener Zeit gab es noch kein Handynetz im Land, und die beiden Brüder hatten seit Langem nicht mehr voneinander gehört. Es war eine glückliche Fügung, dass Jean-Marie ihn überhaupt zu Hause angetroffen hatte; oft war er wochenlang am Stück mit seiner Einheit unterwegs, und Greta war allein mit dem Kind.
Als Jean-Marie Bonaventure von seinen erfolglosen Bemühungen um eine Anstellung als Lehrer berichtete, unterbrach der seine Mahlzeit und hörte seinem Bruder mit vor dem Gesicht gefalteten Händen aufmerksam zu. Nachdem Jean-Marie geendet hatte, stand der große Mann auf und sagte: „Komm, wir machen einen Spaziergang, ich möchte dich jemandem vorstellen.“
Die beiden ungleichen Brüder warfen lange Schatten, als sie im Licht der tief stehenden Nachmittagssonne durch das Dorf gingen. Schließlich erreichten sie einen großen Platz im Herzen der Siedlung, um den sich u-förmig drei lang gezogene Gebäude gruppierten. Bonaventure hielt zielstrebig auf den Trakt am Kopfende des Platzes zu. Dort angekommen, klopfte er an eine Tür, auf der in geschwungenen Lettern „Büro des Schuldirektors“ stand. Eine Stimme aus dem Inneren des Gebäudes hieß sie einzutreten, und Bonaventure öffnete die Tür.
In dem kleinen Raum war es düster, das einzige Fenster war winzig und ließ nur wenig Licht herein. Hinter einem Schreibtisch, auf dem sich unzählige Hefte und Papierstöße stapelten, saß ein älterer Mann in einem abgetragenen Anzug mit grauen Haaren und einer Brille, deren einer Bügel mit einem Stück Draht befestigt worden war. Er schüttelte den Brüdern mit festem Griff die Hand und bedeutete ihnen zugleich mit der Linken, in der er einen Kugelschreiber hielt, auf zwei Stühlen Platz zu nehmen, die dem Tisch gegenüber standen.
„Bonaventure, was führt dich zu mir? Und wen hast du mir mitgebracht?“
„Das ist Jean-Marie, mein Bruder. Er ist aus der Hauptstadt zu Besuch gekommen.“
Der Direktor musterte Jean-Marie eindringlich. Seine Brillengläser waren dick wie Flaschenböden; die gelbliche Verfärbung seiner Augäpfel ließ erahnen, dass die Malaria seine ständige Begleiterin war.
„Wir leben in unsicheren Zeiten“, sagte er schließlich, ohne Jean-Marie aus den Augen zu lassen. „Da ist es gefährlich, zu reisen.“
„Ich wollte meinen Neffen kennenlernen“, erwiderte Jean-Marie, während er versuchte, dem prüfenden Blick des alten Herrn standzuhalten.
„Das ist gut“, sagte der Direktor, und der Anflug eines Lächelns huschte über sein Gesicht. „Familien müssen zusammenhalten in diesen Tagen, wo Nachbarn ihre Hände gegeneinander erheben.“
„Wir haben immer zueinander gehalten“, erwiderte Bonaventure, „niemals würden wir uns gegeneinander wenden.“
Der Direktor nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen.
„Und doch sind wir alle Verlierer in diesem Krieg, egal, wo wir angeblich herkommen oder hingehören.“
Plötzlich wirkte er sehr müde. Er sah die beiden Brüder abwechselnd an.
„Wisst ihr, wohin ihr gehört? Wer auf der richtigen Seite steht und wer auf der falschen? Wer es verdient hat, mit einem Buschmesser zu Tode gehackt zu werden, und wer weiterleben darf?“
Bonaventure und Jean-Marie schwiegen.
Der Direktor klopfte auf einen Stapel Papier, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag.
„Wenn ich in die Gesichter der Kinder sehe, die diese Aufsätze geschrieben haben, dann muss ich mich manchmal zwingen, nicht zu verzweifeln. Schon in jüngsten Jahren wird ihnen die Vorstellung eingeimpft, dass es die einen und die anderen gibt. Ihre Eltern, die Nachbarn, sogar manche Lehrer an dieser Schule bringen ihnen bei, wohin sie gehören, und vor allem, wohin nicht. Sie lernen zu hassen, aber wenn man sie fragen würde, könnten sie nicht erklären, warum. Nur, dass man es ihnen gesagt hat. Dass dieser oder jener zu den anderen gehört“, der Direktor verzog dabei das Gesicht vor Abscheu, „und deswegen wenn schon nicht den Tod, so doch zumindest alles Unglück dieser Welt verdient hat. Und sie glauben es!“
Der alte Herr hatte sich nun in Rage geredet.
„Sie glauben es, und es wird zum unveränderlichen Bestandteil ihrer Sicht auf die Welt. Sie nehmen es so selbstverständlich hin wie die Tatsache, dass es Regen- und Trockenzeiten gibt und dass die Sonne morgens hinter den Hügeln im Osten aufgeht und hinter denen im Westen abends wieder versinkt.“
Der Direktor sah für einen Moment aus dem Fenster, das den zu dieser späten Tageszeit verwaisten Schulhof überblickte. In der Mitte stand ein Flaggenmast, von dem die Landesfahne in der stillen Abendluft traurig herabhing.
„Dann wachsen sie heran. Sie werden größer, heiraten eines Tages und bekommen selber Kinder. Und geben ihnen weiter, was sie einst gesagt bekamen. Ob es richtig oder falsch ist, haben sie nie zu hinterfragen gelernt, und sie tun es auch jetzt nicht, ebenso wenig, wie ihre Kinder es tun werden. Das ist es, was man eine Spirale des Hasses nennt!“
„Und die Regierung tut nichts dagegen!“, brach es aus Jean-Marie heraus.
Der Direktor hielt inne, die gestikulierende Hand mit dem Kugelschreiber in der Luft wie eingefroren, und sah Jean-Marie mit blitzenden Augen an.
„Bitte?“
Jean-Marie hatte plötzlich das Gefühl, als schüre jemand ein Feuer unter dem Sitz seines Stuhles. Unsicher rutschte er hin und her und machte sich zugleich an seinem Hemdkragen zu schaffen.
„Ich meine, die Regierung hat nicht immer das glücklichste Händchen, wenn es darum geht …“
„Ich habe Sie verstanden“, unterbrach ihn der Direktor. „Was ich wissen möchte, ist, wie Sie zu der Annahme kommen.“
„Er hatte es nicht immer leicht mit gewissen Kreisen in der Hauptstadt“, kam Bonaventure seinem Bruder zu Hilfe. Er sagte das beiläufig, als wäre es das Normalste von der Welt. Jean-Marie starrte ihn verständnislos an.
„Seine Karriere in der Opposition war zwar kurz, aber sehr intensiv“, fuhr Bonaventure im selben Plauderton fort, „und jetzt hat er deswegen Probleme, in seinem erlernten Beruf zu arbeiten.“
„Und welcher ist das?“, fragte der Direktor.
„Lehrer.“
In dem kleinen Raum herrschte für einen Moment erdrückendes Schweigen. Dann lehnte sich der Direktor in seinem Stuhl nach vorne, stützte sich mit den Unterarmen auf den Tisch, faltete die Hände und fixierte Jean-Marie einmal mehr mit seinem scharfen Blick.
„Ein Lehrer, der nichts von unserer Regierung hält. Der es sich mit den Mächtigen verdorben hat und deshalb in Ungnade gefallen ist. Und mit dem kommst du zu mir, Bonaventure?“
Auf seinem Gesicht breitete sich ein Grinsen aus, das zwei Reihen bemerkenswert schief stehender Zähne sehen ließ.
„Ich hatte nichts anderes von dir erwartet! Herzlich willkommen an meiner Schule, Jean-Marie! Wann können Sie anfangen?“