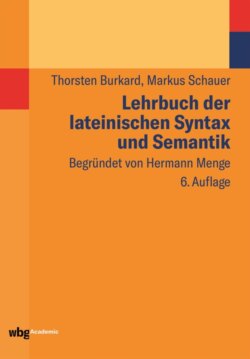Читать книгу Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik - Thorsten Burkard - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ 15Concretum pro abstracto
ОглавлениеHäufig wird im Lateinischen eine konkrete Ausdrucksweise der (grundsätzlich auch zulässigen) abstrakten vorgezogen. Im Lateinischen wird es nämlich in der Regel vermieden, leblose oder abstrakte Begriffe zum Subjekt einer Handlung zu machen, die nur von Personen ausgeführt werden kann, während im Deutschen dergleichen oft begegnet.
(1) Insbesondere tritt der konkrete Ausdruck an die Stelle des abstrakten20:
(a) bei Zeitbestimmungen mithilfe von Ämternamen (z.B. ‘Unter dem Konsulat des Marius, nach deiner Prätur’) und bei Angabe des Lebensalters, in welchem jemand etwas getan oder erfahren hat. Die Ämternamen werden dabei im Lateinischen als Prädikatsnomen (vgl. § 284,1) verwendet, während im Deutschen entweder ein ‘als’ hinzugefügt wird oder Präpositionalausdrücke gebraucht werden.
Cicerone consule (unter dem Konsulat des Cicero); ante me consulem (vor meinem Konsulat) (Pis. 4); post te praetorem (Verr. II 1,111); ante me censorem (Cato 19); Crassus adulescens (als junger Mann) (de orat. 2,170); nobis pueris (in unserer Kindheit) (de orat. 2,1). Audivi hoc de parente puer (als Kind, in meiner Kindheit) (Balb. 11). Hic senex (in hohem Alter) mortuus est (Arch. 17).
Anm. 1: Zur Altersangabe wird klassisch nicht iuvenis verwendet, sondern das ungleich häufigere adulescens (vgl. Menge Synonymik Nr.294); das klassisch seltene iuvenis wird einerseits in (leicht) abwertendem Sinn verwendet (Cael. 67; Cato 17), andererseits von jungen Männern des Mythos und der Sage (de orat. 2,353; 3,57; nat. deor. 2,6). Das Substantiv iuvenis bezeichnet einen jungen Mann um die Zwanzig (vgl. ‘Jüngling’).
Anm. 2: Natürlich sind auch präpositionale Ausdrucksweisen möglich: in senectute (ac. 2,5); in pueritia (Sull. 18); in adulescentia (Sull. 18); in quaestura (Sull. 18), in consulatu (Gall. 1,35,2).
(b) bei Angabe des Alters, von dem an etwas getan oder erfahren wurde.
a puero (von Kindheit an) (Quinct. 69); a pueris (Gall. 4,1,9); a parvulis (Gall. 6,21,3); ab adulescentulo (Quinct. 12).
Anm.: Auch hier sind abstrakte Ausdrucksweisen möglich: a pueritia (Sull. 70); ab adulescentia (p. red. in sen. 13).
(c) auch bei homo i. S. v. humanitas.
hominem (i. e. humanitatem) ex homine exuere (den Menschen seines Menschseins berauben) (fin. 5,35). Quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex homine tollat? (off. 3,26).
(2) Mit einem konkreten Substantiv wird im Lateinischen ein abstraktes deutsches Prädikatsnomen wiedergegeben, falls das Bezugswort eine Person ist, da im Lateinischen Personen vornehmlich durch Personennamen, nicht, wie oft im Deutschen, durch Sachnamen näher bestimmt werden. Dabei werden deutsche Nomina actionis häufig durch lateinische Nomina agentis, v.a. durch Substantive auf -tor (-trix) ersetzt (vgl. § 1).
Themistocles conservator Graecorum fuit (Themistokles war die Rettung Griechenlands.) (vgl. Sest. 141). Auctores belli (die Veranlassung, die Ursache) esse nolebant (Gall. 3,17,3).
Anm.: Bisweilen gibt es Ausnahmen, v.a. bei causa: Is profecto mortem attulit, qui causa mortis (jur.) fuit (Phil. 9,7).
(3) Statt eines Prädikatsnomens stehen dem Lateinischen noch andere Möglichkeiten zur Verfügung, deutsche abstrakte Prädikatsnomina bei Personen wiederzugeben.
Populus Romanus in te omnem spem ponit (Du bist die ganze Hoffnung des römischen Volkes.) (fam. 11,5,2). Alter alteri inimicus auxilio salutique erat (Beide Gegner waren einander Hilfe und Rettung.) (Gall. 5,44,14).
(4) So entspricht einem deutschen Präpositionalgefüge mit einem Abstraktum im Lateinischen oft ein Ablativus absolutus mit einem Personennamen (vgl. § 504,1):
| duce tribuno plebis, consulibus auctoribus | unter Führung des Volkstribunen und auf Anstiftung der Konsulna |
| Dumnorige deprecatore | durch Vermittlung des Dumnorixb |
| nullis comitibus | ohne Begleitungc |
| vobis testibus | nach eurem Zeugnisd |
a dom. 96 b Gall. 1,9,2 c Mil. 28 d Flacc. 8
Anm.: Ähnlich findet sich zuweilen auch gladiatoribus i. S. v. ‘bei den Gladiatorenspielen’ (statt munus): Quid gladiatoribus clamor civium? (Was ist mit dem Geschrei der Bürger bei den Gladiatorenspielen?) (Phil. 1,36).
(5) Bei der Übersetzung von geographischen Bezeichnungen ist Folgendes zu beachten21:
(a) Im Lateinischen wird es vermieden, einer Stadt oder einem Land als Subjekt Handlungen zuzuschreiben, die nur Personen ausführen können (vgl. aber b). Dementsprechend sind auch die Bezeichnungen ‘Stadt’ und ‘Land’ mit civitas, gens, natio oder populus wiederzugeben.22
Athenienses et Lacedaemonii bellum gesserunt (Athen führte Krieg mit Sparta.) (rep. 1,25). Pompeius Saguntinos civitate donavit (Pompeius verlieh Sagunt das Bürgerrecht.) (Balb. 51). Cretensium dura natio est; at Athenienses misericordes (Phil. 5,14).
(b) Ausnahmen finden sich v.a., wenn die Eigentümlichkeit eines Volkes oder einer Stadt betont werden soll,23 am häufigsten bei Graecia, Asia, Italia, Gallia, Athenae, Carthago und anderen bedeutenden Städten (vgl. § 16,2).
Athenae tuae multa divinaque peperisse mihi videntur (leg. 2,36). Quidquid potuit Capua, potuit ipsa per sese (leg. agr. 1,20).
Weitere Stellen: Graecia: de orat. 2,6; Tusc. 1,2; div. 1,3; Carthago: Balb. 34; andere Länder: Verr. II 4,57; orat. 25.
Anm.: Ist das Land oder die Stadt nicht das Subjekt des Satzes, ist die Personifikation häufiger (vgl. Lebreton 75–77).
(c) Häufig werden auch die Länderdurch die Namen der betreffenden Völker bezeichnet, so dass für viele Völkernamen ein entsprechender Länder name im klassischen Latein überhaupt nicht belegt ist (vgl. Haedui, Helvetii, Persae, Sequani u.a.) (vgl. § 16,2).
Caesar ex Menapiis in Treveros venit (Gall. 6,9,1). In Persis augurantur et divinant Magi (div. 1,90).
Anm.: Entgegen Menge § 162c können Namen von Städtebewohnern nicht wie ein Städtename in den Lokativ oder den Richtungsakkusativ gesetzt werden. Das dort aufgeführte Beispiel Leontini ist an der Stelle Verr. II 3,60 kein Personennamen, sondern ein Städtename.
(d) Ähnlich dient auch inferi (die Toten) zur Bezeichnung der Unterwelt in Ausdrücken wie ad inferos (in der Unterwelt) (Phil. 14,32); apud inferos (inv. 1,46); ad inferos pervenire (Lael. 12); mortuos excitare ab inferis (Verr. II 5,129); ab inferis evocare (Mil. 79); ab inferis exsistere (Verr. II 1,94).
Anm.: Die Bezeichnungen Orcus und Tartarus i. S. v. ‘Unterwelt’ sind poetisch. Orcus ist im klassischen Latein ein Name für den Totengott (Verr. II 4,111). Der Ausdruck loca infera, den Menge § 162c Anm. als Prosaausdruck anführt, ist poetisch; auch sedes inferorum ist nicht belegt (vgl. Menge a.a.O.) (Δ).
(6) Die maskulinen Substantive oriens (oder oriens sol), occidens (oder occidens sol), meridies, septentriones bezeichnen klassisch die Himmelsrichtungen. Sie werden aber nicht metonymisch als geographische Gesamtbezeichnungen der entsprechenden Länder und Völker verwendet (vgl. im Deutschen: Der Süden betreibt Weinbau.). Dafür treten Ausdrücke ein wie orientis terrae, partes, provinciae, gentes, populi, homines.
Britannia est insula naturā triquetra (dreieckig), cuius unum latus est contra Galliam; huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, ad orientem solem, alter ad meridiem spectat; alterum latus vergit (spectare ad und vergere ad in Verbindung mit den o. g. Bezeichnungen der Himmelsrichtungen bedeuten ‘liegen’) ad Hispaniam atque occidentem solem (Gall. 5,13,1f.). Iusserunt simulacrum Iovis ad orientem convertere (Catil. 3,20). Di his quoque hominibus consulunt, qui has nobiscum terras ab oriente ad occidentem colunt (nat. deor. 2,164). Quis in ultimis orientis aut obeuntis solis aut aquilonis austrive partibus tuum nomen audiet? (Wer wird in den entferntesten Gegenden des Ostens, Westens, Nordens oder Südens deinen Namen hören?) (rep.6,22).
(7) Deutsche Wendungen wie ‘das Beispiel zeigt, das Drama lehrt, der Text sagt’, in denen eine für das Lateinische zu kühne Personifikation vorliegt, werden im Lateinischen in der Weise umgeformt, dass das deutsche Subjekt zu einem Ablativus instrumentalis (vgl. § 376), Dativus finalis (vgl. § 332) o.ä. wird, z.B.: ‘Das Beispiel des Krösus lehrt, dass alles Irdische vergänglich ist.’ Exemplo Croesi discimus res humanas caducas esse. oder Res humanas caducas esse Croesus documento est (nicht docet).
Quantum in bello fortuna posset, iam ipsi incommodis suis satis erant documento (dafür waren ihre Niederlagen Beweis genug) (civ. 3,10,6). Habeat me ipsum sibi documento, quem equestri ortum loco consulem videt (leg. agr. 1,27).
(8) Der konkrete Ausdruck statt des abstrakten steht auch in der Verbindung von est (videtur, putatur u.a.) mit dem Genetivus proprietatis (vgl. § 303) eines Substantivs oder eines substantivierten Adjektivs (vgl. § 24).
Arrogantis est (Es verrät Anmaßung.) (off. 1,99). Barbarorum est (Es ist ein Zeichen von Barbarei.) (de orat. 2,169). Duri hominis videtur (Es hinterlässt den Eindruck von Gefühllosigkeit.) (off. 2,50).
(9) Oft stehen auch konkrete Pluralia statt eines zusammenfassenden Abstraktums, und zwar sowohl bei Personennamen als auch bei Sachnamen.
Totos se alii ad poetas, alii ad geometras, alii ad musicos contulerunt (Die einen wandten sich ganz der Dichtung, die anderen der Geometrie, wieder andere der Musik zu.) (de orat. 3,58). Libido magis est adulescentium quam senum (Cato 36).
| angores | Melancholie, Angstzuständea |
| consilia atque facta | Denk- und Handlungsweise |
| iudicia | Gerichtswesen |
| leges Solonis | die solonische Verfassungb |
| litterae | Schriftstellerei |
| nobiles, principes | Aristokratie |
a Phil. 2,37; off. 2,2 b leg. 1,57