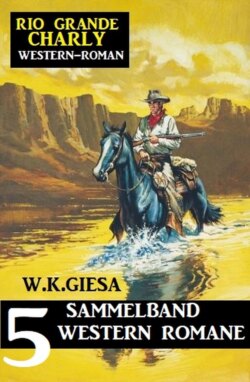Читать книгу Rio Grande Charly Sammelband 5 Western Romane - W. K. Giesa - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
30
ОглавлениеCharly erwachte erst, als sie das Seminolendorf am Canadian River erreicht hatten. In seinem Kopf hämmerte und pochte es immer noch. Mühsam öffnete Charly die Augen und sah sich um. Er war gefesselt und lag ihm Gras. Neben ihm die anderen Männer, die am Camp überwältigt worden waren. Erleichtert erkannte der Texaner, dass sie vollzählig waren – mit Ausnahme des Ranchers.
Gerade wurde der letzte Cowboy vom Pferd gehoben und unsanft zu den anderen geworfen.
Charly sah die ausgebrannten Reste dreier Zelte. Da wurde ihm klar, was die Indianer zu ihrem Feldzug bewogen hatte. Die Banditen schienen nicht nur den Viehtreck angegriffen zu haben.
Die Pferde der Gefangenen wurden zu einem Corral abseits des Dorfes geführt. Charlys Gedanken beschäftigten sich bereits damit, wie er dorthin kam und wie er anschließend am besten floh. Und mit ihm die anderen Männer.
Er war sicher, dass sie ähnliche Gedanken hegten.
Aber vorläufig sah es nicht so aus, als würden die Seminolen ihnen eine Chance geben. Ein halbes Dutzend Krieger hielten ihre Gewehre auf die Weißen gerichtet. Die Waffen waren zwar ältere Modelle, aber auch mit einem Vorderlader kann man einen Mann töten.
Charly wandte sich an Weisman, der neben ihm lag. „Was ist mit dem Rancher?“
„Hoffentlich entkommen“, murmelte der Cowboy. „Nett, dass Sie auch wieder wach sind. Wenn der Captain Glück hat, schafft er es, Hilfe aus Clinton zu holen. Bloß glaube ich nicht dran, dass sich die Leute da aufraffen, etwas für uns zu unternehmen.“
Charly sah es inzwischen ähnlich. In diesem Indianerdorf mochte es zwischen sechzig und siebzig Krieger geben. Es war zweifelhaft, ob die Leute aus Clinton es riskierten, sich mit ihnen anzulegen. Außerdem war es von Clinton bis hierher ein nicht gerade kurzer Weg.
Charly hörte den Fluss rauschen. Das war etwas Größeres als der Washita. Das musste der Canadian sein.
Es war mittlerweile fast dunkel geworden. Die Nacht kam jetzt schnell. Kleine Feuer loderten vor den Zelten auf.
„Wissen Sie, was die Seminolen mit uns vorhaben?“, fragte Charly leise.
„Die sagen kein Wort, das man verstehen kann“, knurrte Weisman. „Auf Fragen antworten sie nicht. Aber ich schätze, dass sie uns bis zum Morgengrauen in Ruhe lassen werden. So lange dürften wir also Zeit haben.“
„Wenn sie uns hier liegen lassen, haben wir Pech“, sagte Charly. „Hier können sie uns optimal bewachen. Freie Fläche, keine Möglichkeit zu entwischen.“
„Habe ich mir auch schon überlegt“, murmelte Weisman. „Wir werden dann gleich doppelt Pech haben. Schauen Sie sich den Himmel an, Wash. Sehen Sie auch nur einen Stern? Es ist verdammt düster geworden, und die Luft riecht nach Regen. Ich glaube kaum, dass die Indianer uns in die Zelte bringen. Sie hängen uns höchstens hinterher zum Trocknen auf. Am Hals.“
Mit dieser Art von schwarzem Humor konnte Charly sich nicht anfreunden.
Er versuchte so viel wie möglich zu erkennen, obgleich es jetzt schon fast nachtschwarz geworden war. Er sah, wie einige Krieger erbeutete Waffen davontrugen. Gewehre und Patronengurte mit Revolvern. Charly versuchte zu erkennen, wohin die Waffen gebracht wurden, aber er konnte es nicht genau feststellen. Es blieben gut drei Zelte zur Auswahl.
Das war ärgerlich.
Die Krieger kamen zurück. Sie rissen die Gefangenen vom Boden hoch und stießen sie vor sich her. Es ging zur anderen Seite des Zeltdorfes, fort vom Pferdecorral. Weisman murmelte ständig Verwünschungen, bis einer der Seminolen ihm den Gewehrkolben in den Rücken stieß und ihn aufforderte, ruhig zu sein.
Auf der anderen Seite befanden sich bereits weitere Gefangene. Charly zählte insgesamt acht Männer, die gefesselt auf dem harten Boden lagen. Die Seminolen schienen einen ziemlich großen Schlag geführt zu haben.
Charly beobachtete seine Begleiter. Die zeigten beim Anblick der anderen Gefangenen kein Erkennen, nur Verwunderung. Sollten jene acht zu Crockets Banditen gehören? Möglich war es, sogar wahrscheinlich. Denn welche anderen Weißen sollten sich sonst derzeit in dieser Gegend herumtreiben?
Charly wandte sich den Kriegern zu. „Warum habt ihr uns gefangengenommen? Was haben wir euch getan?“, fragte er.
Er erhielt keine Antwort.
Einer der Gefangenen lachte spöttisch auf. „Gib dir keine Mühe, Mann. Die reden nicht mit uns.“
„Das haben wir wohl euch zu verdanken, wie?“, fragte Charly.
„Was willst du damit sagen?“, knurrte der Mann.
„Frag lieber Crocket“, empfahl Charly. Es war ein Versuch. Und der Pfeil traf ins Schwarze.
„Der scheint ihnen entwischt zu sein. Lässt uns einfach im Stich, dieser Hund! Vorher waren wir ihm gut genug …“
„Dann seid ihr also die Dreckskerle, die uns überfallen und Matt und Roscoe auf dem Gewissen haben?“, fauchte Weisman los. „Der Teufel soll euch holen! Hoffentlich bringen die Roten euch schön langsam um!“
„Uns allein bestimmt nicht. Ihr seid mit dabei“, zischte der andere gehässig.
Charly hörte sich die weitere Unterhaltung schweigend an. Er verstand nicht, warum die Männer sich in dieser Situation befehdeten. Es wäre besser, wenn sie gemeinsam versuchten, einen Ausweg zu finden. Später konnten sie immer noch klären, wie sie zueinander standen. Wichtig war, dass sie den Seminolen entkamen.
Denn dass diese sie alle nicht nur zum Spaß gefangengenommen hatten, war klar. Wenig später wurde es ihnen deutlich gemacht. Ein Seminole, den Charly für den Häuptling hielt, baute sich vor ihnen auf.
„Genießt diese Nacht, denn sie wird eure letzte sein, weiße Hunde. Morgen werden wir über euch richten. Eure schändliche Tat“, er machte eine ausholende Geste, die das ganze Dorf umfasste, „verdient nur eine Strafe: den Tod!“
„He, wir haben damit nichts zu tun, was auch immer es war“, schrie Weisman. „Das waren diese Kerle da! Wir sind selbst überfallen worden!“
„Es macht keinen Unterschied“, sagte der Seminole. „Ich habe keine Lust, mir das Winseln von Feiglingen anzuhören, die sich gegenseitig beschuldigen.“ Er schritt davon.
„Wir müssen hier weg, zum Teufel“, murmelte Weisman. „Die bringen uns tatsächlich um!“
„Ja“, sagte Charly leise. Er zerrte an seinen Fesseln. Sie hatten ihm und den anderen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und die Füße zusammengeschnürt. Das hieß, dass sie alle nur auf der Seite liegen konnten, rechts oder links. Eis war verdammt ungemütlich, und der Boden war hart und kühl.
Die Fesseln ließen sich nicht zerreißen, zudem war die freie Fläche einfach zu übersichtlich und die Indianer zu wachsam.
Es wurde immer kühler. Wind kam auf. Er brachte die Regenfront mit sich.