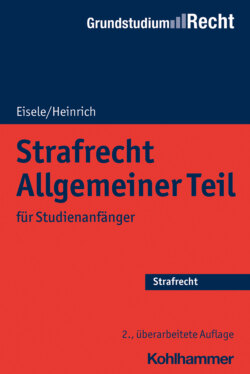Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Bernd Heinrich - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.Grundtatbestand, Qualifikation, Privilegierung
Оглавление116Im StGB gibt es häufig Delikte, die auf andere Delikte (den Grundtatbeständen) aufbauen, aber zusätzliche Merkmale enthalten, die die Strafe entweder schärfen (Qualifikationen) oder mildern (Privilegierungen). Eine Sonderform der Qualifikationen stellen die Erfolgsqualifikationen (oder: erfolgsqualifizierten Delikte) dar.
Definition
Unter einem Grundtatbestand versteht man einen Tatbestand, welcher zwar in sich abgeschlossen ist und eine eigenständige Strafbarkeit begründet, aber darüber hinaus bei Hinzutreten zusätzlicher Umstände auch Ausgangspunkt für weitere Delikte sein kann.
Bsp.: Die einfache Körperverletzung, § 223 StGB, ist als Grundtatbestand anzusehen. Wird sie mittels einer Waffe begangen, greift die Qualifikation der besonders schweren Körperverletzung, § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB, ein, führt die Körperverletzung später zum Tod des Opfers, ohne dass der Täter dies wollte, liegt die Qualifikation der Körperverletzung mit Todesfolge vor, § 227 StGB.
Definition
Unter einem Qualifikationstatbestand versteht man eine unselbstständige Tatbestandsabwandlung, welche sich aus einem Grundtatbestand und weiteren strafschärfenden Tatbestandsmerkmalen zusammensetzt. Kennzeichnend hierfür ist, dass diese qualifizierenden Merkmale (als objektive Tatbestandsmerkmale) grundsätzlich vom Vorsatz umfasst sein müssen.
Bsp.: Im bereits genannten Fall der besonders schweren Körperverletzung, § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB, muss der Täter also wissen, dass er die Verletzung mit einer Waffe vornimmt und er muss dies auch wollen. Wer also einem anderen mit einem kleinen für leer angesehenen Sandsack (= kein gefährliches Werkzeug) auf den Kopf schlägt, in dem sich aber, was der Täter nicht weiß, ein größerer Stein befindet (= gefährliches Werkzeug), der begeht zwar objektiv, nicht aber subjektiv eine Straftat nach § 224 StGB. Da Vorsatz hier stets erforderlich ist, bleibt es also bei einer Straftat nach § 223 StGB, der einfachen Körperverletzung.
Definition
Unter einem erfolgsqualifizierten Delikt versteht man ein Delikt, bei welchem die Strafbarkeit des Grunddelikts durch den Eintritt einer schweren Folge (zumeist den Tod des Opfers) erhöht wird. Im Gegensatz zu den echten Qualifikationen, bei denen die qualifizierenden Merkmale vom Vorsatz umfasst sein müssen, reicht bei den Erfolgsqualifikationen hinsichtlich des Eintritts der schweren Folge nach § 18 StGB Fahrlässigkeit aus.
Bsp.: Im bereits genannten Fall der Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 StGB, führt der durch die Körperverletzung herbeigeführte Tod des Opfers zu einer wesentlichen Strafschärfung. War der Tod des Opfers gewollt, liegt allerdings nicht nur eine Körperverletzung mit Todesfolge, sondern ein Totschlag vor, § 212 StGB. War der Tod nicht gewollt, greift hingegen § 227 StGB ein, wenn der Tod wenigstens auf Fahrlässigkeit beruht, d. h. im konkreten Fall für den Täter vorhersehbar war. – In diesem Bereich finden sich allerdings auch erfolgsqualifizierte Delikte, bei denen der Fahrlässigkeitsmaßstab erhöht wurde und statt einfacher Fahrlässigkeit ein „leichtfertiges“ Verhalten gefordert wird,47 wie z. B. bei einem Raub mit Todesfolge, § 251 StGB.
Definition
Unter einem Privilegierungstatbestand versteht man eine unselbstständige Tatbestandsabwandlung, welche sich aus einem Grundtatbestand und weiteren strafmildernden Tatbestandsmerkmalen zusammensetzt. Wie auch bei den Qualifikationen müssen diese privilegierenden Tatumstände – in der Regel – vom Vorsatz des Täters umfasst sein, damit sie ihm zu Gute kommen können. Die Milderung kann hier entweder in einer geringeren Strafandrohung oder auch darin liegen, dass der Gesetzgeber die Strafverfolgung – bei gleichem Strafrahmen – von einem Strafantrag abhängig macht.
Bsp.: Die Tötung auf Verlangen, § 217 StGB, setzt die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen (= Totschlag, § 212 StGB) voraus, bei welcher der Täter aber durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen des Opfers motiviert wurde. Ist dem Täter dieses Verlangen des Opfers bekannt, greift die Privilegierung des § 217 StGB ein und die Strafe fällt geringer aus wie beim Totschlag nach § 212 StGB. – Begeht der Täter einen Diebstahl einer „geringwertigen Sache“,48 so wird er zwar nicht milder bestraft wie beim normalen Diebstahl, § 242 StGB, die Strafverfolgung wird jedoch davon abhängig gemacht, dass das Opfer einen Strafantrag stellt, § 248a StGB. Insoweit gilt es allerdings zu beachten, dass die Geringwertigkeit hier nicht vom Vorsatz des Täters umfasst zu sein braucht. 248a StGB stellt dementsprechend allenfalls eine strafprozessual wirkende Privilegierung zu §§ 242, 246 StGB dar, die sich nicht auf den Tatbestand des Diebstahls auswirkt.
117Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang noch die Regelbeispiele. Sie stellen eine gesetzliche Normierung von besonders schweren oder minder schweren Fällen eines bestimmten Grunddelikts dar, die allerdings – wie die besonders schweren und minder schweren Fälle an sich – keine Qualifikationen darstellen, sondern ausschließlich auf Strafzumessungsebene zu berücksichtigen sind. Wie bereits erwähnt, sind solche Strafzumessungsüberlegungen von den Studierenden in einer Klausur an sich nicht anzustellen, da sie außerhalb des dreigliedrigen Prüfungsschemas (Tatbestand – Rechtswidrigkeit – Schuld) stehen und das komplette Vorliegen einer Straftat voraussetzen. Die besonders schweren und minder schweren Fälle stellen diesbezüglich allerdings eine Ausnahme dar, da sie, insbesondere, wenn sie mit Regelbeispielen versehen sind, nicht nur „wie Qualifikationstatbestände“ geprüft werden, sondern auch den Strafrahmen des jeweiligen Delikts verändern.
Bsp.: „Klassisches“ Beispiel eines besonders schweren Falles, der mit Regelbeispielen versehen ist, ist der besonders schwere Fall des Diebstahls, § 243 StGB. Hier ist nicht nur der Strafrahmen im Vergleich zum einfachen Diebstahl, § 242 StGB, erhöht, sondern die einzelnen Voraussetzungen, unter denen ein solches Regelbeispiel gegeben ist, sind in den einzelnen Ziffern so detailliert umschrieben, dass man sie „wie Tatbestandsmerkmale“ prüfen kann.
118Die Besonderheit dieser Regelbeispiele besteht darin, dass sie lediglich eine „Indizwirkung“ für das Vorliegen eines besonders schweren oder minder schweren Falles besitzen. Dies bedeutet, dass bei Vorliegen eines solchen Regelbeispiels lediglich eine widerlegbare Vermutung dafür spricht, dass ein besonders schwerer (oder minder schwerer) Fall vorliegt. Sprechen jedoch andere Gründe dafür, dass das Delikt als weniger gravierend erscheint, kann der Richter im Einzelfall trotz Vorliegens eines Regelbeispiels einen besonders schweren Fall auch ablehnen. Andererseits spricht in gleicher Weise eine widerlegbare Vermutung gegen eine Strafschärfung (oder -milderung), wenn ein solches Regelbeispiel nicht vorliegt (= klassischer „Gegenschluss“).
119Demnach kann im Einzelfall das Vorliegen eines „unbenannten“ besonders schweren (oder minder schweren) Falles auch dann angenommen werden, wenn zwar keines der genannten Regelbeispiele vorliegt, der Fall aber im Unrechts- oder Schuldgehalt mit einem solchen vergleichbar ist (= Analogiewirkung). Der sich hierdurch geradezu aufdrängende Verstoß gegen das Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG49 wird dabei mit folgender Argumentation umgangen: Obwohl die Regelbeispiele zumeist tatbestandsähnlich ausgestaltet seien, würden sie doch keine echten Tatbestandsmerkmale darstellen, da sie als bloße „Strafzumessungsregeln“ eben keinen Einfluss auf die Strafbarkeit an sich, sondern eben nur auf die Strafzumessung besitzen. Dem Gesetzgeber müsse es aber erlaubt sein, im Gesetz „besonders schwere“ Fälle unter eine höhere Strafdrohung zu stellen. Gäbe es nun lediglich das Merkmal „besonders schwerer Fall“ und gäbe es die ausformulierten Regelbeispiele nicht, hätte der Richter bei der Beurteilung, ob ein besonders schwerer Fall vorliegt, überhaupt keine gesetzlichen Anhaltspunkte. Im Ergebnis würde also die Regelbeispielstechnik sogar die Rechtssicherheit gerade fördern und ihr nicht abträglich sein.