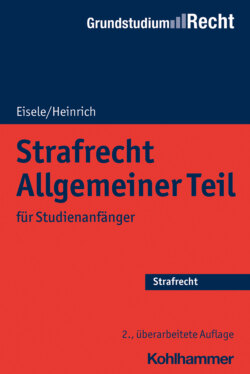Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Bernd Heinrich - Страница 62
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Die Äquivalenz- oder Bedingungstheorie
Оглавление142 Definition
Ursächlich im Sinne des Strafrechts ist jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele (sog. conditio-sine-qua-non-Formel).
Die Äquivalenz- oder Bedingungstheorie bedient sich somit einer äußerst weiten Kausalitätsformel. Dabei ist ein rein „faktischer“ und kein „normativer“ Maßstab anzulegen. Es reicht also ein rein naturwissenschaftlich nachweisbarer Ursachenzusammenhang aus. Dabei wird jede Bedingung als gleichwertig (also „äquivalent“) angesehen. Es wird also auf der Ebene der Kausalität noch nicht zwischen unmittelbaren und mittelbaren, typischen oder zufälligen Kausalfaktoren unterschieden. Auch jede noch so entfernt liegende Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, muss gleichwertig berücksichtigt werden und zur Annahme einer Kausalität führen. Eine normative Einschränkung erfolgt erst in einem zweiten Schritt, der objektiven Zurechnung, bei der geprüft wird, ob die kausale Verursachung des Erfolges dem Täter strafrechtlich auch als „sein Werk“ anzusehen ist. Insoweit wird in einer Klausur die Kausalität – jedenfalls bei Delikten, die durch aktives Tun begangen werden – nur selten zu verneinen sein.
Bsp.: Im gerade genannten Beispiel, in dem Anton dem Bruno eine Ohrfeige geben will, dieser beim Ausweichen stolpert und sich dabei eine Platzwunde zuzieht und schließlich auf dem Weg ins Krankenhaus bei einem Autounfall stirbt, ist die Kausalität sowohl für die Platzwunde als auch für den Tod zu bejahen: Hätte Anton den Bruno nicht ohrfeigen wollen, wäre dieser nicht ausgewichen. Wäre Bruno nicht ausgewichen, wäre er nicht gestolpert. Wäre er nicht gestolpert, hätte er sich keine Platzwunde zugezogen, Hätte er sich keine Platzwunde zugezogen, wäre er nicht mit dem Krankenwagen abgeholt worden. Wäre er nicht von dem Krankenwagen abgeholt worden, wäre es nicht zu dem Unfall gekommen und Bruno wäre nicht an den Folgen des Unfalls gestorben. Denkt man also das Verhalten des Anton (Erheben der Hand) hinweg, wäre der Erfolg in seiner konkreten Gestalt (Tod durch den Unfall) nicht eingetreten. Kausalität liegt also – nach einem rein naturwissenschaftlichen Verursachungsmaßstab – vor. Ob der Tod dem Anton als sein Werk zuzurechnen ist oder ob sich beim Verkehrsunfall ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht und ob Antons Verhalten auch dann noch zu einer Strafbarkeit führen soll, wenn Brunos Tod durch das Verschulden eines anderen, z. B. den betrunkenen Fahrer des Krankenwagens, (mit) herbeigeführt wurde, ist eine Sache der normativen Wertung, also der objektiven Zurechnung.
143Dem BGH genügt bei der Bestimmung der Kausalität eine sog. „generelle Kausalität“: Ausreichend sei es (insbesondere bei der Produkthaftung), nachzuweisen, dass ein bestimmtes Produkt entsprechende Wirkungen hat. Nicht erforderlich sei es, dass die einzelnen naturgesetzlichen Wirkungszusammenhänge im Detail geklärt und nachgewiesen werden.
Bsp.: Bei der Verwendung eines Ledersprays kommt es bei Kunden vermehrt zu Gesundheitsschäden. Dabei kann nachgewiesen werden, dass die Gesundheitsschäden zwar nicht bei allen Personen aufgetreten sind, die das Spray benutzt haben, dass die Schäden aber nur bei solchen Personen eintraten, die in Kontakt mit dem Spray gekommen sind. Dem BGH reichte dies zur Annahme der Kausalität, auch wenn nicht konkret nachgewiesen werden konnte, welche einzelnen Substanzen in welcher Kombination die Schäden verursacht hatte.56
144Da das „Hinwegdenken“ von Ursachen naturgemäß nur bei den Begehungsdelikten, wenn der Täter also aktiv handelt, gelingt, wird bei den Unterlassungsdelikten die Formel leicht abgewandelt und dadurch angeglichen: Ursächlich im Sinne des Strafrechts ist hier jede Bedingung, die nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele.