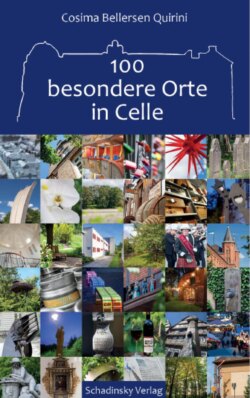Читать книгу 100 besondere Orte in Celle - Cosima Bellersen Quirini - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8 Der jüdische Friedhof
Spurensuche im Hehlentor
Der Friedhof steht im Judentum für würdige Ruhe, ein Grab soll auf ewig unangetastet bleiben. Von sanfter Ruhe und wohltuender Stille durchflutet, liegt ein solcher mitten ins Hehlentorgebiet Celles geschmiegt, das gutbürgerliche Wohnviertel nördlich der Aller. Kaum jemand kennt ihn, obwohl die Mauern im Norden und Osten an bewohnte Gärten grenzen. Der Gottesacker mit seinen 288 Grabstellen, so scheint es, soll nicht aufdringlich wirken und besser nicht zu auffällig sein. Von großen Toren bewacht, durch Vorhängeschlösser geschützt und von einer roten, verwitterten Backsteinmauer umsäumt, darf er sich nicht allzu präsent geben. Von der Straße aus sind jedoch die Grabsteine weithin zu sehen, ein Besuch ist der Ort wert. Hin und wieder werden auch die Tore geöffnet, zum Tag des Denkmals beispielsweise, wenn Angehörige zu Besuch kommen oder das Gartenamt seinen pflegerischen Aufgaben nachkommt. Wer den Friedhof ansonsten betreten möchte, muss sich bei der jüdischen Gemeinde oder der Stadt die Erlaubnis dafür einholen. Gut zwei Kilometer von der Synagoge im Stadtteil Blumlage entfernt liegt das Friedhofsgelände, welches Ende des siebzehnten Jahrhunderts den ursprünglich fünf Celler Schutzjuden, welche sich mit ihren Familien und dem dazugehörigen Gesinde wenige Jahre zuvor mit herzoglicher Erlaubnis dort niedergelassen hatten, zugewiesen worden war. Der älteste Grabstein datiert aus dem Jahr 1705, der letzte von 1953. Eine Einfriedung und ein kleines Wächterhaus wurden zum Schutz errichtet, 1911 die von dem Celler Bauhaus-Architekten Otto Haesler entworfene Friedhofshalle erbaut. Wächterhaus und Halle wurden 1974 wieder abgerissen, da das Hochbauamt seinerzeit die Friedhofshalle nicht als Baudenkmal anerkannte. Viele Jahre von den Stadtvätern kaum beachtet und dafür leider immer wieder Ziel von Vandalismus und Zerstörung, steht der Friedhof heute für über zweieinhalb Jahrhunderte jüdischer Kultur- und Kunstgeschichte in Celle. Die Grabsteine, vorn sind lateinische und hinten hebräische Schriftzeichen eingemeißelt, geben in dieser idyllischen Lage Zeugnis darüber ab, wer im Laufe der Zeit hier seine letzte Ruhestätte fand. Traditionelle Bildsymbole und jüdische Grabornamentik weisen darauf hin, welchen jüdischen Familien die Bestatteten einst zugehörig waren. Die gefalteten Hände weisen auf Familiennamen wie Cohen, Katz oder Kahn hin, ein Krug auf Namen wie Levi, Lewin, Löwe oder Löwenthal. Auch weitere Symbole sprechen: Der Magen David (Davidstern) steht als Sinnbild für das Judentum schlechthin, eine geknickte Blüte oder ein Baumstumpf symbolisieren „aus der Blüte des Lebens gerissen“, ein Palmzweig steht für den Glauben an Wiedergeburt und Unsterblichkeit.