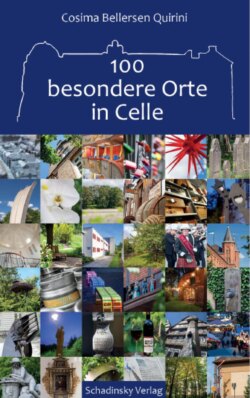Читать книгу 100 besondere Orte in Celle - Cosima Bellersen Quirini - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление17 Die Bauhaussiedlungen und das Otto-Haesler-Museum
Architektur auf Weltniveau
Was den Berlinern Mies van der Rohe oder den Dessauern Walter Gropius bedeutet, das ist der Architekt Otto Haesler für Celle. Ja, doch, man darf ihn ruhig in einem Atemzug mit so berühmten Namen aus Kunst und Design in Verbindung bringen, gilt er schließlich neben diesen Vertretern des Bauhauses als bedeutender Architekt des „Neuen Bauens“, eines Baustils, der in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug begann. Otto Haesler ersann sozusagen den sozialen Wohnungsbau und schuf damit bezahlbare, praktische und verbesserte Wohnformen für Leute mit kleinerem Geldbeutel – die von ihm entworfenen Wohnungen galten in der Weimarer Republik als so preisgünstig wie komfortabel. Er setzte seinen Stil, besonderes Kennzeichen sind unter anderem die nach dem Sonnenstand ausgerichteten Flachdächer, in seinen späteren Celler Jahren (insgesamt war er von 1906 – 1933 hier ansässig) als freischaffender Architekt konsequent um und verhalf damit der damals etwa 25.000 Einwohner zählenden Stadt Celle zu einem Ruf, der den Vergleich mit Berlin, Kassel oder Frankfurt nicht zu scheuen brauchte. In der Zeit entstanden mehrere Bauhaussiedlungen, im Volksmund alsbald „Klein-Marokko“ genannt: 1924 „Italienischer Garten“, 1925 „Georgsgarten“ und 1928 die Siedlung „Galgenberg/Blumläger Feld“. Zu den international zehn wichtigsten Bauwerken des Bauhausstils zählt heute die Altstädter Schule, welche 1927/28 ebenfalls von Haesler erbaut wurde. Mit dieser so genannten „Glasschule“ und dem danebenstehenden Rektorenhaus wurde Celle seinerzeit zum Mekka für Fan des Stils „Neues Bauen“. 1930 kam das 350 Quadratmeter große Ernestinum-Direktoren-Wohnhaus dazu, welches heute als Kunst-Galerie genutzt wird. In der Siedlung „Blumenläger Feld“ ist das Otto-Haesler-Museum unterbracht, das sehr anschaulich original erhaltene und eingerichtete Bauhauswohnungen zeigt, ebenso das Wasch- und Badehaus von 1931, dem 156 Wohnungen zugeteilt waren, sowie eine rekonstruierte Flüchtlingsunterkunft von 1945 und eine Arbeiter-Wohnung im Stil der 50er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Haesler hat in Celle viele Spuren hinterlassen, nicht nur im Stil „Neues Bauen“. Einen Stadtplan, in dem die wichtigsten Haesler-Arbeiten (Umbauten, Bauten) verzeichnet sind, finden Sie im Internet unter: otto-haesler-stiftung.de/Haesler-Stadtplan.